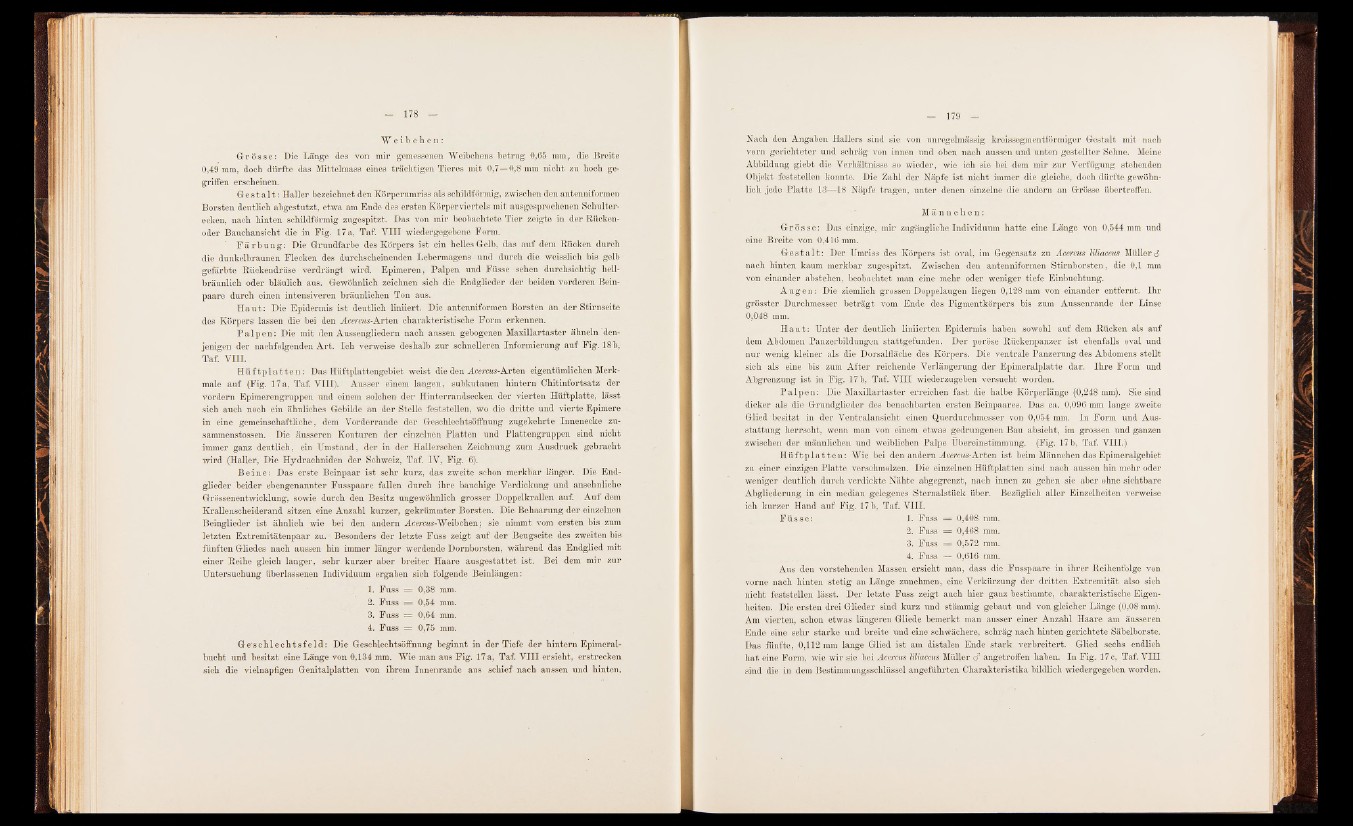
W e i b c h e n :
G r ö s s e : Die Länge des von mir gemessenen Weibchens betrug 0,65 mm, die Breite
0,49 mm, doch dürfte das Mittelmass eines trächtigen Tieres mit 0,7—0,8 mm nicht zu hoch gegriffen
erscheinen.
G e s t a l t : Haller bezeichnet den Körperumriss als schildförmig, zwischen den antenniformen
Borsten deutlich abgestutzt, etwa am Ende des ersten Körperviertels mit ausgesprochenen Schulterecken,
nach hinten schildförmig zugespitzt. Das von mir beobachtete Tier zeigte in der Rücken-
oder Bauchansicht die in Fig. 17 a, Taf. V III wiedergegebene Form.
F ä r b u n g : Die Grundfarbe des Körpers ist ein helles Gelb, das auf dem Rücken durch
die dunkelbraunen Flecken des durchscheinenden Lebermagens und durch die weisslich bis gelb
gefärbte Rückendrüse verdrängt wird. Epimeren, Palpen und Füsse sehen durchsichtig hellbräunlich
oder bläulich aus. Gewöhnlich zeichnen sich die Endglieder der beiden vorderen Beinpaare
durch einen intensiveren bräunlichen Ton aus.
H a u t: Die Epidermis ist deutlich liniiert. Die antenniformen Borsten an der Stirnseite
des Körpers lassen die bei den Arten charakteristische Form erkennen,
P a lp e n : Die mit den Aussengliedem nach aussen gebogenen Maxillartaster ähneln denjenigen
der nachfolgenden Art. Ich verweise deshalb zur schnelleren Informierung auf Fig. 18 b,
Taf. VEU.
H ü f t p l a t t e n : Das Hiiftplattengebiet weist die den Acercus-Arten eigentümlichen Merkmale
auf (Fig. 17a, Taf. VIII). Ausser einem langen, subkutanen hintern Chitinfortsatz der
vordem Epimerengruppen und einem solchen der Hinterrandsecken der vierten Hüftplatte, lässt
sich auch noch ein ähnliches Gebilde an der Stelle feststellen, wo die dritte und vierte Epimere
in eine gemeinschaftliche, dem Vorderrande der Geschlechtsöffnung zugekehrte Innenecke zu-
sammenstossen. Die äusseren Konturen der einzelnen Platten und Plattengruppen sind nicht
immer ganz deutlich, ein Umstand, der in der Hallerschen Zeichnung zum Ausdruck gebracht
wird (Haller, Die Hydrachniden der Schweiz, Taf. IV, Fig. 6).
B e in e : Das erste Beinpaar ist sehr kurz, das zweite schon merkbar länger. Die Endglieder
beider ebengenannter Fusspaare fallen durch ihre bauchige Verdickung und ansehnliche
Grössenentwicklung, sowie durch den Besitz ungewöhnlich grösser Doppelkrallen auf. Auf dem
Krallenscheiderand sitzen eine Anzahl kurzer, gekrümmter Borsten. Die Behaarung der einzelnen
Beinglieder is t ähnlich wie bei den ändern Acercus-Weibchen; sie nimmt vom ersten bis zum
letzten Extremitätenpaar zu. Besonders der letzte Fuss zeigt auf der Beugseite des zweiten bis
fünften Gliedes nach aussen hin immer länger werdende Dornborsten, während das Endglied mit
einer Reihe gleich langer, sehr kurzer aber breiter Haare ausgestattet ist. Bei dem mir zur
Untersuchung überlassenen Individuum ergaben sich folgende Beinlängen:
1. Fuss ='-0,38 mm.
2. Fuss =g|0,54 mm.
3. Fuss == 0,64 mm.
4. Fuss =^,0,75 mm.
G e s c h l e c h t s f e l d : Die Geschlechtsöffnung beginnt in der Tiefe der hintern Epimeral-
bucht und besitzt eine Länge von 0,134 mm. Wie man aus Fig. 17 a, Taf. VIII ersieht, erstrecken
sich die vielnapfigen Genitalplatten von ihrem Innenrande aus schief nach aussen und hinten.
Nach den Angaben Hallers sind sie von unregelmässig kreissegmentförmiger Gestalt mit nach
vorn gerichteter und schräg von innen und oben nach aussen und unten gestellter Sehne. Meine
Abbildung giebt die Verhältnisse so wieder, wie ich sie bei dem mir zur Verfügung stehenden
Objekt feststellen konnte. Die Zahl der Näpfe ist nicht immer die gleiche, doch dürfte gewöhnlich
jede Platte 13—18 Näpfe tragen, unter denen einzelne die ändern an Grösse übertreffen.
M ä n n c h e n :
G r ö s s e : Das einzige, mir zugängliche Individuum hatte eine Länge von 0,544 mm und
eine Breite von 0,416 mm.
G e s t a l t : Der Umriss des Körpers ist oval, im Gegensatz zu Acercus liliaceus Müller<3
nach hinten kaum merkbar zugespitzt. Zwischen den antenniformen Stirnborsten, die 0,1 mm
von einander abstehen, beobachtet man eine mehr oder weniger tiefe Einbuchtung.
A u g e n : Die ziemlich grossen Doppelaugen liegen 0,128 mm von einander entfernt. Ih r
grösster Durchmesser beträgt vom Ende des Pigmentkörpers bis zum Aussenrande der Linse
0,048 mm.
H a u t : Unter der deutlich liniierten Epidermis haben sowohl auf dem Rücken als auf
dem Abdomen Panzerbildungen stattgefunden. Der poröse Rückenpanzer ist ebenfalls oval und
nur wenig kleiner als die Dorsalfläche des Körpers. Die ventrale Panzerung des Abdomens stellt
sich als eine bis zum After reichende Verlängerung der Epimeralplatte dar. Ihre Form und
Abgrenzung ist in Fig. 17 b, Taf. VIII wiederzugeben versucht worden.
P a lp e n : Die Maxillartaster erreichen fast die halbe Körperlänge (0,248 mm). Sie sind
dicker als die Grundglieder des benachbarten ersten Beinpaares. Das ca, 0,096 mm lange zweite
Glied besitzt in der Ventralansicht einen Querdurchmesser von 0,054 mm. In Form und Ausstattung
herrscht, wenn man von einem etwas gedrungenen Bau absieht, im grossen und ganzen
zwischen der männlichen und weiblichen Palpe Übereinstimmung. (Fig. 17 b, Taf. VIII.)
H ü f t p l a t t e n : Wie bei den ändern Acercus-Arten ist beim Männchen das Epimeralgebiet
zu einer einzigen Pla tte verschmolzen. Die einzelnen Hüftplatten sind nach aussen hin mehr oder
weniger deutlich durch verdickte Nähte abgegrenzt, nach innen zu gehen sie aber ohne sichtbare
Abgliederung in ein median gelegenes Sternaistück über. Bezüglich aller Einzelheiten verweise
ich kurzer Hand auf Fig. 17 b, Taf. VIII.
F ü s s e : 1. Fuss = 0,408 mm.
2. Fuss = 0,468 mm.
3. Fuss|gg= 0,572 mm.
4. Fuss — 0,616 mm.
Aus den vorstehenden Massen ersieht man, dass die Fusspaare in ihrer Reihenfolge von
vorne nach hinten stetig an Länge zunehmen, eine Verkürzung der dritten Extremität also sich
nicht feststellen lässt. Der letzte Fuss zeigt auch hier ganz bestimmte, charakteristische Eigenheiten.
Die ersten drei Glieder sind kurz und stämmig gebaut und von gleicher Länge (0,08 mm).
Am vierten, schon etwas längeren Gliede bemerkt man ausser einer Anzahl Haare am äusseren
Ende eine sehr starke und breite und eine schwächere, schräg nach hinten gerichtete Säbelborste.
Das fünfte, 0,112 mm lange Glied ist am distalen Ende stark verbreitert. Glied sechs endlich
h a t eine Form, wie wir sie bei Acercus liliaceus Müller cf angetroffen haben. In Fig. 17 c, Taf. V III
sind die in dem Bestimmungsschlüssel angeführten Charakteristika bildlich wiedergegeben worden.