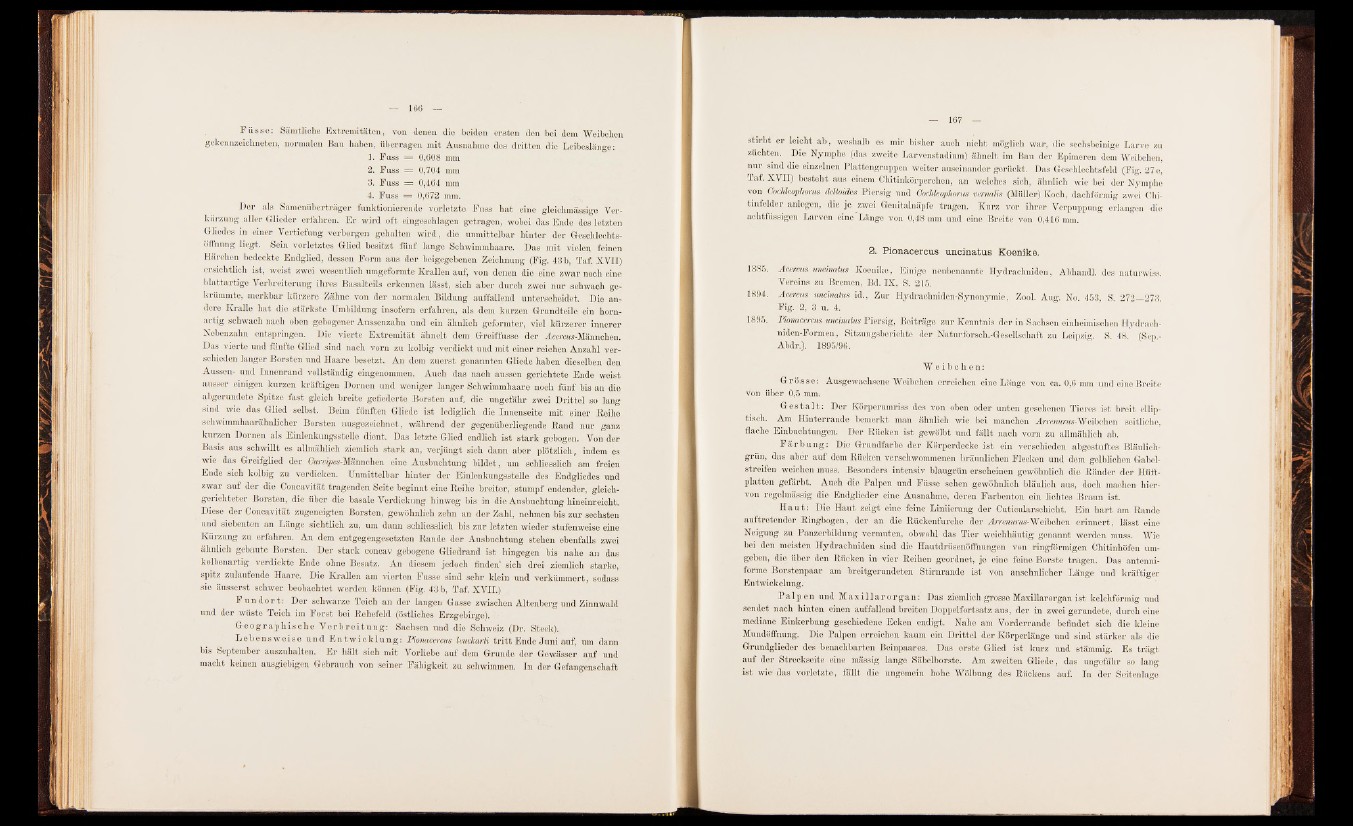
F ü s s e : Sämtliche Extremitäten, von (lenen die beiden- ersten den bei dem Weibchen
gekennzeichneten, normalen Bau haben, überragen mit Ausnahme des dritten die Leibeslänge:
1. Fuss = 0,608 mm
2. Fu^s = 0,704 mm
3. Fuss = 0,464 mm
4. Fuss = 0,672 mm.
Der als Samenüberträger funktionierende vorletzte Fuss h a t eine gleichmässige Verkürzung
aller Glieder erfahren. E r wird oft eingeschlagen getragen, wobei das Ende des letzten
Gliedes in einer Vertiefung verborgen gehalten wird, die unmittelbar hinter der Geschlechtsöffnung
liegt. Sein vorletztes Glied besitzt fünf lange Schwimmhaare. Das mit vielen feinen
Härchen bedeckte Endglied, dessen Form aus der beigegebenen Zeichnung (Fig. 43 b, Taf. XVII)
ersichtlich ist, weist zwei wesentlich umgeformte Krallen auf, von denen die eine zwar noch eine
blattartige Verbreiterung ihres Basalteils erkennen lässt, sich aber durch zwei nur schwach gekrümmte,
merkbar kürzere Zähne von der normalen Bildung auffallend unterscheidet. Die andere
Kralle hat die stärkste Umbildung insofern erfahren, als dem kurzen Grundteile ein hornartig
schwach nach oben gebogener Aussenzahn und ein ähnlich geformter, viel kürzerer innerer
Nebenzahn entspringen. Die vierte Extremität ähnelt dem Greiffusse der Acercws-Männchen.
Das vierte und fünfte Glied sind nach vorn zu kolbig verdickt und mit einer reichen Anzahl verschieden
langer Borsten und Haare besetzt. An dem zuerst genannten Gliede haben dieselben den
Aussen- und Innenrand vollständig eingenommen. Auch das nach aussen gerichtete Ende weist
ausser einigen kurzen kräftigen Dornen und weniger langer Schwimmhaare noch fünf bis an die
abgerundete Spitze fast gleich breite gefiederte Borsten auf, die ungefähr zwei Drittel so lang
sind wie das Glied selbst. Beim fünften Gliede ist lediglich die Innenseite mit einer Beihe
schwimmhaarähnlicher Borsten ausgezeichnet, während der gegenüberliegende Band nur ganz
kurzen Dornen als Einlenkungsstelle dient. Das letzte Glied endlich ist stark gebogen. Von der
Basis aus schwillt es allmählich ziemlich s tark an, verjüngt sich dann aber plötzlich, indem es
wie das Greifglied der CWyipes-Männchen eine Ausbuchtung bildet, um schliesslich am freien
Ende sich kolbig zu verdicken. Unmittelbar hinter der Einlenkungsstelle des Endgliedes und
zwar auf der die Concavität tragenden Seite beginnt eine Beihe breiter,' stumpf endender, gleichgerichteter
Borsten, die über die basale Verdickung hinweg bis in die Ausbuchtung hineinreicht.
Diese der Concavität zugeneigten Borsten, gewöhnlich zehn an der Zahl, np.Timp.ri bis zur sechsten
und siebenten an Länge sichtlich zu, um dann schliesslich bis zur letzten wieder stufenweise eine
Kürzung zu erfahren. An dem entgegengesetzten Bande der Ausbuchtung stehen ebenfalls zwei
ähnlich gebaute Borsten. Der s tark concav gebogene Gliedrand ist hingegen bis nahe an das
kolbenartig verdickte Ende ohne Besatz. An diesem jedoch finden* sich drei ziemlich starke,
spitz zulaufende Haare. Die Krallen am vierten Fusse sind sehr klein und verkümmert, sodass
sie äusserst schwer beobachtet werden können. (Fig. 43 b, Taf. XVII.)
F u n d o r t : Der schwarze Teich an der langen Gasse zwischen Altenberg und Zinnwald
und der wüste Teich im F o rst bei Behefeld (östliches Erzgebirge).
G e o g r a p h i s c h e V e r b r e i t u n g : Sachsen und die Schweiz (Dr. Steck).
L e b e n sw e is e u n d E n tw i c k l u n g : Pionacercus IcucJcarti t r i t t Ende Juni auf, um dann
bis September auszuhalten. E r hält sich mit Vorliebe auf dem Grunde der Gewässer auf und
macht keinen ausgiebigen Gebrauch von seiner Fähigkeit zu schwimmen. In der Gefangenschaft
stirb t er leicht ab, weshalb es mir bisher auch nicht möglich war, die sechsbeinige Larve zu
züchten. Die Nymphe (das zweite Larvenstadium) ähnelt im Bau der Epimeren dem Weibchen,
nur sind die einzelnen Plattengruppen weiter auseinander gerückt. Das Geschlechtsfeld (Fig. 27 e,
Taf. XVII) besteht aus einem Chitinkörperchen, an welches sich, ähnlich wie bei der Nymphe
von Gochlcophorus cMtoides Piersig und Gochlcophorus vernalis (Müller) Koch, dachförmig zwei Chitinfelder
anlegen, die je zwei Genitalnäpfe tragen. Kurz vor ihrer Verpuppung erlangen die
achtfüssigen Larven eine Länge von 0,48 mm und eine Breite von 0,416 mm.
2. Pionacercus uncinatus Koenike.
1885. Acercus uncinatus Koenike, Einige neubenannte Hydrachniden, Abhandl. des naturwiss.
Vereins zu Bremen, Bd. IX, S. 215.
1894. Acercus uncinatus id., Zur Hydrachniden-Synonymie, Zool. Aug. No. 453, S. 272—273.
Fig. 2, 3 u. 4.
1895. Pionacercus uncinatus Piersig, Beiträge zur Kenntnis der in Sachsen einheimischen Hydrachniden
Formen, Sitzungsberichte der Naturforsch.-Gesellschaft zu Leipzig. S. 48. (Sep.-
Abdr.). 1895/96.
W e i b c h e n :
G rö s s e : Ausgewachsene Weibchen erreichen eine Länge von ca. 0,6 mm und eine Breite
von über 0,5 mm.
G e s t a l t : Der Körperumriss des von oben oder unten gesehenen Tieres ist breit elliptisch.
Am Hinterrande bemerkt man ähnlich wie bei manchen Arrenurus-V?eibchen seitliche,
flache Einbuchtungen. Der Bücken ist gewölbt und fällt nach vorn zu allmählich ab.
F ä r b u n g : Die Grundfarbe der Körperdecke is t ein verschieden abgestuftes Bläulichgrün,
das aber auf dem Bücken verschwommenen bräunlichen Flecken und dem gelblichen Gabelstreifen
weichen muss. Besonders intensiv blaugrün erscheinen gewöhnlich die Bänder der Hüft-
platten gefärbt. Auch die Palpen und Füsse sehen gewöhnlich bläulich aus, doch machen hiervon
regelmässig die Endglieder eine Ausnahme, deren Farbenton ein lichtes Braun ist.
H a u t : Die Haut zeigt eine feine Liniierung der Cuticularschicht. Ein h a rt am Bande
auftretender Bingbogen, der an die Bückenfurche der Arrenurus-Weibchen erinnert, lässt eine
Neigung zu Panzerbildung vermuten, obwohl das Tier weichhäutig genannt werden muss. Wie
bei den meisten Hydrachniden sind die Hautdrüsenöffnungen von ringförmigen Ohitinhöfen umgeben,
die über den Bücken in vier Beihen geordnet, je eine feine Borste tragen. Das antenni-
forme Borstenpaar am breitgerundeten Stirnrande ist von ansehnlicher Länge und kräftiger
Entwickelung.
P a lp e n und M a x i l l a r o r g a n : Das ziemlich grosse Maxillarorgan ist kelchförmig und
sendet nach hinten einen auffallend breiten Doppelfortsatz aus, der in zwei gerundete, durch eine
mediane Einkerbung geschiedene Ecken endigt. Nahe am Vorderrande befindet sich die kleine
Mundöffnung. Die Palpen erreichen kaum ein Drittel der Körperlänge und sind stärker als die
Grundglieder des benachbarten Beinpaares. Das erste Glied ist kurz und stämmig. Es träg t
auf der Streckseite eine mässig lange Säbelborste. Am zweiten Gliede, das ungefähr so lang
ist wie' das vorletzte, fällt die ungemein hohe Wölbung des Bückeus auf. In der Seitenlage