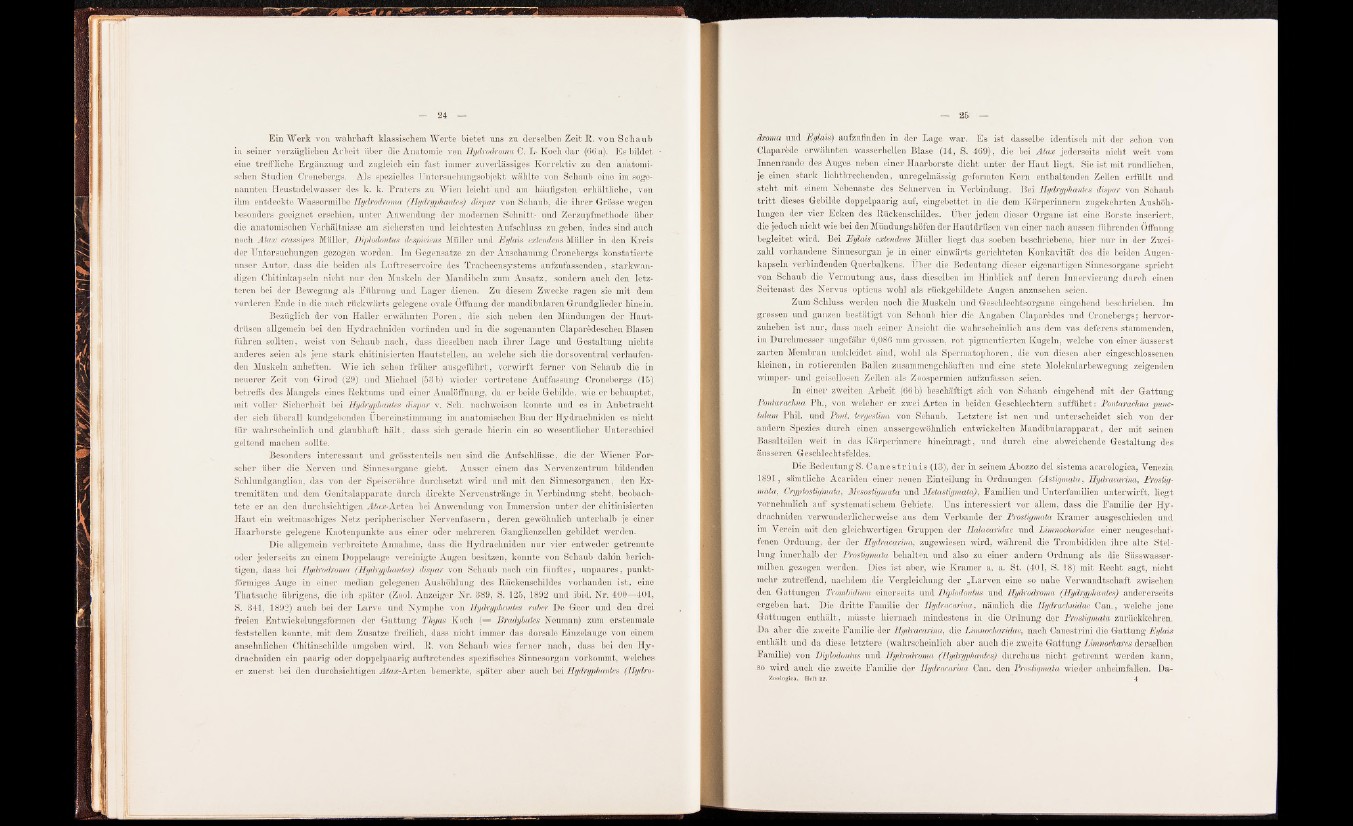
Ein Werk von wahrhaft klassischem Werte bietet uns zu derselben Zeit R. von S ch au b
in seiner vorzüglichen Arbeit über die Anatomie von Hydrodroma C. L- Koch dar (66 a). Es bildet
eine treffliche Ergänzung und zugleich ein fast immer zuverlässiges Korrektiv zu den anatomischen
Studien Cronebergs. Als spezielles Untersuchungsobjekt wählte von Schaub eine im sogenannten
Heustadelwasser des k. k. Praters zu Wien leicht tind am häufigsten erhältliche, von
ihm entdeckte Wassermilbe Hydrodroma (Hydryphantcs) dispar von Schaub, die ihrer Grösse wegen
besonders geeignet erschien, unter Anwendung der modernen Schnitt- und Zerzupfmethode über
die anatomischen Verhältnisse am sichersten und leichtesten Aufschluss zu geben, indes sind auch
noch Atax crassipes Müller, Diplodontus despidens Müller und Eyiais extendens Müller in den Kreis
der Untersuchungen gezogen worden. Im Gegensätze zu der Anschauung Cronebergs konstatierte
unser Autor, dass die beiden als Luftreservoire des Tracheensystems aufzufassenden, starkwan-
digen Chitinkapseln nicht nur den Muskeln der Mandibeln zum Ansatz, sondern auch den letzteren
bei der Bewegung als Führung und Lager dienen. Zu diesem Zwecke ragen sie mit dem
vorderen Ende in die nach rückwärts gelegen« ovale Öffnung der mandibularen Grundglieder hinein.
Bezüglich der von Haller erwähnten Poren, die sich neben den Mündungen der Hautdrüsen
allgemein bei den Hydrachniden vorfinden und in die sogenannten Claparèdeschen Blasen
führen sollten, weist von Schaub nach, dass dieselben nach ihrer Lage und Gestaltung nichts
anderes seien als jene s tark chitinisierten Hautstellen, an welche sich die dorsoventral verlaufenden
Muskeln anheften. Wie ich schon früher ausgeführt, verwirft ferner von Schaub die in
neuerer Zeit von Girod (29) und Michael (53 b) wieder vertretene Auffassung Cronebergs (15)
betreffs des Mangels eines Rektums und einer Analöffnung, da er beide Gebilde, wie er behauptet,
mit voller Sicherheit bei Hydryphantes dispar v. Sch. nachweisen konnte und es in Anbetracht
der sich überall kundgebenden Übereinstimmung im anatomischen Bau der Hydrachniden es nicht
für wahrscheinlich und glaubhaft h ä l t , dass sich gerade hierin ein so wesentlicher Unterschied
geltend machen sollte.
Besonders interessant ünd grösstenteils neu sind die Aufschlüsse, die der Wiener Forscher
über die Nerven und Sinnesorgane giebt. Ausser einem das Nervenzentrum bildenden
Schlundganglion, das von der Speiseröhre durchsetzt wird und mit den Sinnesorganen, den Extremitäten
und dem Genitalapparate durch direkte Nervenstränge in Verbindung steht, beobachtete
er an den durchsichtigen Ate»-Arten bei Anwendung von Immersion unter der chitinisierten
Haut ein weitmaschiges Netz peripherischer Nervenfasern, deren gewöhnlich unterhalb je einer
Haarborste gelegene Knotenpunkte aus einer oder mehreren Ganglienzellen gebildet werden.
Die allgemein verbreitete Annahme, dass die Hydrachniden nur vier entweder getrennte
oder jederseits zu einem Doppelauge vereinigte Augen besitzen, konnte von Schaub dahin berichtigen,
dass bei Hydrodroma (Hydryphantes) dispar von Schaub noch ein fünftes, unpaares, punktförmiges
Auge in einer median gelegenen Aushöhlung des Rückenschildes vorhanden ist, eine
Thatsache übrigens, die ich später (Zool. Anzeiger Nr. 389, S. 125, 1892 und ibid. Nr. 400—401,
S. 341, 1892) auch bei der Larve und Nymphe von Hydryphantes ruber De Geer und den drei
freien Entwickelungsformen der Gattung Thyas Koch ( = Bradybates Neuman) zum erstenmale
feststellen konnte, mit dem Zusatze freilich, dass nicht immer das dorsale Einzelauge von einem
ansehnlichen Chitinschilde umgeben wird. R. von Schaub wies ferner nach, dass bei den Hydrachniden
ein paarig oder doppelpaarig auftretendes spezifisches Sinnesorgan vorkommt, welches
er zuerst bei den durchsichtigen Atax-Arten bemerkte, später aber auch bei Hydryphantes (Hydrodroma
und Eyiais) aufzufinden in der Lage war. Es ist dasselbe identisch mit der schon von
ClaparMe erwähnten wasserhellen Blase (14, S. 469), die bei Atax jederseits nicht weit vom
Innenrande des Auges neben einer Haarborste dicht unter der Haut liegt. Sie ist mit rundlichen,
je einen s tark lichtbrechenden, unregelmässig geformten Kern enthaltenden Zellen erfüllt und
steht mit einem Nebenaste des Sehnerven in Verbindung. Bei Hydryphantes dispar von Schaub
t r i t t dieses Gebilde doppelpaarig auf, eingebettet in die dem Körperinnern zugekehrten Aushöhlungen
der vier Ecken des Rückenschildes. Über jedem dieser Organe is t eine Borste inseriert,
die jedoch nicht wie bei den Mündungshöfen der Hautdrüsen von einer nach aussen führenden Öffnung
begleitet wird. Bei Eyiais extendens Müller liegt das soeben beschriebene, hier nur in der Zweizahl
vorhandene Sinnesorgan je in einer einwärts gerichteten Konkavität des die beiden Augenkapseln
verbindenden Querbalkens. Über die Bedeutung dieser eigenartigen Sinnesorgane spricht
von Schaub die Vermutung aus, dass dieselben im Hinblick auf deren Innervierung durch einen
Seitenast des Nervus opticus wohl als rückgebildete Augen anzusehen seien.
Zum Schluss werden noch die Muskeln und Geschlechtsorgane eingehend beschrieben. Im
grossen und ganzen bestätigt von Schaub hier die Angaben Claparedes und Cronebergs; hervorzuheben
ist nur, dass nach seiner Ansicht die wahrscheinlich aus dem vas deferens stammenden,
im Durchmesser ungefähr 0,086 mm grossen, ro t pigmentierten Kugeln, welche von einer äusserst
zarten Membran umkleidet sind, wohl als Spermatophoren, die von diesen aber eingeschlossenen
kleinen, in rotierenden Ballen zusammengehäuften und eine stete Molekularbewegung zeigenden
wimper- und geisellosen Zellen als Zoospermien aufzufassen seien.
In einer zweiten Arbeit (66 b) beschäftigt sich von Schaub eingehend mit der Gattung
Pontarachna Pk., von welcher er zwei Arten in beiden Geschlechtern aufführt: Pontarachna punc-
tulum Phil, und Pont, tergestina von Schaub. Letztere ist neu und unterscheidet sich von der
ändern Spezies durch einen aussergewöhnlich entwickelten Mandibularapparat, der mit seinen
Basalteilen weit in das Körperinnere hineinragt, und durch eine abweichende Gestaltung des
äusseren Geschlechtsfeldes.
Die Bedeutung S. C a n e s t r i n i s (13), der in seinem Abozzo del sistema acarologica, Venezia
1891, sämtliche Acariden einer neuen Einteilung in Ordnungen (Astigmata, Hydracanna, Prostig-
mata, Gryptostig'mata, Mesostigmata und Metastigmata), Familien und Unterfamilien unterwirft, liegt
vornehmlich auf systematischem Gebiete. Uns interessiert vor allem, dass die Familie der Hydrachniden
verwunderlicherweise aus dem Verbände der Prostigmata Kramer ausgeschieden und
im Verein mit den gleichwertigen Gruppen der Halacaridae und Limnocharidae einer neugeschaffenen
Ordnung, der der Hydracanna, zugewiesen wird, während die Trombididen ihre alte Stellung
innerhalb der Prostigmata behalten und also zu einer ändern Ordnung als die Süsswassermilben
gezogen werden. Dies ist aber, wie Kramer a. a. St. (401, S. 18) mit Recht sagt, nicht
mehr zutreffend, nachdem die Vergleichung der „Larven eine so nahe Verwandtschaft zwischen
den Gattungen Trombidium einerseits und Diplodontus und Hydrodroma (Hydryphantes) andererseits
ergeben hat. Die dritte Familie der Rydracarina, nämlich, die Hydrachnidae Can., welche jene
•Gattungen enthält, müsste hiernach mindestens in die Ordnung der Prostigmata zurückkehren.
Da aber die zweite Familie der Hydracanna, die Limnocharidae, nach Canestrini die Gattung Eyiais
enthält und da diese letztere (wahrscheinlich aber auch die zweite Gattung Limnochares derselben
Familie) von Diplodontus und Hydrodroma (Hydryphantes) durchaus nicht getrennt werden kann,
so wird auch die zweite Familie der Hydracarina Can. den Prostigmata wieder anheimfallen. Da-
Zoologica. lie f t 22. 4