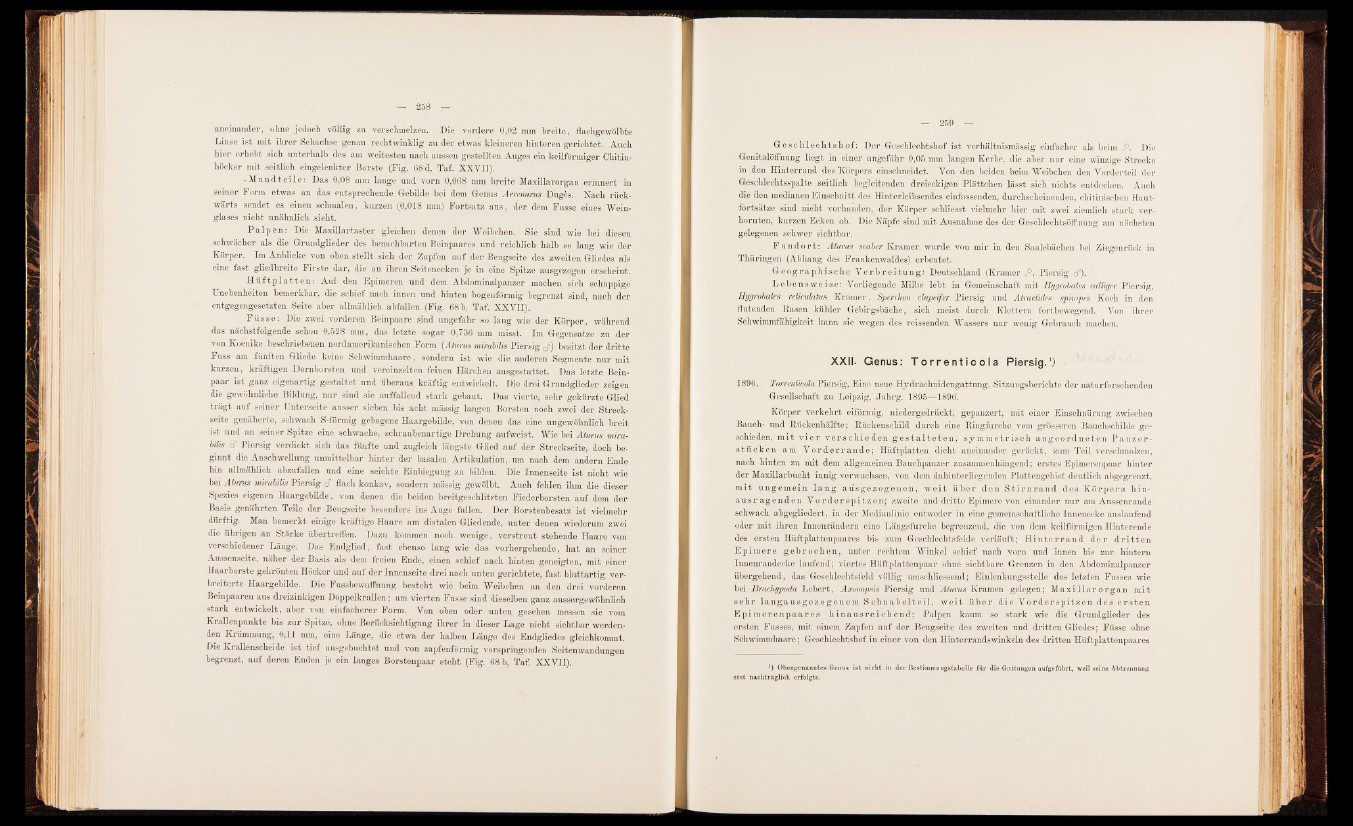
aneinander, ohne jedoch völlig zu verschmelzen. Die vordere 0,02 mm breite, flachgewölbte
Linse ist mit ihrer Sehachse genau rechtwinklig zu der etwas kleineren hinteren gerichtet. Auch
hier erhebt sich unterhalb des am weitesten nach aussen gestellten Auges ein keilförmiger Chitinhöcker
mit seitlich eingelenkter Borste (Fig. 68 d, Taf. XXVII).
• M u n d t e i l e : Das 0,08 mm lange und vorn 0,068 mm breite Maxillarorgan erinnert in
seiner Form etwas an das entsprechende Gebilde bei dem Genus Arrenurus Duges. Nach rückwärts
sendet es einen schmalen, kurzen (0,018 mm) Fortsatz aus, der dem Fusse eines Weinglases
nicht unähnlich sieht.
P a lp e n : Die Maxillartaster gleichen denen der Weibchen. Sie sind wie bei diesen
schwächer als die Grundglieder des benachbarten Beinpaares und reichlich halb so lang wie der
Körper. Im Anblicke von oben stellt sich der Zapfen auf der Beugseite des zweiten Gliedes als
eine fast gliedbreite F irste dar, die an ihren Seitenecken je in eine Spitze ausgezo'gen erscheint.
H ü f t p l a t t e n : Auf den Epimeren und dem Abdominalpanzer machen sich schuppige
Unebenheiten bemerkbar, die schief nach innen und hinten bogenförmig begrenzt sind, nach der
entgegengesetzten Seite aber allmählich abfallen (Fig. 68 b, Taf. XXVII).
F ü s s e : Die zwei vorderen Beinpaare sind ungefähr so lang wie der Körper, während
das nächstfolgende schon 0,528 mm, das letzte sogar 0,736 mm misst. Im Gegensätze zu der
von Koenike beschriebenen nordamerikanischen Form (Aturus mirabilis Piersig tf) besitzt der dritte
Fuss am fünften Gliede keine Schwimmhaare, sondern is t wie die anderen Segmente nur mit
kurzen, kräftigen Dornborsten und vereinzelten feinen Härchen ausgestattet. Das letzte Beinpaar
ist ganz eigenartig gestaltet und überaus kräftig entwickelt. Die drei Grundglieder zeigen
die gewöhnliche Bildung, nur sind sie auffallend stark gebaut. Das vierte,' sehr gekürzte Glied
trä g t auf seiner Unterseite ausser sieben bis acht mässig langen Borsten noch zwei der Streckseite
genäherte, schwach S-förmig gebogene Haargebilde, von denen das eine ungewöhnlich breit
ist und an seiner Spitze eine schwache, schraubenartige Drehung aufweist. Wie bei Aturus mirabilis
cf Piersig verdickt sich das fünfte und zugleich längste Glied auf der Streckseite, doch beginnt
die Anschwellung unmittelbar hinter der basalen Artikulation, um nach dem ändern Ende
hin allmählich abzufallen und eine seichte Einbiegung zu bilden. Die Innenseite ist nicht wie
bei Aturus mirabilis Piersig cf flach konkav, sondern mässig gewölbt. Auch fehlen ihm die dieser
Spezies eigenen Haargebilde, von denen die beiden breitgeschlitzten Fiederborsten auf dem der
Basis genährten Teile der Beugseite besonders ins Auge fallen. Der Borstenbesatz ist vielmehr
dürftig. Man bemerkt einige kräftige Haare am distalen Gliedende, unter denen wiederum zwei
die übrigen an Stärke übertreffen. Dazu kommen noch wenige, verstreut stehende Haare von
verschiedener Länge. Das Endglied, fast ebenso lang wie das vorhergehende, hat an seiner
Aussenseite, näher der Basis als dem freien Ende, einen schief nach hinten geneigten, mit einer
Haarborste gekrönten Höcker und auf der Innenseite drei nach unten gerichtete, fast blattartig verbreiterte
Haargebilde. Die Fussbewaffnung besteht wie beim Weibchen an den drei vorderen
Beinpaaren aus dreizinkigen Doppelkrallen ; am vierten Fusse sind dieselben ganz aussergewöhnlich
stark entwickelt, aber von einfacherer Form. Von oben oder unten gesehen messen sie vom
Krallenpunkte bis zur Spitze, ohne Berücksichtigung ihre r in dieser Lage nicht sichtbar werdenden
Krümmung, 0,11 mm, eine Länge, die etwa der halben Länge des Endgliedes gleichkommt.
Die Krallenscheide ist tief ausgebuchtet und von zapfenförmig vorspringenden Seitenwandungen
begrenzt, auf deren Enden je ein langes Borstenpaar steht (Fig. 68 b, Taf. XXVII).
G e s c h l e c h t s h o f : Der Geschlechtshof ist verhältnismässig einfacher als beim .P. Die
Genitalöffnung liegt in einer ungefähr 0,05 mm langen Kerbe, die aber nur eine winzige Strecke
in den Hinterrand des K örpers einschneidet. Von den beiden beim Weibchen den Vorderteil der
Geschlechtsspalte seitlich begleitenden dreieckigen Plättchen lässt sich nichts entdecken. Auch
die den medianen Einschnitt des Hinterleibsendes einfassenden, durchscheinenden, chitinischen Hautfortsätze
sind nicht vorhanden, der Körper schliesst vielmehr liier mit zwei ziemlich stark verhornten,
kurzen Ecken ab. Die Näpfe sind mit Ausnahme des der Geschlechtsöffnung am nächsten
gelegenen schwer sichtbar.
F u n d o r t : Aturus scaber Kramer wurde von mir in den Saalebächen bei Ziegenrück in
Thüringen (Abhang des Frankenwaldes) erbeutete
G e o g r a p h i s c h e V e r b r e i t u n g : Deutschland (Kramer P r Piersig cf).
L e b e n sw e is e : Vorliegende Milbe lebt in Gemeinschaft mit Hygrobates calliger Piersig,
Hygrobates reticulatus Kramer, Sperchon chipeifer Piersig und Atractides spinipes Koch in den
flutenden Rasen kühler Gebirgsbäche, sich meist durch Klettern fortbewegend. Von ihrer
Schwimmfähigkeit kann sie wegen des reissenden Wassers nur wenig Gebrauch machen.
XXII. Genus: T o r r e n t í c o l a Piersig.') -
1896. Torrentícola Piersig, Eine neue Hydrachnidengattung, Sitzungsberichte der naturforschenden
Gesellschaft zu Leipzig, Jahrg. 1895—1896.
Körper verkehrt eiförmig, niedergedrückt, gepanzert, mit einer Einschnürung zwischen
Bauch- und Rückenhälfte; Rückenschild durch eine Ringfurche vom grösseren Bauchschilde geschieden,
m i t v i e r v e r s c h i e d e n g e s t a l t e t e n , s y m m e t r i s c h a n g e o r d n e t e n P a n z e r s
t ü c k e n am V o r d e r r a n d e ; Hüftplatten dicht aneinander gerückt, zum Teil verschmolzen,
nach hinten zu mit dem allgemeinen Bauchpanzer zusammenhängend; erstes Epimerenpaar hinter
der Maxillarbucht innig verwachsen, von dem dahinterliegenden Plattengebiet deutlich abgegrenzt,
m i t u n g em e in l a n g a ü s g e z o g e n e n , w e i t ü b e r d e n S t i r n r a n d d e s K ö r p e r s h in a
u s r a g e n d e n V o r d e r s p i t z e n ; zweite und dritte Epimere von einander nur am Aussenrande
schwach abgegliedert, in der Medianlinie entweder in eine gemeinschaftliche Innenecke auslaufend
oder mit ihren Innenrändern eine Längsfurche begrenzend, die von dem keilförmigen Hinterende
des ersten Hüftplattenpaares bis zum Geschlechtsfelde verläuft; H i n t e r r a n d d e r d r i t t e n
E p im e r e .g e b ro c h e n , unter rechtem Winkel schief nach vorn und innen bis zur hintern
Innenrandecke laufend; viertes Hüftplattenpaar ohne sichtbare Grenzen in den Abdominalpanzer
übergehend, das Geschlechtsfeld völlig umschliessend; Einlenkungsstelle des letzten Fusses wie
bei Brachypoda Lebert, Axonopsis Piersig und Aturus Kramen gelegen; M a x i l l a r o r g a n m it
s e h r l a n g a u s g e z o g e n em S c h n a b e l t e i l , w e i t ü b e r d ie V o r d e r s p i t z e n d e s e r s t e n
E p im e r e n p a a r es h i n a u s r e i c h e n d ; Palpen kaum so stark wie die Grundglieder des
ersten Eusses, mit einem Zapfen auf der Beugseite des zweiten und dritten Gliedes; Eüsse ohne
Schwimmhaare; Geschlechtshof in einer von den Hinterrandswinkeln des dritten Hüftplattenpaares
*) Obengenanntes Genus ist nicht in der Bestimm ungstabelle für die Gattungen aufgeführt, weil seine Abtrennung
erst nachträglich erfolgte.