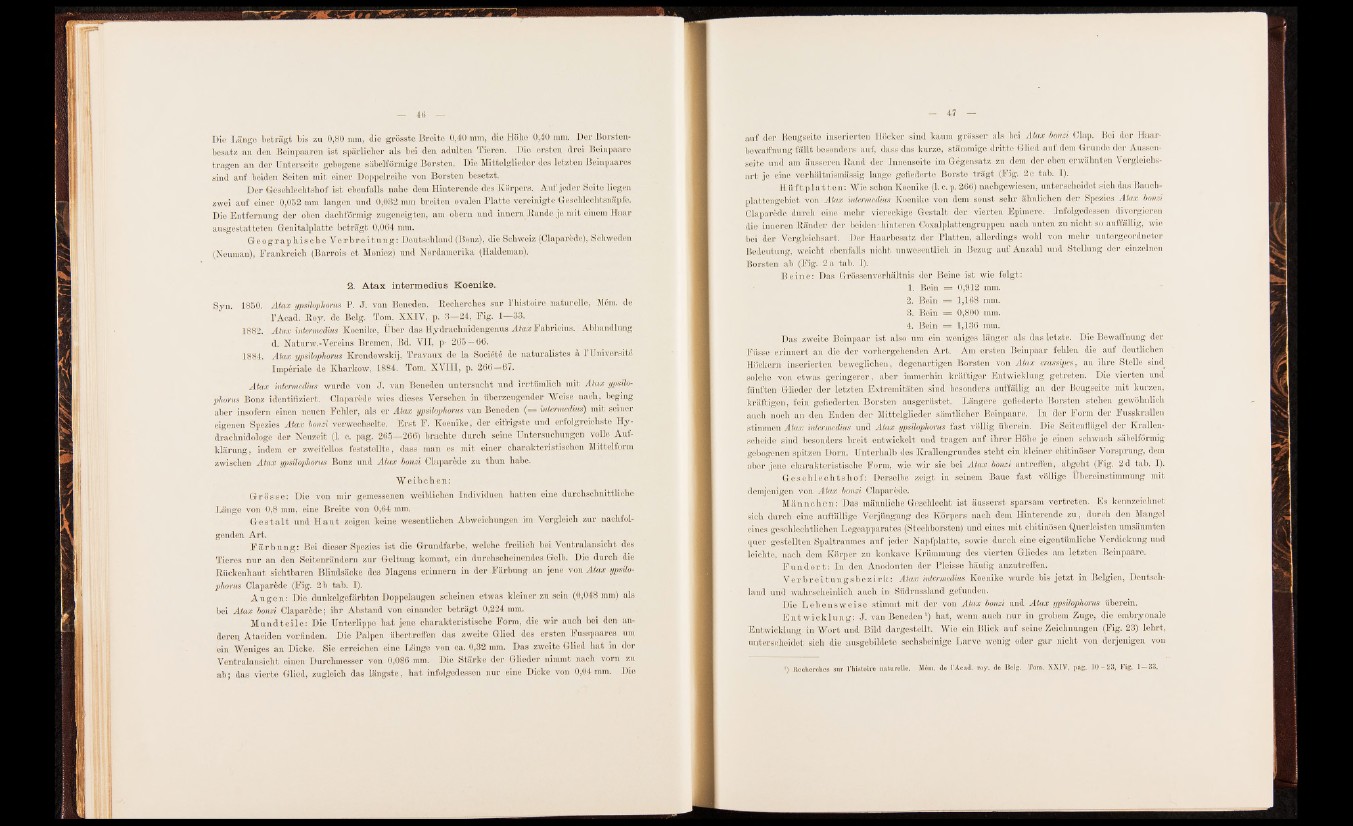
Die Länge beträgt bis zu 0,80 mm, die grösste Breite 0,40 mm, die Höhe 0,40 mm. Der Borstenbesatz
an den Beinpaaren ist spärlicher als bei den adulten Tieren. Die ersten drei Beinpaare
tragen an der Unterseite gebogene säbelförmige Borsten. Die Mittelglieder des letzten Beinpaares
sind auf beiden Seiten mit einer Doppelreihe von Borsten besetzt.
Der Geschlechtshof ist ebenfalls nabe dem Hinterende des Körpers. Auf jeder Seite liegen
zwei auf einer 0,052 mm langen und 0,032 mm breiten ovalen Platte vereinigte Geschlechtsnäpfe.
Die Entfernung der oben dachförmig zugeneigten, am obern und innern Rande je mit einem Haar
ausgestatteten Genitalplatte beträgt 0,064 mm.
G e o g r a p h i s c h e V e r b r e i t u n g : Deutschland (Bonz), die Schweiz (Claparède), Schweden
(Neuman), Frankreich (Barrois et Moniez) und Nordamerika (Haldeman).
2. Atax intermedius Koenike.
Syn. 1850. Atax ypsilophorus P. J. van Beneden. Recherches sur l’histoire naturelle, Mém. de
l’Acad. Roy. de Belg. Tom. XXIV, p. 3—24, Fig. 1—33.
1882. Atax intermedius Koenike, Über das Hydrachnidengenus Atax Fabricius. Abhandlung
d. Naturw.-Vereins Bremen, Bd. VII, p- 265 — 66.
1884. Atax ypsilophorus Krendowskij, Travaux de la Société de naturalistes à l’Université
Impériale de Kharkow, 1884. Tom. XVIII, p. 266—67.
Atax intermedius wurde von J. van Beneden untersucht und irrtümlich mit Atax ypsilophorus
Bonz identifiziert. Claparède wies dieses Versehen in überzeugender Weise nach, beging
aber insofern einen neuen Fehler, als er Atax ypsilophorus van Beneden ( = intermedius) mit seiner
eigenen Spezies Atax bonzi verwechselte. E rst F. Koenike, der eifrigste und erfolgreichste Hy-
drachnidologe der Neuzeit (1. c. pag. 265—266) brachte durch seine Untersuchungen volle Aufklärung,
indem er zweifellos feststellte, dass man es mit einer charakteristischen Mittelform
zwischen Atax ypsilophorus Bonz und Atax bonzi Claparède zu thun habe.
W e ib c h e n :
G rö s s e : Die von mir gemessenen weiblichen Individuen hatten eine durchschnittliche
Länge von 0,8 mm, eine Breite von 0,64 mm.
G e s t a l t und H a u t zeigen keine wesentlichen Abweichungen im Vergleich zur nachfolgenden
Art.
F ä r b u n g : Bei dieser Spezies ist die Grundfarbe, welche freilich hei Ventralansicht des
Tieres nur an den Seitenrändern zur Geltung kommt, ein durchscheinendes Gelb. Die durch die
Rückenhaut sichtbaren Blindsäcke des Magens erinnern in der Färbung an jene von Atax ypsilophorus
Claparède (Fig. 2 b tab. I).
A u g e n : Die dunkelgefärbten Doppelaugen scbeinen etwas kleiner zu sein (0,048 mm) als
bei Atax bonzi Claparède; ihr Abstand von einander beträgt 0,224 mm.
M u n d t e i l e : Die Unterlippe b a t jene cbarakteristische Form, die wir aucb bei den anderen
Ataciden vorfinden. Die Palpen übertreffen das zweite Glied des ersten Fusspaares um
ein Weniges an Dicke. Sie erreicben eine Länge von ca. 0,32 mm. Das zweite Glied b a t in der
Ventralansicht einen Durchmesser von 0,086 mm. Die Stärke der Glieder nimmt nach vorn zu
ab; das vierte Glied, zugleich das längste, h a t infolgedessen nur eine Dicke von 0,04 mm. Die
auf der Beugseite inserierten Höcker sind kaum grösser als bei Atax bonzi Clap. Bei der Haar-
bewaffnung fällt besonders auf, dass das kurze, stämmige dritte Glied auf dem Grunde der Aussen-
seite und am äusseren Rand der Innenseite im Gegensatz zu dem der eben erwähnten Vergleichsa
rt je eine verhältnismässig lange gefiederte Borste trä g t (Fig. 2 c tab. I).
H ü f t p l a t t e n : Wie schon Koenike (1. c. p. 266) nachgewiesen, unterscheidet sich das Bauchplattengebiet
von Atax intermedius Koenike von dem sonst sehr ähnlichen der Spezies Atax bonzi
Claparede durch eine mehr viereckige Gestalt der vierten Epimere. Infolgedessen divergieren
die inneren Ränder der beiden • hinteren Coxalplattengruppen nach unten zu nicht so auffällig, wie
bei der Vergleichsart. Der Haarbesatz der Platten, allerdings wohl von mehr untergeordneter
Bedeutung, weicht ebenfalls nicht unwesentlich in Bezug auf Anzahl und Stellung der einzelnen
Borsten ab (Fig. 2 a tab. I).
B e in e : Das Grössenverhältnis der Beine ist wie folgt:
1. Bein = 0,912 mm.
2. Bein = 1,168 mm.
3. Bein = 0,800 mm.
4. Bein = 1,136 mm.
Das zweite Beinpaar ist also um ein weniges länger als das letzte. Die Bewaffnung der
Fiisse erinnert an die der vorhergehenden Art. Am ersten Beinpaar fehlen die auf deutlichen
Höckern inserierten beweglichen, degenartigen Borsten von Atax crassipes, an ihre Stelle sind^
solche von etwas geringerer, aber immerhin kräftiger Entwicklung getreten. Die vierten und
fünften Glieder der letzten Extremitäten sind besonders auffällig an der Beugseite mit kurzen,
kräftigen, fein gefiederten Borsten ausgerüstet. Längere gefiederte Borsten stehen gewöhnlich
auch noch an den Enden der Mittelglieder sämtlicher Beinpaare. In der Form der Fusskrallen
stimmen Atax intermedius und Atax ypsilophorus fast völlig überein. Die Seitenflügel der Krallenscheide
sind besonders breit entwickelt und tragen auf ihrer Höbe je einen schwach säbelförmig
gebogenen spitzen Dorn. Unterhalb des Krallengrundes stebt ein kleiner cbitinöser Vorsprung, dem
aber jene charakteristische Form, wie wir sie bei Atax bonzi antreffen, abgebt (Fig. 2d tab. I).
G e s c h l e c h t s h o f : Derselbe zeigt in seinem Baue fast völlige Übereinstimmung mit
demjenigen von Atax bonzi Claparede.
M ä n n c h e n : Das männliche Geschlecht ist äusserst sparsam vertreten. Es kennzeichnet
sich durch eine auffällige Verjüngung des Körpers nach dem Hinterende zu, durch den Mangel
eines geschlechtlichen Legeapparates (Stechborsten) und eines mit chitinösen Querleisten umsäumten
quer gestellten Spaltraumes auf jeder Napfplatte, sowie durch eine eigentümliche Verdickung und
leichte, nach dem Körper zu konkave Krümmung des vierten Gliedes am letzten Beinpaare.
F u n d o r t : In den Anodonten der Pleisse häufig anzutreffen.
V e r b r e i t u n g s b e z i r k : Atax intermedius Koenike wurde bis je tz t in Belgien, Deutschland
und wahrscheinlich auch in Südrussland gefunden.
Die L e b e n sw e is e stimmt mit der von Atax bonzi und Atax ypsilophorus überein.
E n tw i c k lu n g : J. van Beneden *) hat, wenn auch nur in grobem Zuge, die embryonale
Entwicklung in Wort und Bild dargestellt. Wie ein Blick auf seine Zeichnungen (Fig. 23) lehrt,
unterscheidet sich die ausgebildete sechsbeinige Larve wenig oder gar nicht von derjenigen von
| Recherches sur l’histoire naturelle. Mém. de l ’Acad. roy. de Belg. Tom, XXIV, pag. 1 0 -2 3 , Fig. 1—33.