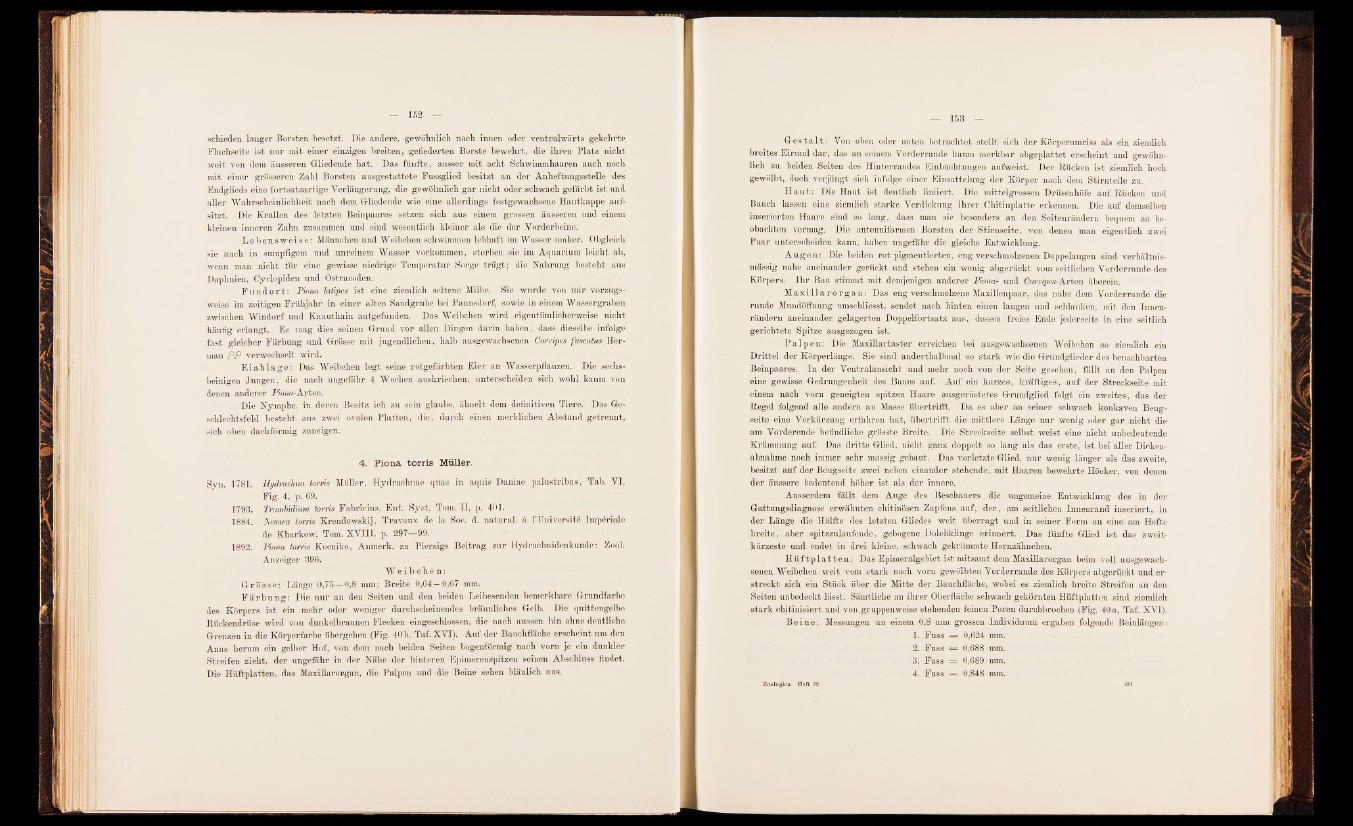
schieden langer Borsten besetzt. Die andere, gewöhnlich nach innen oder ventralwärts gekehrte
Flachseite ist nur mit einer einzigen breiten, gefiederten Borste bewehrt, die ihren Platz nicht
weit von dem äusseren Gliedende hat. Das fünfte, ausser mit acht Schwimmhaaren auch noch
mit einer grösseren Zahl Borsten ausgestattete Fussglied besitzt an der Anheftungsstelle des
Endglieds eine fortsatzartige Verlängerung, die gewöhnlich gar nicht oder schwach gefärbt ist und
aller Wahrscheinlichkeit nach dem Gliedende wie eine allerdings festgewachsene Hautkappe aufsitzt.
Die Krallen des letzten Beinpaares setzen sich aus einem grossen äusseren und einem
kleinen inneren Zahn zusammen und sind wesentlich kleiner als die der Vorderbeine.
L e b e n sw e i s e : Männchen und Weibchen schwimmen lebhaft im Wasser umher. Obgleich
sie auch in sumpfigem und unreinem Wasser Vorkommen, sterben sie im Aquarium leicht ab,
wenn man nicht für eine gewisse niedrige Temperatur Sorge trä g t; die Nahrung besteht aus
Daphnien, Cyelopiden und Ostracoden.
F u n d o r t : Piona latipes is t eine ziemlich seltene Milbe. Sie wurde von mir vorzugsweise
im zeitigen Frühjahr in einer alten Sandgrube bei Paunsdorf, sowie in einem Wassergraben
zwischen Windorf und Knauthain aufgefunden. Das Weibchen wird eigentümlicherweise nicht
häufig erlangt. Es mag dies seinen Grund vor allen Dingen darin haben, dass dieselbe infolge
fast gleicher Färbung und Grösse mit jugendlichen, halb ausgewachsenen Curvipes fuscatus Her-
man P P verwechselt wird.
E i a b l a g e : Das Weibchen legt seine rotgefärbten Eier an Wasserpflanzen. Die sechs-
beinigen Jungen, die nach ungefähr 4 Wochen auskriechen, unterscheiden sich wohl kaum von
denen anderer Piona-Arten.
Die Nymphe, in deren Besitz ich zu sein glaube, ähnelt dem definitiven Tiere. Das Geschlechtsfeld
besteht aus zwei ovalen Platten, die, durch einen merklichen Abstand getrennt,
sich oben dachförmig zuneigen.
4. Piona torris Müller.
Syn. 1781. Hydrachm torris Müller, Hydrachnae qnas in aquis Daniae palustribus, Tab. VI,
Fig. 4, p. 69.
1793. Trombidium torris Fabricius, Ent. Syst. Tom. II, p. 401.
1884. ISIesaea torris Krendowskij, Travaux de la Soc. d. natural, à l’Université Impériale
de Kharkow, Tom. XVTII, p. 297—99.
1892. Piona torris Koenike, Anmerk, zu Piersigs Beitrag zur Hydracbnidenkunde : Zool.
Anzeiger 396.
W e i b e h e n :
G r ö s s e : Länge 0,75—0,8 mm; Breite 0,64 — 0,67 mm.
F ä r b u n g : Die nur an den Seiten und den beiden Leibesenden bemerkbare Grundfarbe
des Körpers is t ein mehr oder weniger durchscheinendes bräunliches Gelb. Die quittengelbe
Rückendrüse wird von dunkelbraunen Flecken eingeschlossen, die nach aussen hin ohne deutliche
Grenzen in die Körperfarbe übergehen (Fig. 40 b, Taf. XVI). Auf der Bauchfläche erscheint um den
Anus herum ein gelber Hof, von dem nach beiden Seiten bogenförmig nach vorn je ein dunkler
Streifen zieht, der ungefähr in der Nähe der hinteren Epimerenäpitzen seinen Abschluss findet.
Die Hüftplatten, das Maxillarorgan, die Palpen und die Beine sehen bläulich aus.
G e s t a l t : Von oben oder unten betrachtet stellt sich der Körperumriss als ein ziemlich
breites Eirund dar, das an seinem Vorderrande kaum merkbar abgeplattet. erscheint und gewöhnlich
zu beiden Seiten des Hinterrandes Einbuchtungen aufweist. Der Rücken ist ziemlich hoch
gewölbt, doch verjüngt sich infolge einer Einsattelung der Körper nach dem Stimteile zu.
H a u t : Die Haut ist deutlich liniiert. Die mittelgrossen Drüsenhöfe auf Rücken und
Bauch lassen eine ziemlich starke Verdickung ihrer Chitinplatte erkennen. Die auf demselben
inserierten Haare sind so lang, dass man sie besonders an den Seitenrändern bequem zu beobachten
vermag. Die antenniformen Borsten der Stirnseite, von denen man eigentlich zwei
Paar unterscheiden kann, haben ungefähr die gleiche Entwicklung.
A u g e n : Die beiden ro t pigmentierten, eng verschmolzenen Doppelangen sind verhältnismässig
nahe aneinander gerückt und stehen ein wenig abgerückt vom seitlichen Vorderrande des
Körpers. Ih r Bau stimmt mit demjenigen anderer Piona- und Cwm^es-Arten überein.
M a x i l l a r o r g a n : Das eng verschmolzene Maxillenpaar, das nahe dem Vorderrande, die
runde Mundöffnung umschliesst, sendet nach hinten einen langen und schlanken, mit den Innenrändern
aneinander gelagerten Doppelfortsatz aus, dessen freies Ende jederseits in eine seitlich
gerichtete Spitze ausgezogen ist.
P a lp e n : Die Maxillartaster erreichen bei ausgewachsenen Weibchen so ziemlich ein
Drittel der Körperlänge. Sie sind anderthalbmal so stark wie die Grundglieder des benachbarten
Beinpaares. In der Ventralansicht und mehr noch von der Seite gesehen, fällt an den Palpen
eine gewisse Gedrungenheit des Baues auf. Auf ein kurzes, kräftiges, auf der Streckseite mit
einem nach vorn geneigten spitzen Haare ausgerüstetes Grundglied folgt ein zweites, das der
Regel folgend alle ändern an Masse übertrifft. Da es aber an seiner schwach konkaven Beugseite
eine Verkürzung erfahren hat, übertrifft die mittlere Länge nur wenig oder gar .nicht die
am Vorderende befindliche grösste Breite. Die Streckseite selbst weist eine nicht unbedeutende
Krümmung auf. Das d ritte Glied, nicht ganz doppelt so lang als das erste, ist bei aller Dioken-
abnahme noch immer sehr massig gebaut. Das vorletzte Glied, nur wenig länger als das zweite,
besitzt auf der Beugseite zwei neben einander stehende, mit Haaren bewehrte Höcker, von denen
der äussere bedeutend höher ist als der innere.
Ausserdem fällt dem Auge des Beschauers . die ungemeine Entwicklung des in der
Gattungsdiagnose erwähnten chitinösen Zapfens auf, der, am seitlichen Innenrand inseriert, in
der Länge die Hälfte des letzten Gliedes weit überragt und in seiner Form an eine am Hefte
breite, aber spitzzulaufende, gebogene Dolchklinge erinnert. Das fünfte Glied ist das zweitkürzeste
und endet in drei kleine, schwach gekrümmte Hornzähnchen.
H ü f t p l a t t e n : Das Epimeralgebiet is t mitsamt dem Maxillarorgan beim voll ausgewachsenen
Weibchen weit vom s tark nach vorn gewölbten.Vorderrande des Körpers abgerückt und erstreckt
sich ein Stück über, die Mitte der. Bauchfläche, wobei es ziemlich breite Streifen an den
Seiten unbedeckt lässt. Sämtliche an ihrer Oberfläche schwach gekörnten Hüftplatten sind ziemlich
stark chitinisiert und v,on gruppenweise stehenden feinen JPoren durchbrochen (Fig. 40 a, Taf. XVI).
B e in e : Messungen an einem 0,8 mm.grossen Individuum ergaben folgende Beinlängen:
1. Fnss =? 0,624 mm.
. . 2. Fuss .=.. 0,688 mm.
. .3. Fuss = 0,689 mm.
4. Fuss = 0,848 mm.
Zoologien. Heft f§ 20