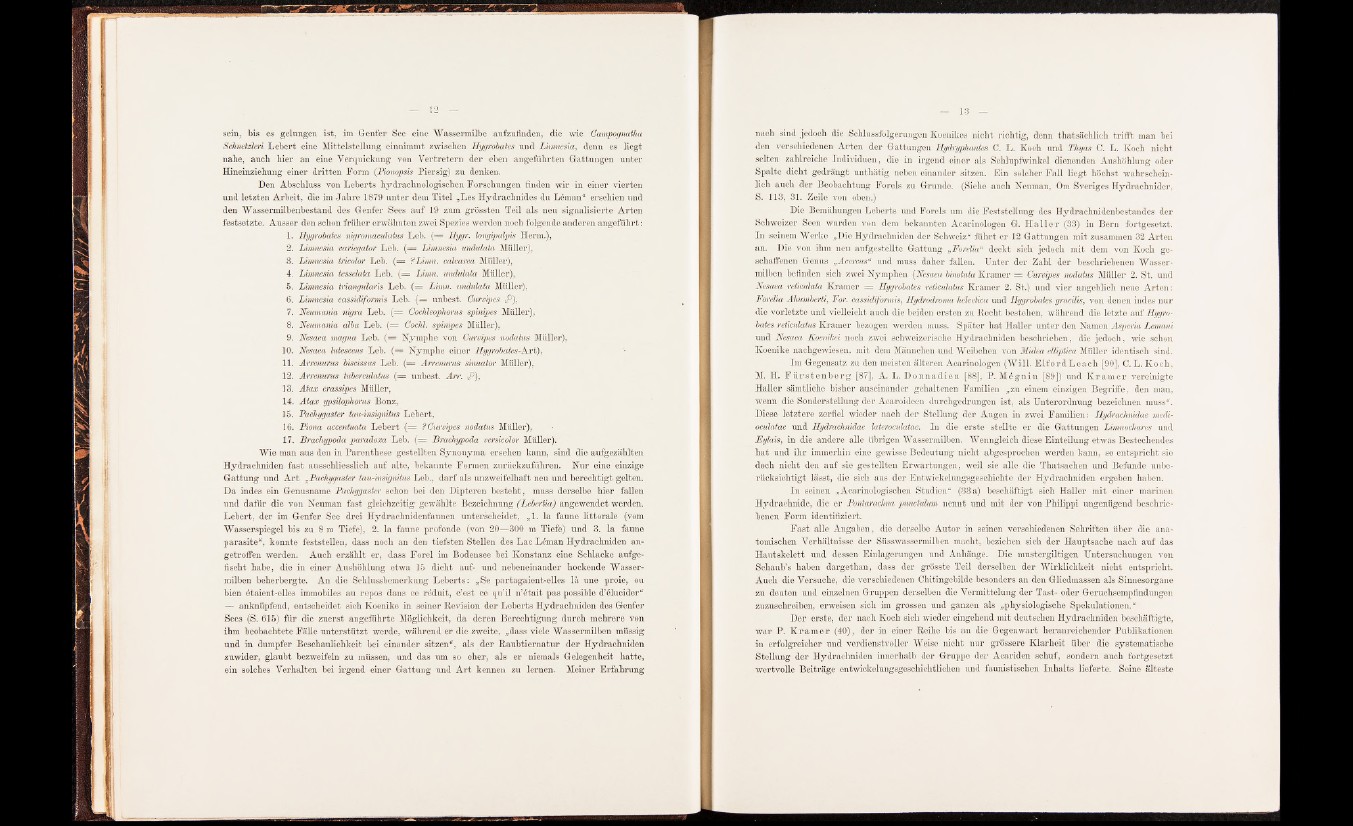
sein, bis es gelungen ist, im Genfer See eine Wassermilbe aufzufinden, die wie Gampognatha
Schneiden Lebert eine Mittelstellung einnimmt zwischen Hygröbates und Limnesia, denn es liegt
nabe, auch hier an eine Verquickung von Vertretern der eben angeführten Gattungen unter
Hineinziehung einer dritten Form (Pionopsis Piersig) zu denken.
Den Abschluss von Leberts hydrachnologischen Forschungen finden wir in einer vierten
und letzten Arbeit, die im Jahre 1879 unter dem Titel „Les Hydra.chnides du Léman“ erschien und
den Wassermilbenbestand des Genfer Sees auf 19 zum grössten Teil als neu signalisierte Arten
festsetzte. Ausser den schon früher erwähnten zwei Spezies werden noch folgende anderen angeführt :
1. Hygröbates nigromaculatus Leb.. (=ÊêHygr. longipalpis Herrn.),
2. Limnesia variegator Leb. f l Limnesia undulata Müller),
3. Limnesia tricolor Leb. | = ?Limn. calcarea Müller),
4. Limnesia tesselata Leb. ( = Limn. undulata Müller),
5. Limnesia triangularis Leb. ( = Limn. undulata Müller),'
6. Limnesia cassidiformis Leb. | = unbest. Gurvipes uP),v •
7. Neumania nigra Leb. ( = Gochleophorus spinipes Müller),
8. Neumania alba Leb. ( = Gochl. spinipes Müller),
9. Nesaea magna Leb. ( = Nymphe von Gurvipes nodatus Müller),
10. Nesaea lutescens Leb. ( = Nymphe einer Hygröbates-Art),
11. Arrenurus bisdssus Leb. ( = Arrenurus sinuator Müller),
12. Arrenurus tuberculatus (== unbest. Arr. P),
13. Atax crassipes Müller,
14. Atax ypsilophorus Bonz,
15. Pachygaster tau-insignitus Lebert,
16. Piona accentuata Lebert | = ? Gurvipes nodatus Müller),
17. JBrachypoda paradoxa Leb. ( = Brachypoda versicolor Müller).
Wie man aus den in Parenthese gestellten Synonyma ersehen kann, sind die aufgezählten
Hydrachniden fast ausschliesslich auf alte, bekannte Formen zurückzuführen. Nur eine einzige
Gattung und A rt Pachygaster tau-insignitus Leb., d arf als unzweifelhaft neu und berechtigt gelten.
Da indes ein Genusname Pachygaster schon bei den Dipteren besteht, muss derselbe hier fallen
und dafür die von Neuman fast gleichzeitig gewählte Bezeichnung (Lebertia) angewendet werden.
Lebert, der im Genfer See drei Hydrachnidenfaunen unterscheidet, „1. la faune littorale (vom
Wasserspiegel bis zu 8 m Tiefe), 2. la faune profonde (von 20—300 m Tiefe) und 3. la faune
parasite“, konnte feststellen, dass noch an den tiefsten Stellen des Lac Léman Hydrachniden angetroffen
werden. Auch erzählt er, dass Forel im Bodensee bei Konstanz eine Schlacke aufgefischt
habe, die in einer Aushöhlung etwa 15 dicht auf- und nebeneinander hockende Wassermilben
beherbergte. An die Schlussbemerkung Leberts: „Se partagaient-elles là une proie, ou
bien étaient-elles immobiles au repos dans ce réduit, c’est ce qu’il n’était pas possible d’élucider“
— anknüpfend, entscheidet sich Koenike in seiner Revision der Leberts Hydrachniden des Genfer
Sees (S. 615) für die zuerst angeführte Möglichkeit, da deren Berechtigung durch mehrere von
ihm beobachtete Fälle unterstützt werde, während er die zweite, „dass viele Wassermilben müssig
und in dumpfer Beschaulichkeit bei einander sitzen“, als der Raubtiernatur der Hydrachniden
zuwider, glaubt bezweifeln zu müssen, und das um so eher, als er niemals Gelegenheit hatte,
ein solches Verhalten bei irgend einer Gattung und A rt kennen zu lernen. Meiner Erfahrung
nach sind jedoch die Schlussfolgerungen Koenikes nicht richtig, denn thatsächlich trifft man bei
den verschiedenen Arten der Gattungen Hydryphantes C. L. Koch und Thyas C. L. Koch nicht
selten zahlreiche Individuen, die in irgend einer als Schlupfwinkel dienenden Aushöhlung oder
Spalte dicht gedrängt unthätig neben einander sitzen. Ein solcher Fall liegt höchst wahrscheinlich
auch der Beobachtung Forels zu Grunde. (Siehe auch Neuman, Om Sveriges Hydrachnider,
S. 113, 31. Zeile von oben.)' ‘
Die Bemühungen Leberts und Forels um die Feststellung des Hydrachnidenbestandes der
Schweizer Seen wurden von dem bekannten Acarinologen G. H a l l e r (33) in Bern fortgesetzt.
In seinem Werke „Die Hydrachniden der Schweiz“ führt er 12 Gattungen mit zusammen 32 Arten
an. Die von ihm neu aufgestellte Gattung „Forelia“ deckt sich jedoch mit dem von Koch geschaffenen
Genus „Acercusu und muss daher fallen. Unter der Zahl der beschriebenen Wassermilben
befinden sich zwei Nymphen {Nesaea binotata Kramer = Ou/rvipes nodatus Müller 2. St. und
Nesaea reticulata Kramer = Hygröbates reüculatus Kramer 2. St.) und vier angeblich neue A rte n :
Forelia Ahumberti, For. cassidiformis, Hyd/rod/roma helvética und Hygröbates gracilis, von denen indes nur
die vorletzte und vielleicht auch die beiden ersten zu Recht bestehen, während die letzte auf Hygro-
bates reüculatus Kramer bezogen werden muss. Später h a t Haller unter den Namen Asperia Lemani
und Nesaea Koenikei noeh zwei schweizerische Hydrachniden beschrieben, die jedoch, wie schon
Koenike nachgewiesen, mit dem Männchen und Weibchen von Midea elliptica Müller identisch sind.
Im Gegensatz zu den meisten älteren Acarinologen (W ill. E i fo rd L e a c h [90], C. L. K och,
M. H. F ü r s t e n b e r g [87], A. L. D o n n a d ie u [88], P. M é g n in [89]) und K r a m e r vereinigte
Haller sämtliche bisher auseinander gehaltenen Familien „zu einem einzigen Begriffe, den man,
wenn die Sonderstellung der Acaroideen durchgedrungen ist, als Unterordnung bezeichnen muss“.
Diese letztere zerfiel wieder nach der Stellung der Augen in zwei Familien: Hydrachnidae medi-
oculatae und Hydrachnidae laterociäatae. In die erste stellte er die Gattungen Limnochares und
Eylais, in die andere alle übrigen Wassermilben. Wenngleich diese Einteilung etwas Bestechendes
h a t und ih r immerhin eine gewisse Bedeutung nicht abgesprochen werden kann, so entspricht sie
doch nicht den auf sie gestellten Erwartungen, weil sie alle die Thatsachen und Befunde unberücksichtigt
lässt, die sich aus der Entwickelungsgeschichte der Hydrachniden ergeben haben.
In seinen „Acarinologischen Studien“ (33 a) beschäftigt sich Haller mit einer marinen
Hydrachnide, die er Pontarachna punctulum nennt und mit der von Philippi ungenügend beschriebenen
Form identifiziert.
F a st alle Angaben, die derselbe Autor in seinen verschiedenen Schriften über die anatomischen
Verhältnisse der Süsswassermilben macht, beziehen sich der Hauptsache nach auf das
Hautskelett und dessen Einlagerungen und. Anhänge. Die mustergültigen Untersuchungen von
Schaub’s haben dargethan, dass der grösste Teil derselben der Wirklichkeit nicht entspricht.
Auch die Versuche, die verschiedenen Chitingebilde besonders an den Gliedmassen als Sinnesorgane
zu deuten und einzelnen Gruppen derselben die Vermittelung der Tast- oder Geruchsempfindungen
zuzuschreiben, erweisen sich im grossen und ganzen als „physiologische Spekulationen.“
Der erste, der nach Koch sich wieder eingehend mit deutschen Hydrachniden beschäftigte,
war P. K r am e r (40), der in einer Reihe bis an die Gegenwart heranreichender Publikationen
in erfolgreicher und verdienstvoller Weise nicht nur grössere Klarheit über die systematische
Stellung der Hydrachniden innerhalb der Gruppe der Acariden schuf, sondern auch fortgesetzt
wertvolle Beiträge entwickelungsgeschichtlichen und faunistischen Inhalts lieferte. Seine älteste