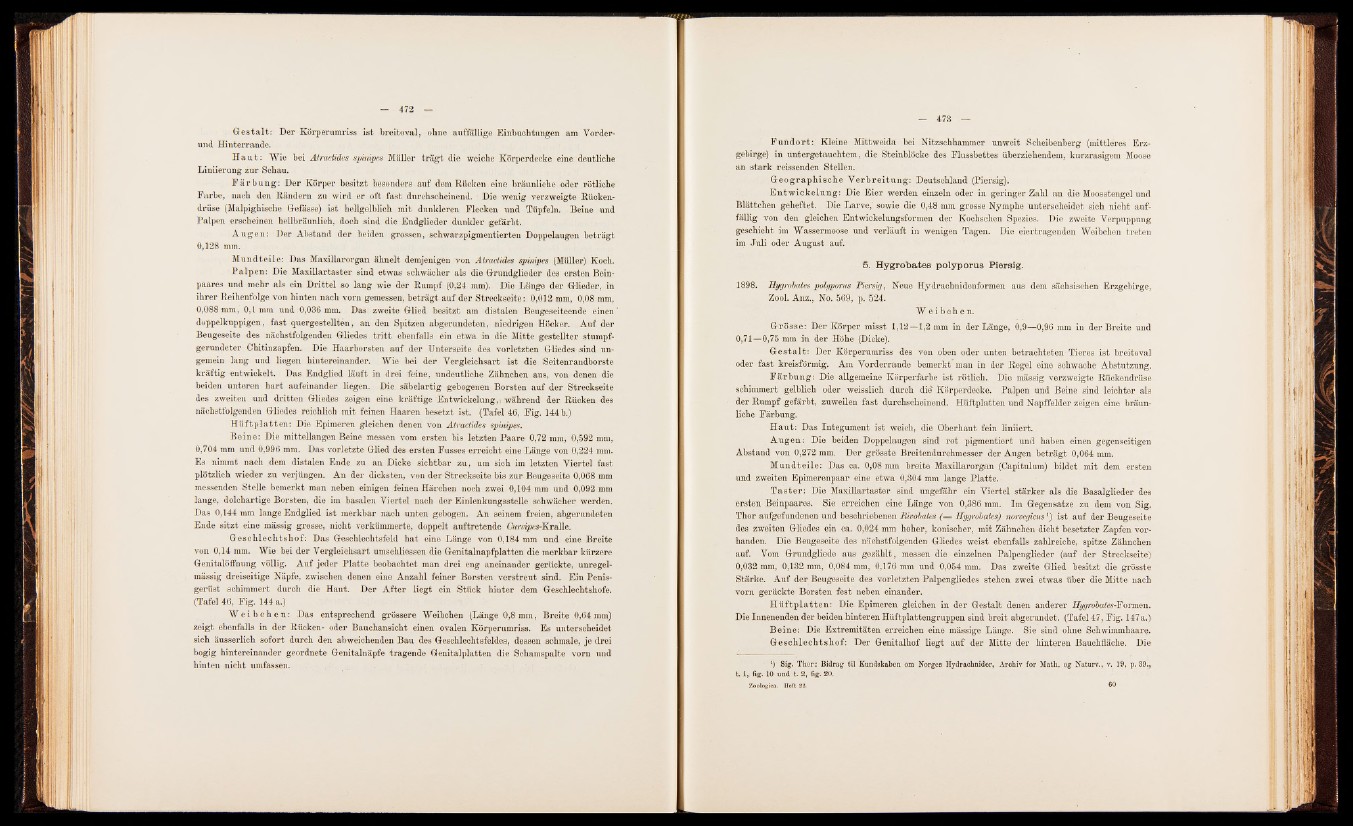
G e s ta lt: Der Körperumriss ist breitoval, ohne auffällige Einbuchtungen am Vorder-
und Hinterrande.
H a u t : Wie bei Atractides spinipes Müller trä g t die weiche Körperdecke eine deutliche
Liniierung zur Schau.
F ä r b u n g : Der Körper besitzt besonders auf dem Rücken eine bräunliche oder rötliche
Farbe, nach den Rändern zu wird er oft fast durchscheinend. Die wenig verzweigte Rückendrüse
(Malpighische Gefässe) ist hellgelblich mit dunkleren Flecken und Tüpfeln. Beine und
Palpen erscheinen hellbräunlich, doch sind die Endglieder dunkler gefärbt.
A u g e n : Der Abstand der beiden grossen, schwarzpigmentierten Doppelaugen beträgt
0,128 mm.
M u n d te ile : Das Maxillarorgan ähnelt demjenigen von Atractides spinipes (Müller) Koch.
P a lp e n : Die Maxillartaster sind etwas schwächer als die Grundglieder des ersten Beinpaares
und mehr als ein Drittel so lang wie der Rumpf (0,24 mm). Die Länge der Glieder, in
ihre r Reihenfolge von hinten nach vorn gemessen, beträgt auf d er Streckseite: 0,012 mm, 0,08 mm,
0,088 mm, 0,1 mm und 0,036 mm. Das zweite Glied besitzt am distalen Beugeseiteende einen
doppelkuppigen, fast quergestellten, an den Spitzen abgerundeten, niedrigen Höcker. Auf der
Beugeseite des nächstfolgenden Gliedes t r i t t ebenfalls ein etwa in die Mitte gestellter stumpfgerundeter
Chitinzapfen. Die Haarborsten auf der Unterseite des vorletzten Gliedes sind ungemein
lang und liegen hintereinander. Wie bei der Vergleichsart ist die Seitenrandborste
kräftig entwickelt. Das Endglied läuft in drei feine, undeutliche Zähnchen aus, von denen die
beiden unteren h a rt aufeinander liegen. Die säbelartig gebogenen Borsten auf der Streckseite
des zweiten und dritten Gliedes zeigen eine kräftige Entwickelung,) während der Rücken des
nächstfolgenden Gliedes reichlich mit feinen Haaren besetzt ist. (Tafel 46, Fig. 144 b.)
H ü f tp la tte n : Die Epimeren gleichen denen von Atractides spinipes.
B ein e: Die mittellangen Beine messen vom ersten bis letzten Paare 0,72 mm, 0,592 mm,
0,704 mm und 0,996 mm. Das vorletzte Glied des ersten Fusses erreicht eine Länge von 0,224 mm.
Es nimmt nach dem distalen Ende zu an Dicke sichtbar zu, um sich im letzten Viertel fast
plötzlich wieder zu verjüngen. An der dicksten, von der Streckseite bis zur Beugeseite 0,068 mm
messenden Stelle bemerkt man neben einigen feinen Härchen noch zwei 0,104 mm und 0,092 mm
lange, dolchartige Borsten, die im basalen Viertel nach der Einlenkungsstelle schwächer werden.
Das 0,144 mm lange Endglied is t merkbar nach unten gebogen. An seinem freien, abgerundeten
Ende sitzt eine mässig grosse, nicht verkümmerte, doppelt auftretende CWircpes-Kralle.
G e s c h le c h tsh o f: Das Geschlechtsfeld hat eine Länge von 0,184 mm und eine Breite
von 0,14 mm. Wie bei der Vergleichsart umschliessen die Genitalnapfplatten die merkbar kürzere
Genitalöffnung völlig. Auf jeder Pla tte beobachtet man drei eng aneinander gerückte, unregelmässig
dreiseitige Näpfe, zwischen denen eine Anzahl feiner Borsten verstreut sind. Ein Penisgerüst
schimmert durch die Haut. Der After liegt ein Stück hinter dem Geschlechtshofe.
(Tafel 46, Fig. 144 a.)
W e i b c h e n : Das entsprechend grössere Weibchen (Länge 0,8 mm, Breite 0,64 mm)
zeigt ebenfalls in der Rücken- oder Bauchansicht einen ovalen Körperumriss. Es unterscheidet
sich äusserlich sofort durch den abweichenden Bau des Geschlechtsfeldes, dessen schmale, je drei
bogig hintereinander geordnete Genitalnäpfe tragende Genitalplatten die Schamspalte vorn und
hinten nicht umfassen.
F u n d o r t: Kleine Mittweida bei Nitzschhammer unweit Scheibenberg (mittleres Erzgebirge)
in üntergetauchtem, die Steinblöcke des Flussbettes überziehendem, kurzrasigem Moose
an s tark reissenden Stellen.
G e o g ra p h is c h e V e rb r e itu n g : Deutschland (Piersig).
E n tw ic k e lu n g : Die Eier werden einzeln oder in geringer Zahl an die Moosstengel und
Blättchen geheftet. Die Larve,' sowie die 0,48 mm grosse Nymphe unterscheidet sich nicht auffällig
von den gleichen Entwickelungsformen der Kochschen Spezies. Die zweite Verpuppung
geschieht im Wassermoose und verläuft in wenigen Tagen. Die eiertragenden Weibchen treten
im Juli oder August auf.
5. Hygrobates polyporus Piersig.
1898. Hygrobates polyporus Piersig, Neue Hydrachnidenformen aus dem sächsischen Erzgebirge,
Zool. Anz., No. 569, p. 524.
W e i b ch e n.
Grö sse : Der Körper misst 1,12—1,2 mm in der Länge, 0,9—0,96 mm in der Breite und
0,71—0,75 mm in der Höhe (Dicke).
G e s ta lt: Der Körperumriss des von oben oder unten betrachteten Tieres ist breitoval
oder fast kreisförmig. Am Vorderrande bemerkt’man in der Regel eine schwache Abstutzung.
F ä rb u n g : Die allgemeine Körperfarbe is t rötlich. Die mässig verzweigte Rückendrüse
schimmert gelblich oder weisslich durch die Körperdecke. Palpen und Beine sind leichter als
der Rumpf gefärbt, zuweilen fast durchscheinend. Hüftplatten und Napffelder zeigen eine bräunliche
Färbung.
H a u t: Das Integument ist weich, die Oberhaut fein liniiert.
Augen: Die beiden Doppelaugen sind ro t pigmentiert und haben einen gegenseitigen
Abstand von 0,272 mm. Der grösste Breitendurchmesser der Augen beträgt 0,064 mm.
M u n d te ile : Das ca. 0,08 mm breite Maxillarorgan (Capitulum) bildet mit dem ersten
und zweiten Epimerenpaar eine etwa 0,304 mm lange Platte.
T a s te r : Die Maxillartaster sind ungefähr ein Viertel stärker als die Basalglieder des
ersten Beinpaares. Sie erreichen eine Länge von 0,386 mm. Im Gegensätze zu dem von Sig.
Thor aufgefundenen und beschriebenen Rivobates (— Hygrobates) norvegicus1) ist auf der Beugeseite
des zweiten Gliedes ein ca. 0,024 mm hoher, konischer, mit Zähnchen dicht besetzter Zapfen vorhanden.
Die Beugeseite des nächstfolgenden Gliedes weist ebenfalls zahlreiche, spitze Zähnchen
auf. Vom Grundgliede aus gezählt, messen die einzelnen Palpenglieder (auf der Streckseite)
0,032 mm, 0,132 mm, 0,084 mm, 0,176 mm und 0,054 mm. Das zweite Glied besitzt die grösste
Stärke. Auf der Beugeseite des vorletzten Palpengliedes stehen zwei etwas über die Mitte nach
vorn gerückte Borsten fest neben einander.
H ü f tp la tte n : Die Epimeren gleichen in der Gestalt denen anderer Hygrobates-Formen.
Die Innenenden der beiden hinteren Hüftplattengruppen sind breit abgerundet. (Tafel 47, Fig. 147 a.)
Beine: Die Extremitäten erreichen eine mässige Länge. Sie sind ohne Schwimmhaare.
G e s c h le ch tsh o f: Der Genitalhof liegt auf der Mitte der hinteren Bauchfläche. Die
• *)' Sig. T h o r: Bidrag til Kundskaben ora Norges Hydrachnider, Archiv for Math, og Naturv., v. 19, p. 39.,
1 . 1, fig. 10 und t. 2, fig. 20.