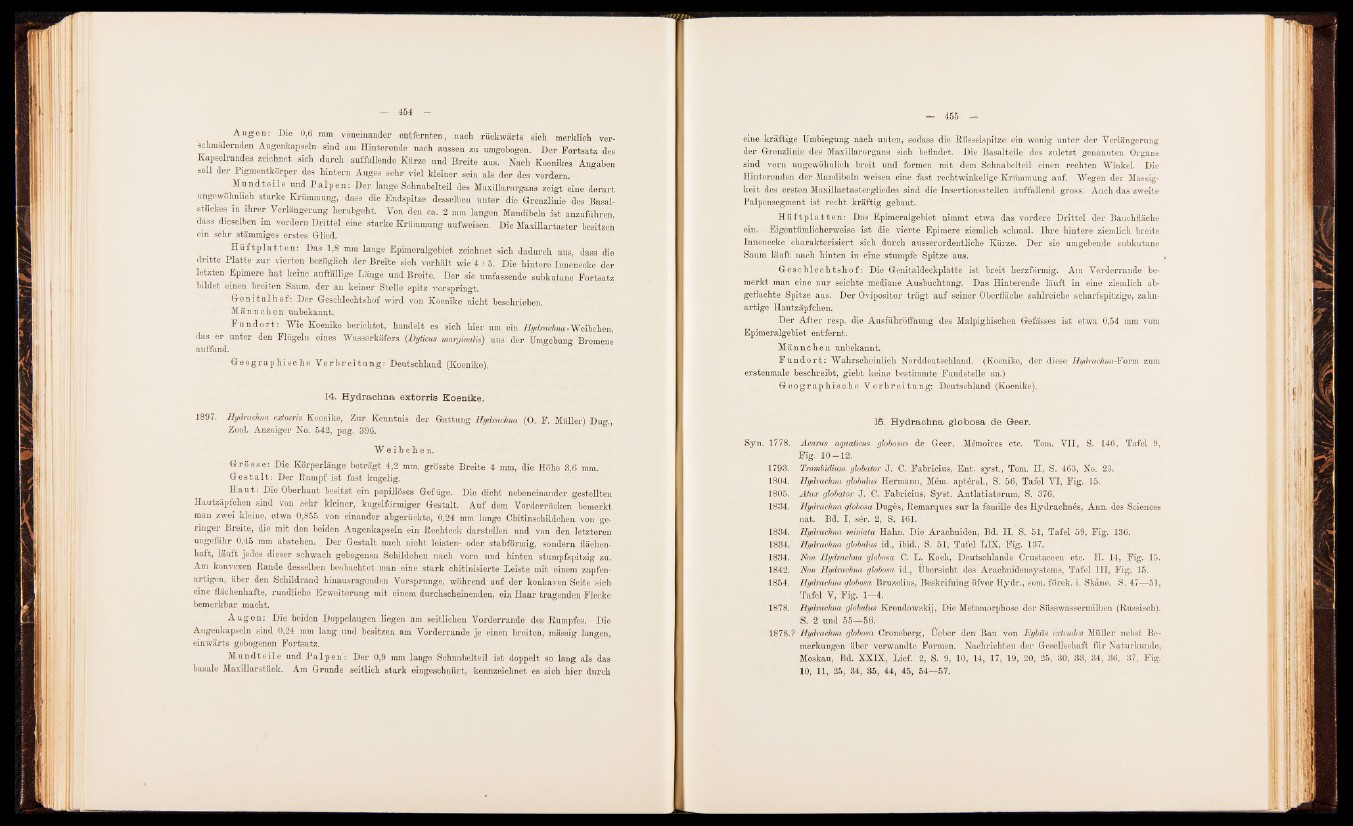
A u g e n : Die 0,6 mm voneinander entfernten, nach rückwärts sich merklich ver-
schmälernden Angenkapseln sind am Hinterende nach aussen zu umgebogen. Der Fortsatz des
Kapselrandes zeichnet sich durch auffallende Kürze und Breite aus. Nach Koenikes Angaben
soll der Pigmentkörper des hintern Auges sehr viel kleiner sein als der des vordem.
M u n d t e i l e und P a lp e n : Der lange Schnabelteil des Maxillarorgans zeigt eine derart
ungewöhnlich starke Krümmung, dass die Endspitze desselben unter die Grenzlinie des Basalstückes
in ihrer Verlängerung herabgeht. Von den ca. 2 mm langen Mandibeln ist anzuführen,
dass dieselben im vordem Drittel eine starke Krümmung aufweisen. Die MaxiHartaster besitzen
ein sehr stämmiges erstes Glied.
H ü f t p l a t t e n : Das 1,8 mm lange Epimerälgebiet zeichnet sich dadurch aus, dass die
dritte P la tte zur vierten bezüglich der Breite sich verhält wie 4 : 5. Die hintere Innenecke der
letzten Epimere h a t keine auffällige Länge und Breite. Der sie umfassende subkutane Fortsatz
bildet einen breiten Saum, der an keiner Stelle spitz vorspringt.
G e n i t a lh o f : Der Geschlechtshof wird von Koenike nicht beschrieben” '
M ä n n c h e n unbekannt.
F u n d o r t : Wie Koenike berichtet, handelt es sich hier um ein Hydrachna-Weibchen,
das er unter den Flügeln eines Wasserkäfers (Eytieus numjmalis) aus der Umgebung Bremens
auffand.
G e o g r a p h i s c h e V e r b r e i t u n g : Deutschland (Koenike).
14. Hydrachna extorris Koenike.
1897. Hydrachna extorris Koenike, Zur Kenntnis der Gattung Hydrachna (0. F. Müller) Dug.,
Zool. Anzeiger No. 542, pag. 396.
W e i b c h e n .
G r ö s s e : Die Körperlänge beträgt 4,2 mm, grösste Breite 4 mm, die Höhe 8$ m m .
G e s t a l t : Der Rumpf ist fast kugelig.
H a u t : Die Oberhaut besitzt ein papillöses Gefüge. Die dicht nebeneinander gestellten
Hautzäpfchen sind von sehr kleiner, kugelförmiger Gestalt. Auf dem Vorderrücken bemerkt
man zwei kleine, etwa 0,855 von einander abgerückte, 0,24 mm lange Chitinschildchen von ge-
linger Breite, die mit den beiden Augenkapseln ein Rechteck darstellen und von den letzteren
ungefähr 0,45 mm abstehen. Der Gestalt nach nicht leisten- oder stabförmig, sondern flächenhaft,
läuft jedes dieser schwach gebogenen Schildchen nach vorn und hinten stumpfspitzig zu.
Am konvexen Rande desselben beobachtet man eine s tark chitinisierte Leiste mit einem zapfenartigen,
über den Schildrand hinausragenden Vorsprunge, während auf der konkaven Seite sich
eine flächenhafte, rundliche Erweiterung mit einem durchscheinenden, ein Haar tragenden Flecke
bemerkbar macht.
A u g e n : Die beiden Doppelaugen liegen am seitlichen Vorderrande des Rumpfes. Die
Augenkapseln sind 0,24 mm lang und besitzen am Vorderrande je einen breiten, mässig langen,
einwärts gebogenen Fortsatz.
M u n d t e i l e und P a lp e n ’: Der 0,9 mm lange Schnabelteil is t doppelt so lang als das
basale Maxillarstück. Am Grunde seitlich stark eingeschnürt, kennzeichnet es sich hier durch
eine kräftige Umbiegung nach unten, sodass die Rüsselspitze ein wenig unter der Verlängerung
der Grenzlinie des Maxillarorgans sich befindet. Die Basalteile des zuletzt genannten Organs
sind vorn ungewöhnlich breit und formen mit dem Schnabelteil einen rechten Winkel. Die
Hinterenden der Mandibeln weisen eine fast rechtwinkelige Krümmung auf. Wegen der Massigkeit
des ersten Maxillartastergliedes sind die Insertionsstellen auffallend gross. Auch das zweite
Palpensegment ist recht kräftig gebaut.
H ü f t p l a t t e n : Das Epimeralgebiet nimmt etwa das vordere Drittel der Bauchfläche
ein. Eigentümlicherweise is t die vierte Epimere ziemlich schmal. Ihre hintere ziemlich breite
Innenecke charakterisiert sich durch ausserordentliche Kürze. Der sie umgebende subkutane
Saum läuft nach hinten in eine stumpfe Spitze aus.
G e s c h l e c h t s h o f : Die Genitaldeckplatte ist breit herzförmig. Am Vorderrande bemerkt
man eine nur seichte mediane Ausbuchtung. Das Hinterende läuft in eine ziemlich abgeflachte
Spitze aus. Der Ovipositor trä g t auf seiner Oberfläche zahlreiche scharfspitzige, zahnartige
Hautzäpfchen.
Der After resp. die AusführöfPnung des Malpighischen Gefässes ist etwa 0,54 mm vom
Epimeralgebiet entfernt.
M ä n n c h e n unbekannt.
F u n d o r t : Wahrscheinlich Norddeutschland. (Koenike, der diese Hydrachna-Form zum
erstenmale beschreibt, giebt keine bestimmte Fundstelle an.)
G e o g r a p h i s c h e V e r b r e i t u n g : Deutschland (Koenike).
15. Hydrachna globosa de Geer.
Syn. 1778. Acarus aquaticus globosus de Geer, Mémoires etc. Tom. VII, S. 146, Tafel 9,
Fig. 1 0 -1 2 .
1793. Trombidium globator J. C. Fabricius, Ent. syst., Tom. II, S. 463, No. 23.
1804. Hydrachna glöbulus Hermann, Mém. aptérol., S. 56, Tafel VI, Fig. 15.
1805. Atax globator J. C. Fabricius, Syst. Antlatiatorum, S. 376.
1834. Hydrachna globosa Dugès, Remarques sur la famille des Hydrachnés, Ann. des Sciences
nat. Bd. I, sér. 2, S. 161.
1834. Hydrachna miniata Hahn, Die Arachniden, Bd. II, S. 51, Tafel 59, Fig. 136.
1834. Hydrachna globulus id., ibid., S. 51, Tafel LIX, Fig. 137.
1834. Non Hydrachna globosa C. L. Koch, Deutschlands Crustaceen etc. H. 14, Fig. 15.
1842. Non Hydrachna globosa id., Übersicht des Arachnidensystems, Tafel III, Fig. 15.
1854. Hydrachna globosa Bruzelius, Beskrifning öfver Hydr., som. förek. i. Skâne. S. 47—51,
Tafel V, Fig. 1 -4 .
1878. Hydrachna globulus Krendowskij, Die Metamorphose der Süsswassermilben (Russisch).
S. 2 und 55—56.
1878.? Hydrachna globosa Croneberg, Üeber den Bau von Eylais extendes Müller nebst Bemerkungen
über verwandte Formen. Nachrichten der Gesellschaft für Naturkunde,
Moskau, Bd. XXIX, Lief. 2, S. 9, 10, 14, 17, 19, 20, 25, 30, 33, 34, 36, 37, Fig.
10, 11, 25, 34, 35, 44, 45, 54—57.