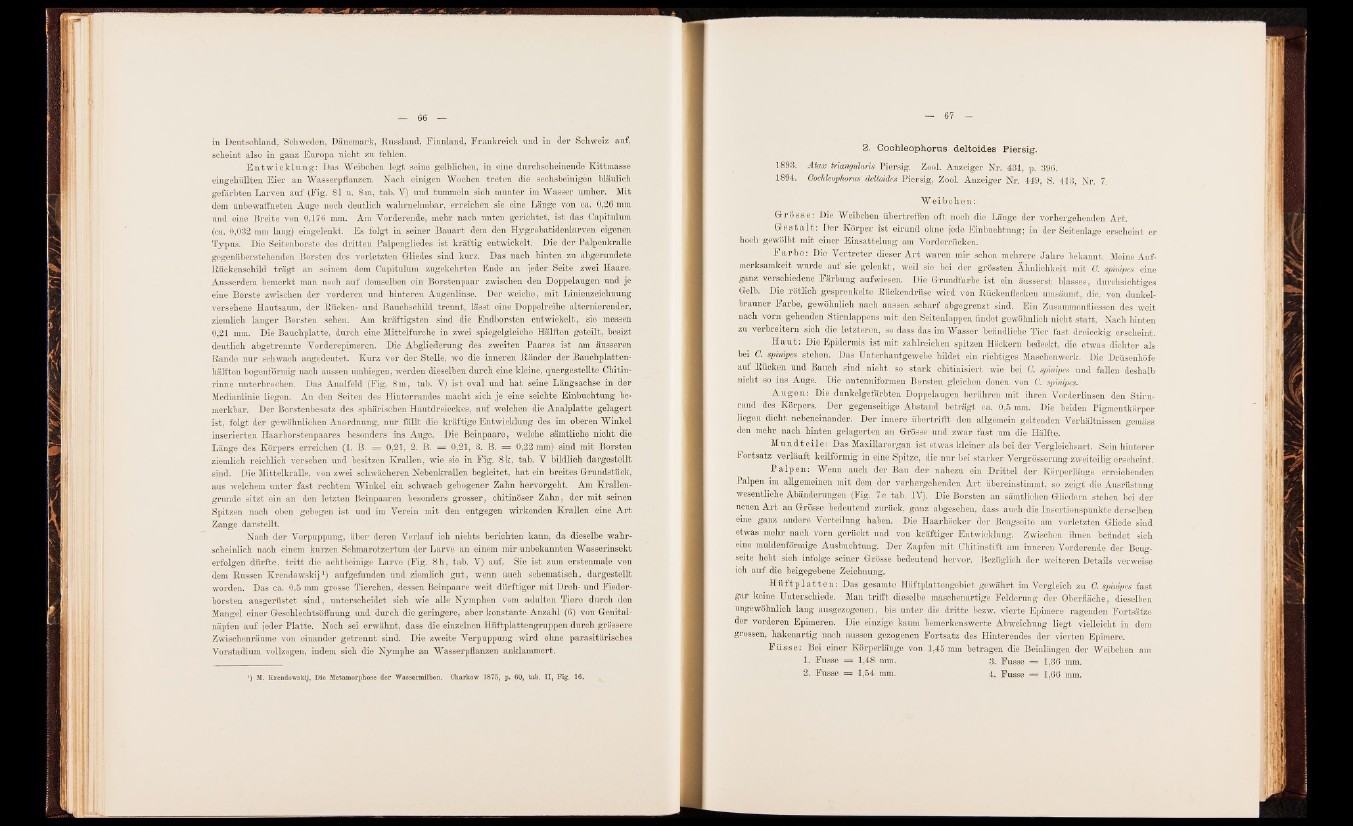
in Deutschland, Schweden, Dänemark, Russland, Finnland, Frankreich und in der Schweiz auf,
scheint also in ganz Europa nicht zu fehlen.
E n tw i c k lu n g : Das Weibchen legt seine gelblichen, in eine durchscheinende Kittmasse
eingehüllten Eier an Wasserpflanzen. Nach einigen Wochen treten die sechsbeinigen bläulich
gefärbten L arven auf (Fig. 81 u. 8 m, tab. V) und tummeln sich munter im Wasser umher. Mit
dem unbewaffneten Auge noch deutlich wahrnehmbar, erreichen sie eine Länge von ca. 0,26 mm
und eine Breite von 0,176 mm. Am Vorderende, mehr nach unten gerichtet, ist das Capitulum
(ca. 0,032 mm lang) eingelenkti ■ Es folgt in seiner Bauart dem den Hygrobatidenlarven eigenen
Typus. Die Seitenborste des dritten Palpengliedes ist kräftig entwickelt. Die der Palpenkralle
gegenüberstehenden Borsten des vorletzten Gliedes sind kurz. Das nach hinten zu abgerundete
Rückenschild trä g t an seinem dem Capitulum zugekehrten Ende an jeder Seite zwei Haare.
Ausserdem bemerkt man noch auf demselben ein Borstenpaar zwischen den Doppelaugen und je
eine Borste zwischen der vorderen und hinteren Augenlinse. Der weiche, mit Linienzeichnung
versehene Hautsaum, der Rücken- und Bauchschild trennt, lässt eine Doppelreihe alternierender,
ziemlich langer Borsten sehen. Am kräftigsten sind die Endborsten entwickelt, sie messen
0,21 mm. Die Bauchplatte, durch eine Mittelfurche in zwei spiegelgleiche Hälften geteilt, besizt
deutlich abgetrennte Vorderepimeren. Die Abgliederung des zweiten Paares ist am äusseren
Rande nur schwach angedeutet. Kurz vor der Stelle, wo die inneren Ränder der Bauchplatten-
hälffcen bogenförmig nach aussen umbiegen, werden dieselben durch eine kleine, quergestellte Chitinrinne
unterbrochen. Das Analfeld (Fig. 8m , tab. V) is t oval und h a t seine Längsachse in der
Medianlinie liegen. An den Seiten des Hinterrandes macht sich je eine seichte Einbuchtung bemerkbar.
Der Borstenbesatz des sphärischen Hautdreieckes, auf welchen die Analp'latte gelagert
ist, folgt der gewöhnlichen Anordnung, nur fällt die kräftige Entwicklung des im oberen Winkel
inserierten Haarborstenpaares besonders ins Auge. Die Beinpaare, welche sämtliche nicht die
Länge des Körpers erreichen (1. B. = 0,21, 2. B. = 0,21, 3. B. = 0,22 mm) sind mit Borsten
ziemlich reichlich versehen und besitzen Krallen, wie sie in Fig. 8 k , tab. V bildlich dargestellt
sind. Die Mittelkralle, von zwei schwächeren Nebenkrallen begleitet, hat ein breites Grundstück,
aus welchem unter fast rechtem Winkel ein schwach gebogener Zahn hervorgeht. Am Krallengrunde
sitzt ein an den letzten Beinpaaren besonders grösser, chitinöser Zahn, der mit seinen
Spitzen nach oben gebogen ist und im Verein mit den entgegen wirkenden Krallen eine A rt
Zange darstellt.
Nach der Verpuppung, über deren Verlauf ich nichts berichten kann, da dieselbe wahrscheinlich
nach einem kurzen Schmarotzertum der Larve an einem mir unbekannten Wasserinsekt
erfolgen dürfte, t r i t t die achtbeinige Larve (Fig. 8 h , tab. V) auf. Sie is t zum erstenmale von
dem Russen Krendowskij‘) aufgefunden und ziemlich g ut, wenn auch schematisch, dargestellt
worden. Das ca. 0,5 mm grosse Tierchen, dessen Beinpaare weit dürftiger mit Dreh- und Fiederborsten
ausgerüstet sind, unterscheidet sich wie alle Nymphen vom adulten Tiere durch den
Mangel einer Geschlechtsöffnung und durch die geringere, aber konstante Anzahl (6) von Genitalnäpfen
auf jeder Platte. Noch sei erwähnt, dass die einzelnen Hüftplattengruppen durch grössere
Zwischenräume von einander getrennt sind. Die zweite Verpuppung wird ohne parasitärisches
Vorstadium vollzogen, indem sich die Nymphe an Wasserpflanzen anklammert.
x) M. Krendowskij, Die Metamorphose der Wassermilben. Charkow 1875, p. 60, tab. II, Fig. 16.
2. Cochleophorus deltoides Piersig.
1893;. Atax triangularis Piersig. Zool. Anzeiger Nr. 431, p. 396.
1894. GöcMeopkorus äeltoides Piersig, Zoöl. Anzeiger Nr. 449, S. 413, Nr. 7.
W eiho!i<*!i :
G rö :s s e : Die Weibchen übertreffeh oft noch die Länge der vorhergehenden Art.
G-es ta ljlg Der Körper ist eirund ohne fède Einbuchtung, in der Seiter.lage erscheint er
hoch gewölbt mit einer Einsattelung am Vorderrücken: ■
F a r b e : Die Vertreter dieser A rf waren mir schon mehrere Jahre bekannt. Keine Aufmerksamkeit
wurde auf sie gelenkt, weil sie bei der grössten Ähnlichkeit mit G. spinypes eine
ganz verschiedene Färbung aufwiesen. Die Grundfarbe is t ein äusserst ¡blasses-, durchsichtiges
Die rötlich gesprenkelte Rückendriise wird von -Rückendecken umsäumt, die', von dunkell.
rauner Khrbe. gewöhnlich nach aussen scharf abgegrenzt iln d , Ein Zusammenfliessen des weit
nach vorn gehenden Stirnlappens mit den Seitenlappen findet gewöhnlich nicht statt, Nach hinten
zu verbreitern sich die letzteren, so dass das im W a s s# befindliche Tier fast dreieckig erscheint.
H a u t : Die Epidermis ist mit zahlreichen spitzen Höckern bedeckt, die etwas dichter als
hei G. spinipes stehen. Das Ünterhautgewebe bildet ein richtiges Maschenwerk. Die Drüsenhöfe
auf Rücken und; Bauch sind n ich § § |||| s tark chitinisiert wie bei C. spinipes und fallen .deshalb
nicht « d d n s Augd. Ä i e antenniformen Borsten gleicher, denen. von G. spinnest
A u g e n : Die dunkelgciärbten Hppelaugen berühren mit ihren Vorderlinsen den Stirnrand
des Körpers, Der gegenseitige Abstand beträgt ca. 0,5 mm. Die beiden Pigmentkörper
liegen dicht nebeneinander. Der innere ühertrifft den allgemein geltenden Verhältnissen gemäss
den mehr nach Unten, gelagerten an Grösse und zwar fast ungidie Hälfte.
M u n d t e i l e : Das Maxillarorgan ist etwas kleiner als bei der Vergleichsart. Sein hinterer
Fortsatz verläuft keilförmig in eine Spitze, die nur bei starker Vergrösserung zweiteilig erscheint.
P a lp e n : Wenn auch der Bau der nahezu ein Drittel der KörperlängO erreichenden
Palpen im allgemeinen mit dem der vorhergehenden A rt übereinstimmt, so zeigt die Ausrüstung
wesentliche Abänderungen § | j j | 7e tab. IV). Die Borstèh an sämtlichen Gliedern stehen hei der
neuen A rt an Grösse bedeutend zurück, ganz abgesehen, dass auch die Insertionspunkte derselben
f » g a n z andere Verteilung haben. Die Haarhöcker der Beugseite am vorletzten Gliedèisind
etwas mehr nach vorn gerückt und von kräftiger Entwicklung. Zwischen ihnen befindet sich
eine muldenförmige Ausbuchtung. Der Zapfen mit Chitinstift am inneren Vorderende der Beug-
t f t e hebt sich infolge seiner Grösse bedeutend hervor. Bezüglich der weiteren’ Details verweise
ich auf die beigegebene Zeichnung.
H i i f t p l a t t e n : Das gesamte Hüftplattengebiet gewährt im Vergleich zu G. spinipes fast
gar keine Unterschiede. Man trifft dieselbe maschenartige Felderung der Oberfläche, dieselben
ungewöhnlich lang ausgezogenen, bis unter die dritte hezw. vierte Epimere ragenden Fortsätze
der vorderen Epimeren. Die einzige kaum bemerkenswerte Abweichung liegt vielleicht in dem
grossen, hakenartig nach aussen gezogenen Fortsatz des Hinterendes der vierten Epimere.
F ü s s e : Bei einer Körperlänge von 1,45 mm betragen die Beinlängen der Weibchen am
1. Fusse --- 1,48 mm. 3, F u s s e ^M ,3 6 mm. .
2. Fusse — 1,54 mm. 4. Fusse = 1,66 mm.