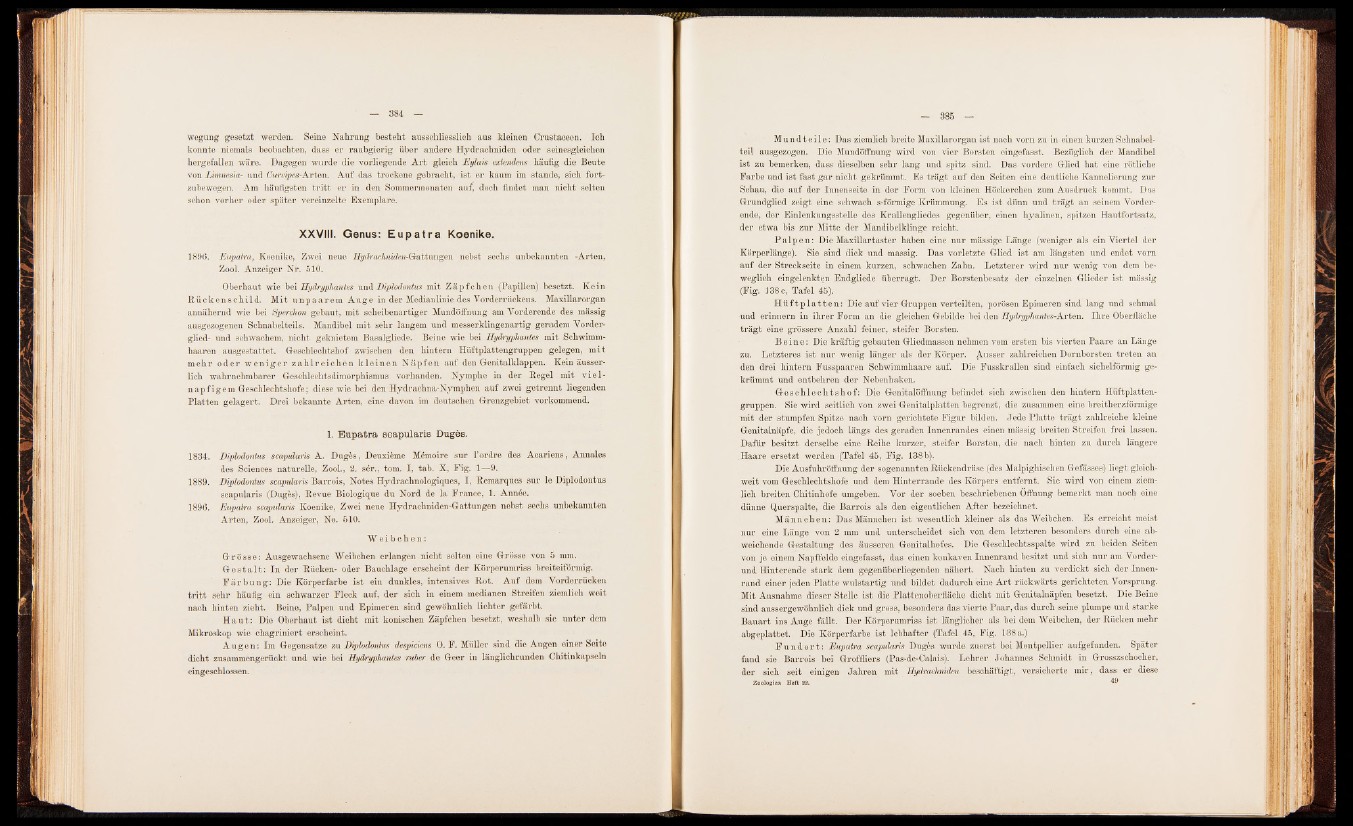
wegung gesetzt werden. Seine Nahrung besteht ausschliesslich aus kleinen Crustaceen. Ich
konnte niemals beobachten, dass er raubgierig über andere Hydrachniden oder seinesgleichen
hergefallen wäre. Dagegen wurde die vorliegende A rt gleich Eylais extendens häufig die Beute
von Limnesia- und Gurvipes-Arten. Auf das trockene gebracht, ist er kaum im Stande, sich fortzubewegen.
Am häufigsten t r i t t er in den Sommermonaten auf, doch findet man nicht selten
schon vorher oder später vereinzelte Exemplare.
XXVIII. Genus: E u p a t r a Koenike.
1896. Eupatra, Koenike, Zwei neue Hydrachniden-Qättnngen nebst sechs unbekannten -Arten,
Zool. Anzeiger Nr. 510.
Oberhaut wie bei Hydryphantes und Diplodontus mit Z ä p f c h e n (Papillen) besetzt. K ein
R ü c k e n s c h i ld . M it u n p a a r em A u g e in der Medianlinie des Vorderrückens. Maxillarorgan
annähernd wie bei Sperchon gebaut, mit scheibenartiger Mundöffnung am Vorderende des mässig
ausgezogenen Schnabelteils. Mandibel mit sehr langem und messerklingenartig geradem Vorderglied
und schwachem, nicht geknietem Basalgliede. Beine wie bei Hydryphantes mit Schwimmhaaren
ausgestattet. Geschlechtshof zwischen den hintern Hüftplattengruppen gelegen, m it
m e h r o d e r w e n ig e r z a h l r e i c h e n k l e in e n N ä p f e n auf den Genitalklappen. Kein äusser-
lich wahrnehmbarer Geschlechtsdimorphismus vorhanden. Nymphe in der Regel mit v i e l -
n a p f ig em Geschlechtshofe; diese wie hei den Hydrachna-Nymphen auf zwei getrennt liegenden
Platten gelagert. Drei bekannte Arten, eine davon im deutschen Grenzgebiet vorkommend.
1. Eupatra scapularis Dugès.
1834. Diplodontus scapularis A. Dugès, Deuxième Mémoire sur l’ordre des Acariens, Annales
des Sciences naturelle, Zool., 2. sér., tom. I, tab. X, Fig. 1—9.
1889. Diplodontus scapularis Barrois, Notes Hydrachnologiques, I, Remarques sur le Diplodontus
scapularis (Dugès), Revue Biologique du Nord de la France, 1. Année.
1896. Eupatra scapularis Koenike, Zwei neue Hydrachniden-Gattungen nebst sechs unbekannten
Arten, Zool. Anzeiger, No. 610.
W e i b c h e n :
G rö s s e : Ausgewachsene Weibchen erlangen nicht selten eine Grösse von 5 mm.
G e s t a l t : In der Rücken- oder Bauchlage erscheint der Körperumriss breiteiförmig.
F ä r b u n g : Die Körperfarbe ist ein dunkles, intensives Rot. Auf dem Vorderrücken
t r i t t sebr häufig ein schwarzer Fleck auf, der sich in einem medianen Streifen ziemlich weit
nach hinten zieht. Beine, Palpen und Epimeren sind gewöhnlich lichter gefärbt.
H a u t : Die Oberhaut ist dicht mit konischen Zäpfchen besetzt, weshalb sie unter dem
Mikroskop wie chagriniert erscheint.
A n g en : Im Gegensätze zu Diplodontus despiciens 0. F. Müller sind die Augen einer Seite
dicht zusammengerückt und wie bei Hydryphantes ruber de Geer in länglichrunden Chitinkapseln
eingeschlossen.
M u n d te i le : Das ziemlich breite Maxillarorgan ist nach vorn zu in einen kurzen Schnabelteil
ausgezogen. Die Mundöffnung wird von vier Borsten eingefasst. Bezüglich der Mandibel
is t zu bemerken, dass dieselben sehr lang und spitz sind. Das vordere Glied h a t eine rötliche
Farbe und ist fast gar nicht gekrümmt. Es trä g t auf den Seiten eine deutliche Kannelierung zur
Schau, die auf der Innenseite in der Form von kleinen Höckerchen zum Ausdruck kommt. Das
Grundglied zeigt eine schwaöh s-förmige Krümmung. Es ist dünn und trä g t an seinem Vorderende,
der Einlenkungsstelle des Krallengliedes gegenüber, einen hyalinen, spitzen Hautfortsatz,
der etwa bis zur Mitte der Mandibelklinge reicht.
P a lp e n : Die Maxillartaster haben eine nur massige Länge (weniger als ein Viertel der
Körperlänge). Sie sind dick und massig. Das vorletzte Glied ist am längsten und endet vorn
auf der Streckseite in einem kurzen, schwachen Zahn. Letzterer wird nur wenig von dem beweglich
eingelenkten Endgliede überragt. Der Borstenbesatz der einzelnen Glieder ist mässig
(Fig. 138 c, Tafel 45).
H ü f t p l a t t e n : Die auf vier Gruppen verteilten, porösen Epimeren sind lang und schmal
und erinnern in ihrer Form an die gleichen Gebilde bei den Hydryphantes-Äxten. Ihre Oberfläche
trä g t eine grössere Anzahl feiner, steifer Borsten.
B e in e : Die kräftig gebauten Gliedmassen nehmen vom ersten bis vierten Paare an Länge
zu. Letzteres ist nur wenig länger als der Körper. Ausser zahlreichen Dornborsten treten an
den drei hintern Fusspaaren Schwimmhaare auf. Die Fusskrallen sind einfach sichelförmig gekrümmt
und entbehren der Nebenhaken.
G e s c h l e c h t s h o f : Die Genitalöffnung befindet sich zwischen den hintern Hüftplattengruppen.
Sie wird seitlich von zwei Genitalplatten begrenzt, die zusammen eine breitherzförmige
■mit der stumpfen Spitze nach vorn gerichtete Figur bilden. Jede Pla tte trä g t zahlreiche kleine
Genitalnäpfe, die jedoch längs des geraden Innenrandes einen mässig breiten Streifen frei lassen.
Dafür besitzt derselbe eine Reihe kurzer, steifer Borsten, die nach hinten zu durch längere
Haare ersetzt werden (Tafel 45, Fig. 138b).
Die Ausfuhröffnung der sogenannten Rückendrüse (des Malpighischen Gefässes) liegt gleichweit
vom Geschlechtshofe und dem Hinterrande des Körpers entfernt. Sie wird von einem ziemlich
breiten Chitinhofe umgeben. Vor der soeben beschriebenen Öffnung bemerkt man noch eine
dünne Querspalte, die Barrois als den eigentlichen After bezeichnet.
M ä n n c h e n : Das Männchen is t wesentlich kleiner als das Weibchen. Es erreicht meist
nur eine Länge von 2 mm und unterscheidet sich von dem letzteren besonders durch eine abweichende
Gestaltung des äusseren Genitalhofes. Die Geschlechtsspalte wird zu beiden Seiten
von je einem Napffelde eingefasst, das einen konkaven Innenrand besitzt und sich nur am Vorder-
und Hinterende stark dem gegenüberliegenden nähert. Nach hinten zu verdickt sich der Innén-
rand einer jeden P la tte wulstartig und bildet dadurch eine A rt rückwärts gerichteten Vorsprung.
Mit Ausnahme dieser Stelle ist die Plattenoberfläche dicht mit Genitalnäpfen besetzt. Die Beine
sind aussergewöhnlich dick und gross, besonders das vierte Paar, das durch seine plumpe und starke
Bauart ins Auge fällt. Der Körperumriss ist länglicher als bei dem Weibchen, der Rücken mehr
abgeplattet. Die Körperfarbe ist lebhafter (Tafel 45, Fig. 138 a.)
F u n d o r t : Eupatra scapularis Dugès wurde zuerst bei Montpellier aufgefunden. Später
fand sie Barrois bei Groffliers (Pas-de-Calais). Lehrer Johannes Schmidt in Grosszschocher,
der sich seit einigen Jahren mit Hydrachniden beschäftigt, versicherte mir,; dass er diese
Zoologien Heft 22. ^9