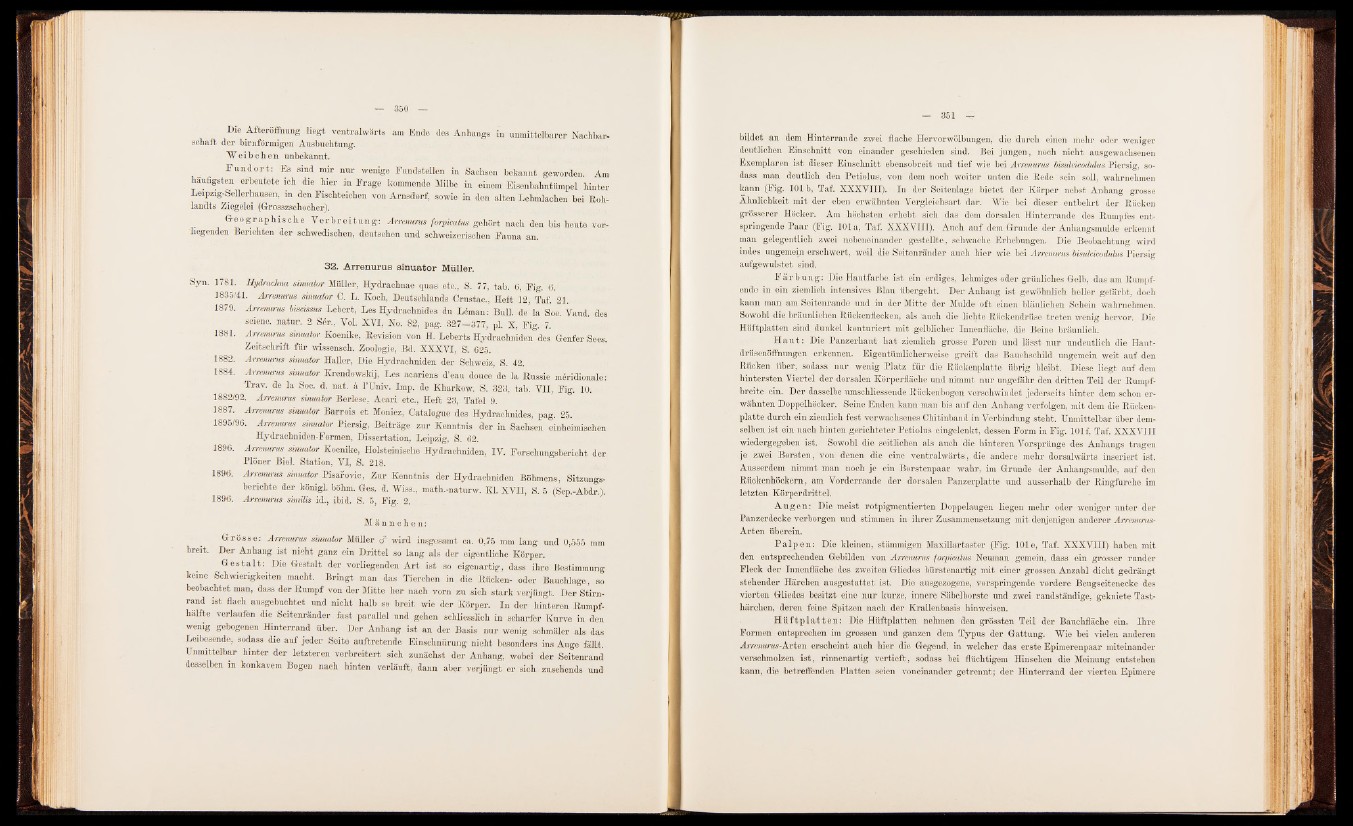
Die Afteroffnung liegt ventralwärts am Ende des Anhangs; in unmittelbarer Nachbar-
schaft der bimförmigen Ausbuchtung.
W e i b c h e n unbekannt.
F u n d o r t : Es sind mir nnr wenige Fundstellen in Sachsen bekannt geworden. Am
häufigsten erbeutete ich die hier in Frage kommende Hübe in einem Eisenbahntümpel hinter
Deipzig-Sellerhausen, in den Fischteichen von Arnsdorf, sowie in den alten Lehmlachen bei Roh-
landts Ziegelei (Grosszschocher).
G e o g r a p h i s c h e V e r b r e i t u n g : Arrenurus forpicatus gehört nach den bis heute vorliegenden
Berichten der schwedischen, deutschen und schweizerischen Fauna an.
32. Arrenurus sinuator Müller.
Syn- 1781. Bydrachna sinuator Müller, Hydrachnae quas etc., S. 77, tab. 6, Fig. 6.
1835/41. Arrenurus sinuator C. L. Koch, Deutschlands Crustac., Heft 12 , Taf. 21.
1879. Arrenurus biscissus Lebert, Les Hydrachnides du Léman: Bull, de la Sog.. Vaud, des
scienc. natur. 2 Sér., Vol. XVI, No. 82, pag. 327—877, pl. X, Fig. 7.
1881. Arrenurus sinuator Koenike, Revision von H. Leberts Hydrachniden -d ä Genfer Sees.
Zeitschrift fü r wissensch. Zoologie, Bd. XXXVI, S. 625.
1882. Arrenurus sinuator Haller, Die Hydrachniden der Schweiz, S. 4-2.
1884. Arrenurus sinuator Krendowskij, Les acariens d’eau douce de la R u sé e
Trav. de la Soc. d. nat. à l’Univ. Lmp. de Kharkow. S. 328, tab. VII, Fig. 10.
1882/92. Arrenurus sinuator Berlese, Acari etc., Heft 23,,: Tafel 9.
1887. Arrenurus sinuator Barrois et Moniez, Catalogue des Hydrachnidreé, pag.
1895/96. Arrenurus sinuator Piersig, Beiträge zur Kenntnis der in Sachsen einheimischen
Hydrachniden-Formen, Dissertation, Leipzig, S. 62.
1896. Arrenurus sinuator Koenike, Holsteinische Hydrachniden, IV. Forschungshericht der
Plöner Biol. Station; VI, S. 218.
1896. Arrenurus sinuator Pisafovic, Zur Kenntnis der Hydrachniden Böhmens, Sitzungsberichte
der königl. böhm. Ges. d. Wiss., math.-naturw. Kl. XVII, S. 5 (Sep.-Abdr.).
1896. Arrenurus similis id., ibid. S. 5 , Fig. 2.
M ä n n c h e n :
G r ö s s e : Arrenurus sinuator Müller cf wird insgesamt ca. 0,75 mm lang und 0,555 mm
breit. Der Anhang is t nicht ganz ein D rittel so lang als der eigentliche Körper-
G e s t a l t : Die Gestalt der vorliegenden A rt is t so eigenartig, dass ihre Bestimmung
keine Schwierigkeiten macht- .Bringt man das Tierchen in die Rücken- oder Bauchlage, so
beobachtet man, dass der Rumpf von der Mitte her nach vorn zu sich s tark verjüngt. Der Stirnrand
ist flach ansgebnohtet und nicht halb so breit wie der Körper. In der hinteren Rnmpf-
hälfte verlaufen die Seitenränder fast parallel und gehen schliesslich in scharfer Kurve in den
wenig gebogenen Hinterrand über. Der Anhang ist an der Basis nnr wenig schmäler als das
Leibesende, sodass die auf jeder Seite anftretende Einschnürung nicht besonders ins Auge fällt.
Unmittelbar hinter der letzteren verbreitert sich zunächst der Anhang, wobei der Seitenrand
desselben m konkavem Bogen nach hinten verläuft, dann aber verjüngt er sich., zusehends und
bildet an dem Hinterrande zwei flacbe Hervorwölbungen, die durcb einen mehr oder weniger
deutlichen Einschnitt von einander geschieden sind. Bei jungen, noch nicht ausgewachsenen
Exemplaren ist dieser Einschnitt ebensobreit und tief wie bei Arrenurus bisulcieodulus Piersig, sodass
man deutlich den Petiolus, von dem noch weiter unten die Rede sein' soll, wahrnehmen
kann (Fig. 101 b, Taf. XXXVIII). In der Seitenlage bietet der Körper nebst Anhang grosse
Ähnlichkeit mit der eben erwähnten Vergleichsart dar. Wie bei dieser entbehrt der Rücken
grösserer Höcker. Am höchsten erhebt sich das dem dorsalen Hinterrande des Rumpfes entspringende
Pa a r (Fig. 101 a, Taf. XXXVIII). Auch auf dem Grunde der Anhangsmulde erkennt
man gelegentlich zwei nebeneinander gestellte, schwache Erhebungen. Die Beobachtung wird
indes ungemein erschwert, weil die Seitenränder auch hier wie bei Arrenurus bisulcieodulus Piersig
aufgewulstet sind.
F ä r b u n g : Die Hautfarbe ist ein erdiges, lehmiges oder grünliches Gelb, das am Rumpfende
in ein ziemlich intensives Blau übergeht. Der Anhang ist gewöhnlich heller gefärbt, doch
kann man am Seitenrande lind in der Mitte der Mulde oft einen bläulichen Schein wahrnehmen.
Sowohl die bräunlichen Rückenflecken, als auch die lichte Rückendrüse treten wenig hervor. Die
Hüftplatten sind dunkel konturiert mit gelblicher Innenfläche, die Beine bräunlich.
H a u t : Die Panzerhant h a t ziemlich grösse Poren und lässt nur undeutlich die Hautdrüsenöffnungen
erkennen. Eigentümlicherweise greift das Bauchschild ungemein weit auf den
Rücken über, sodass nur wenig Platz für die Rückenplatte übrig bleibt. Diese liegt auf dem
hintersten Viertel der dorsalen Körperfläche und nimmt nur ungefähr den dritten Teil der Rumpfbreite
ein. Der dasselbe umschliessende Rückenbogen verschwindet jederseits hinter dem schon erwähnten
Doppelhöcker. Seine Enden kann man bis auf den Anhang verfolgen, mit dem die Rückenp
latte durch ein ziemlich fest verwachsenes Chitinband in Verbindung steht. Unmittelbar über demselben
ist ein nach hinten gerichteter Petiolus eingelenkt, dessen Form in Fig. 101 f, Taf. XXXVIII
wiedergegeben ist. Sowohl die seitlichen als auch die hinteren Vorsprünge des Anhangs tragen
je zwei Borsten, von denen die eine ventralwärts, die andere mehr dorsalwärts inseriert ist.
Ausserdem nimmt man noch je ein Borstenpaar wahr, im Grunde der Anhangsmulde, auf den
Rückenhöckern, am Vorderrande der dorsalen Panzerplatte und ausserhalb der Ringfurche im
letzten Körperdrittel.
A u g e n : Die meist rotpigmentierten Doppelaugen liegen mehr oder weniger unter der
Panzerdecke verborgen und stimmen in ihrer Zusammensetzung mit denjenigen anderer Arrenurus-
Arten überein.
P a lp e n : Die kleinen, stämmigen Maxillartaster (Fig. 101 e, Taf. XXXVIII) haben mit
den entsprechenden Gebilden von Arrenums forpicatus Neuman gemein, dass ein grösser runder
Fleck der Innenfläche des zweiten Gliedes bürstenartig mit einer grossen Anzahl dicht gedrängt
stehender Härchen ausgestattet ist. Die ausgezogene, vorspringende vordere Beugseitenecke des
vierten Gliedes besitzt eine nur kurze, innere Säbelborste und zwei randständige, gekniete Tasthärchen,
deren feine Spitzen nach der Krallenbasis binweisen.
H ü f t p l a t t e n : Die Hüftplatten nehmen den grössten Teil der Bauchfläche ein. Ihre
Formen entsprechen im grossen und ganzen dem Typus der Gattung. Wie hei vielen anderen
Arrenurus-Arten erscheint auch hier die Gegend, in welcher das erste Epimerenpaar miteinander
verschmolzen is t, rinnenartig vertieft, sodass bei flüchtigem Hinsehen die Meinung entstehen
kann, die betreffenden Platten seien voneinander getrennt; der Hinterrand der vierten Epimere