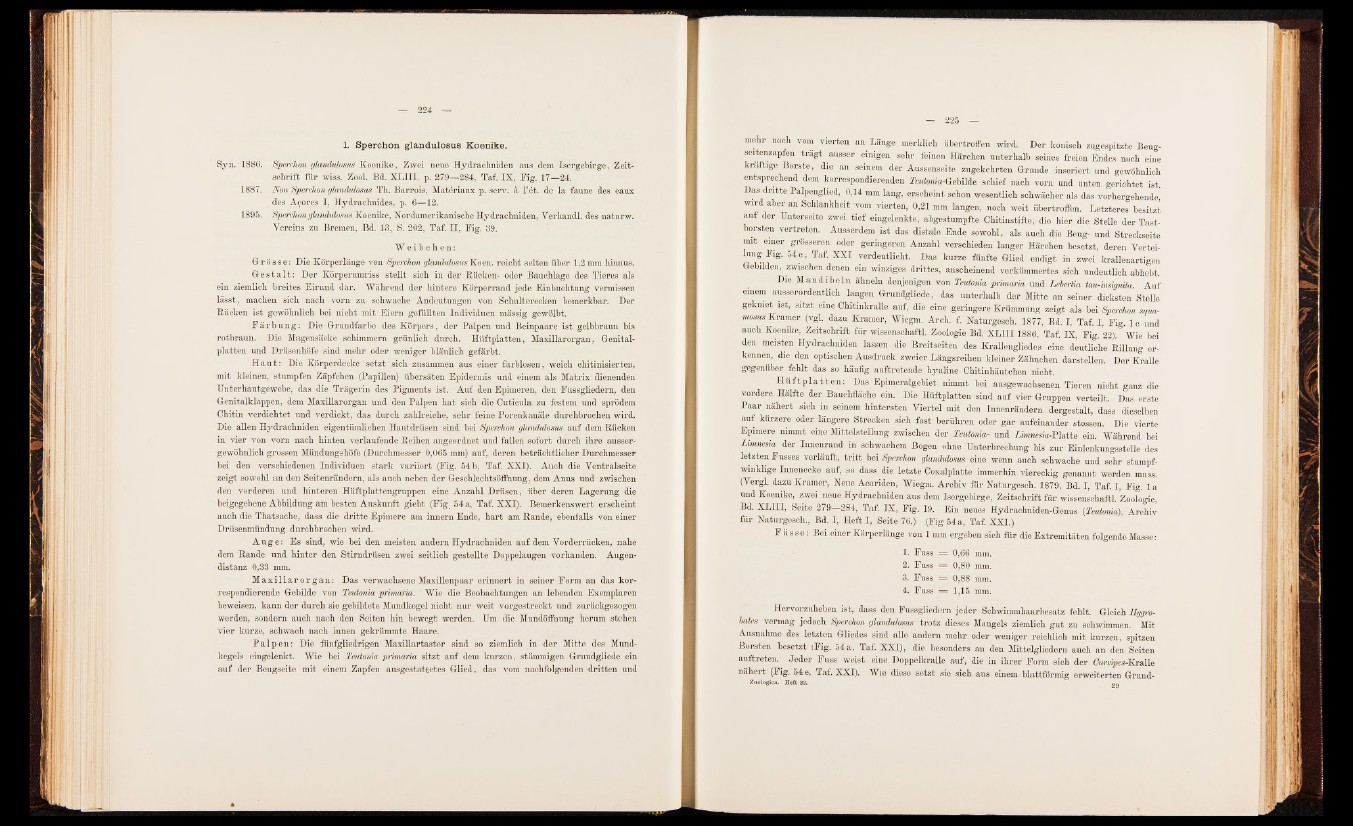
1. Sperchon glandulosus Koenike.
Syn. 1886. Sperchon glandulosus Koenike, Zwei neue Hydrachniden aus dem Isergebirge, Zeitschrift
für wiss. Zool. Bd. XLIII. p. 279—284, Taf. IX, Fig. 17—24.
1887. Non Sperchon glandulosus Th. Barrois, Matériaux p. serv. à l’ét. de la faune des eaux
des Açores I, Hydrachnides, p. 6—12 .
1895. Sperchon glandulosus Koenike, Nordamerikanische Hydrachniden, Verhandl. dés naturw.
Vereins zu Bremen, Bd. 13, S. 202, Taf. II, Fig. 39.
W e i b c h e n :
G r ö s s e : Die Körperlänge von Sperchon glandulosus Koen. reicht selten über 1,2 mm hinaus.
G e s t a l t : Der Körperumriss stellt sich in der Rücken- oder Bauchlage des Tieres als
ein ziemlich breites Eirund dar. Während der hintere Körperrand jede Einbuchtung vermissen
lässt, machen sich nach vorn zu schwache Andeutungen von Schulterecken bemerkbar. Der
Rücken ist gewöhnlich bei nicht mit Eiern gefüllten Individuen mässig gewölbt.
F ä r b u n g : Die Grundfarbe des Körpers, der Palpen und Beinpaare ist gelbbraun bis
rotbraun. Die Magensäcke schimmern grünlich durch. Hüftplatten, Maxillarorgan, Genitalplatten
und Drüsenhöfe sind mehr oder weniger bläulich gefärbt.
H a u t : Die Körperdecke setzt sich zusammen aus einer farblosen, weich chitinisierten,
mit kleinen, stumpfen Zäpfchen (Papillen) übersäten Epidermis und einem als Matrix dienenden
Unterhautgewebe, das die Trägerin des Pigments ist. Auf den Epimeren, den Fussgliedern, den
Genitalklappen, dem Maxillarorgan und den Palpen h a t sich die Cuticula-zu festem uiid sprödem
Chitin verdichtet und verdickt, das durch zahlreiche, sehr feine Porenkanäle durchbrochen wird.
Die allen Hydrachniden eigentümlichen Hautdrüsen sind bei Sperchon glandulosus auf dem Rücken
in vier von vorn nach hinten verlaufende Reihen angeordnet und fallen sofort durch ihre ausser-
gewöhnlich grossen Mündungshöfe (Durchmesser 0,065 mm) auf, deren beträchtlicher Durchmesser
bei den verschiedenen Individuen s tark variiert (Fig. 54 b, Taf. XXI). Auch die Ventralseite
zeigt sowohl an den Seitenrändern, als auch neben der Geschlechtsöffnung, dem Anus und zwischen
den vorderen und hinteren Hüftplattengruppen eine Anzahl Drüsen, über deren Lagerung die
-beigegebene Abbildung am besten Auskunft giebt (Fig. 54 a, Taf. XXI). Bemerkenswert erscheint
auch die Thatsache, dass die dritte Epimere am innern Ende, h a rt am Rande, ebenfalls von einer
Drüsenmündnng durchbrochen wird.
A u g e : Es sind, wie bei den meisten ändern Hydrachniden auf dem Vorderrücken, nahe
dem Rande und hinter den Stirndrüsen zwei seitlich gestellte Doppelaugen vorhanden. Augendistanz
0,33 mm.
M a x i l l a r o r g a n : Das verwachsene Maxillenpaar erinnert in seiner Form an das korrespondierende
Gebilde von Teutonia primaria. Wie die Beobachtungen an lebenden Exemplaren
beweisen, kann der durch sie gebildete Mundkegel nicht nur weit vorgestreckt und zurückgezogen
werden, sondern auch nach den Seiten hin bewegt werden. Um die Mundöffnung herum stehen
vier kurze, schwach nach innen gekrümmte Haare.
P a l p e n : Die fünfgliedrigen Maxillartaster sind so ziemlich in der Mitte des Mundkegels
eingelenkt. Wie bei Teutonia primaria sitzt auf dem kurzen, stämmigen Grundgliede ein
auf der Beugseite mit einem Zapfen ausgestattetes Glied , das vom nachfolgenden-dritten und
mehr noch vom vierten an Länge merklich übertroffen wird. Der konisch zugespitzte Beug-
seitenzapfen tra g t a u s s e rg n ig e n . 4<ffir feinen Härchen unterhalb seines freien Endes noch eine
kräftige Borste, die an . seinem der Aussenseite zugekehrten Grunde inseriert und gewöhnlich
entsprechend dem korrespondierenden Tmtmm-Gebilde schief nach vorn, und unten gerichtet ist.
Das dritte Palpenglied, 0,14 mm lang, erscheint schon wesentlich schwächer als das vorhergehende,
wärd aber an » i a n k h e i t vom vierten, ¡0,21 mm langen, nohie weit übertroffijgj Letzteres besitzt
auf der Unteigeite zwei tief eingelenkte, abgestumpfte e ittih s tifte , die hier die Stelle der Tastborsten
vertreten. Ausserdem ist das distale E n d ||ow o h l, als auch die Beug- und Streokseite
mit einer grösseren oder geringeren Anzahl verschieden langer Härchen besetzt, deren Verteilung
Fig. 54 c , Taf. XXI verdeutlicht. Das kurze fünfte Glied .endigt in zwei krallenartigen
Gebilden, zwischen deneh .ein winziges drittes,: anscheinend verkümmertes if th ¿«deutlich ahheht.
Die M a n d ib e ln ähneln d e h jen ig en ^ ü m f o r ó primaria und Lebertia tata-insignita. Auf
einem ausserordentlich langen Grundgliede, das unterhalb der Mittk-an seih#-! dicksten Stelle
gekniet ist,ggtz t eine Chitinkraile auf, die eine geringere. Krümmung zeigt als bei Sperchon squamosus
Xr&mer (vgl. dazu Kramer, Wiegm. Arch. f. Naturgeseh. Bd. I, Taf. I, Fig. Xc und
auch Koenike, Zeitschrift für wissenschaftl. Zoologie B d /X L III 188«, Taf. IX, Fig 22) Wie hei
den R e is te n Hydrachniden lassen die Breitseiten, dès KraUengliedès ' eine deutliche ßillnng efe
kennen, die den optischen Ausdruck zweier Längsreihen;:kleiner Zähncheh darstellen. Der Kralle
gegenüber fehlt das so häufig auftretende hyaline Chitinhäutchen nicht.
H ü f t p l a t t e n : Das Epimeralgebiet nimmt hei ausgewachsenen Tieren nicht ganz die
vordere Hälfte der. Bauchfläche ein. Die Hüftplatten sind auf vier Gruppen verteilt. - , Das erste
P a a r nähert sich in seinem hintersten Viertel mit den Innenrändern dergestalt, dass 'M W
auf kürzere oder längere Strecken sich fast berühren äodpr .'gar aufèinander siossen, Die vierte
Epimere nimmt eine Mittelstellung zwischen ie r . Teutonia- und Limnesio-Platte ein. Während bèi
Limnesia der Innenrand in schwachem Bogen ohne Unterbrechung bis zur EinlenkungssteUe des
letzten Fusses verläuft, tr i tt bei Sperchon glandulosus eine wenn auch schwache und sehr stumpfwinklige
Innenecke auf, so dass die letzte Coxalplatte immerhin viereckig genannt werden muss.
i|Vergl. dazu Kràmer, Neue Acariden, Wiegm. Archiv für Naturgeseh. 1879, Bd. I, Taf. I, Fig. 1 a
und Koenike, zwei neue Hydrachniden aus dem Isergebirge, Zeitschrift für wissenschaftl. Zoologie,
Bd. XLIII, Seite 279—284, Taf. IX, Fig. 19. Ein ftftns Hydrachniden-Genus (Teutonia), Archiv
für Naturgeseh., Bd. I-, Heft I, : Seite 76.) (Fig 54 a, Taf. XXI.)
F ü s s e : Bei einer Körperlänge von 1 mm ergeben sich für die Extremitäten folgende Masse :
1. Fuss = 0,66 mm.
2. Fuss = 0,80 mm.
3. Fuss == 0,88 mm.
4. Fuss = ||l,1 5 mm.
Hervorzuheben ist, dass den Fussgliedern jeder Schwimmhaarbesatz fehlt. Gleich Hygro-
bates vermag jedoch Sperchon glandulosus -trotz dièses . Mangels ziemlich gut zu schwimmen. Mit
Ausnahme des letzten Gliedes sind alle ändern mehr oder weniger reichlich mit kurzen, spitzen
Borsten besetzt' (Fig. 54 a, Taf. XXI). die besonders an den Mittelgliedern auch an den Seiten
auf treten. IgiTeder Fuss weist eine Doppelkxalle auf, diè in ihrer Form sieh der Gürmpes-Kralle
nähert (Fig. 54 e, Taf. XXI). Wie diese setzt sie sich aus einem blattförmig erweiterten Grund-
Zoologica. H e ft 22. 2 9