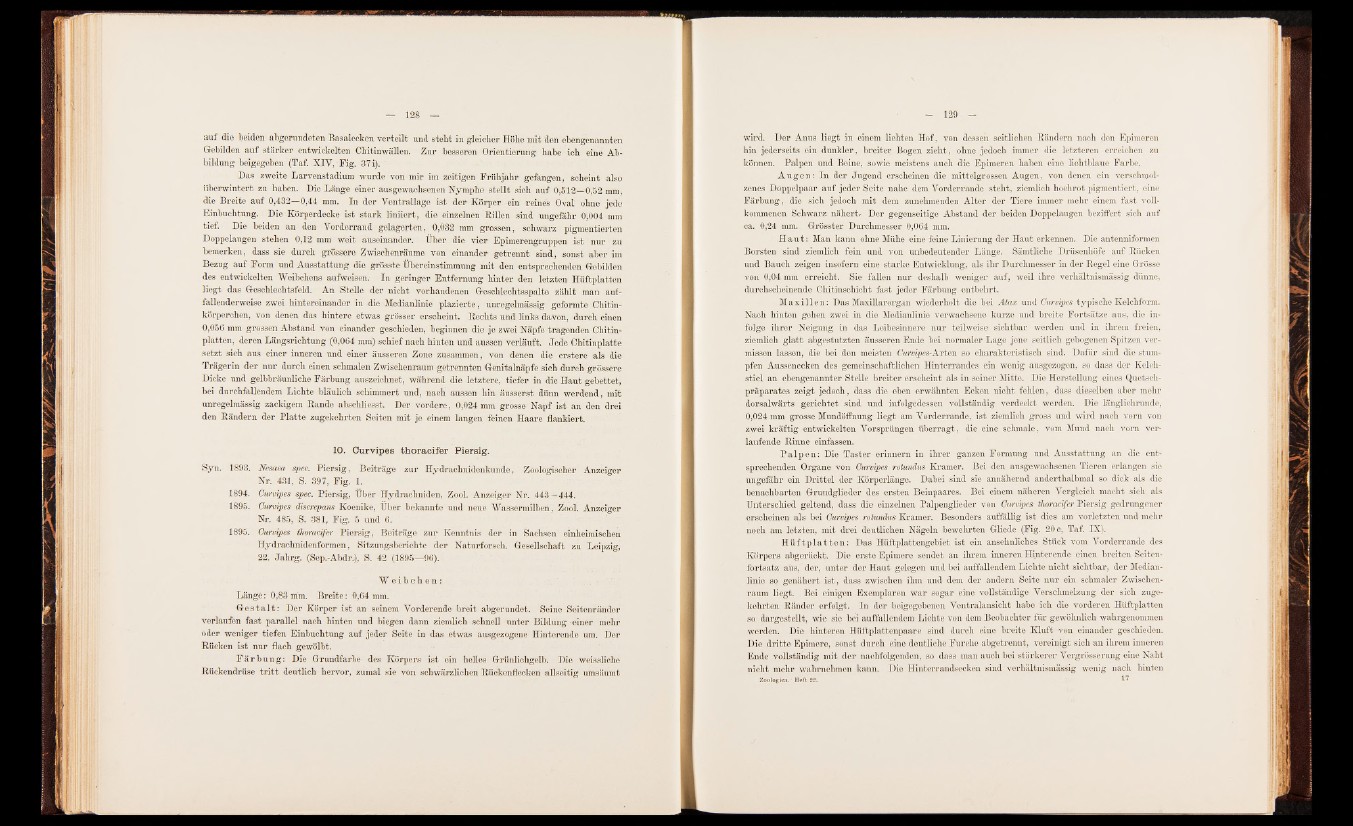
auf die beiden abgerundeten Basalecken verteilt und stebt in gleicher Höbe mit den ebengenannten
Gebilden auf stärker entwickelten Chitinwällen, Zur besseren Orientierung habe ich eine Abbildung
beigegeben (Taf. XIV, Fig. 37 i).
Das zweite Larvenstadium wurde von mir im zeitigen Frühjahr gefangen, scheint also
überwintert zu haben. Die Länge einer ausgewachsenen Nymphe stellt sich auf 0,512—0,52 mm,
die Breite auf 0,432—0,44 mm. In der Ventrallage ist der Körper ein reines Oval ohne jede
Einbuchtung. Die Körperdecke ist s tark liniiert, die einzelnen Rillen sind ungefähr 0,004 mm
tief. Die beiden an den Vorderrand gelagerten, 0,032 mm grossen, schwarz pigmentierten
Doppelaugen stehen 0,12 mm weit auseinander. Über die vier Epimerengruppen is t nur zu
bemerken, dass sie durch grössere Zwischenräume von einander getrennt sind, sonst aber im
Bezug auf Form und Ausstattung die grösste Übereinstimmung mit den entsprechenden Gebilden
des entwickelten Weibchens aufweisen. In geringer Entfernung hinter den letzten Hüftplatten
liegt das Geschlechtsfeld. An Stelle der nicht vorhandenen Geschlechtsspalte zählt man auffallenderweise
zwei hintereinander in die Medianlinie plazierte, unregelmässig geformte Chitinkörperchen,
von denen das hintere etwas grösser erscheint. Rechts und links davon, durch einen
0,056 mm grossen Abstand von einander geschieden, beginnen die je zwei Näpfe tragenden Chitinplatten,
deren Längsrichtung (0,064 mm) schief nach hinten und aussen verläuft. Jede Chitinplatte
setzt sich aus einer inneren und einer äusseren Zone zusammen, von denen die erstere als die
Trägerin der nur durch einen schmalen Zwischenraum getrennten Genitalnäpfe sich durch grössere
Dicke und gelbbräunliche Färbung auszeichnet, während die letztere, tiefer in die Haut gebettet,
bei durchfallendem Lichte bläulich schimmert und, nach aussen hin äusserst dünn werdend, mit
unregelmässig zackigem Rande abschliesst. Der vordere, 0,024 mm grosse Napf ist an den drei
den Rändern der Pla tte zugekehrten Seiten mit je einem langen feinen Haare flankiert.
10. Curvipes thoracifer Piersig.
Syn. 1893. Nesaea spec. Piersig, Beiträge zur Hydrachnidenkunde, Zoologischer Anzeiger
Nr. 431, S. 397, Fig. 1.
1894. Curvipes spec. Piersig, Über Hydrachniden, Zool. Anzeiger Nr. 443—444.
1895. Curvipes discrepans Koenike, Über bekannte und neue Wassermilben, Zool. Anzeiger
Nr. 485, S. 381, Fig. 5 und 6.
1895. Curvipes thoracifer Piersig, Beiträge zur Kenntnis der in Sachsen einheimischen
Hydrachnidenformen, Sitzungsberichte der Naturforsch. Gesellschaft zu Leipzig,
22. Jahrg. (Sep.-Abdr.), S. 42 (1895—9 6 p ’•
W e i b c h e n :
Länge: 0,83 mm. Breite: 0,64 mm.
G e s t a l t : Der Körper ist an seinem Vorderende breit abgerundet. Seine Seitenränder
verlaufen fast parallel nach hinten und biegen dann ziemlich schnell unter Bildung einer mehr
oder weniger tiefen Einbuchtung auf jeder Seite in das etwas ausgezogene Hinterende um. Der
Rücken ist nur flach gewölbt.
F ä r b u n g : Die Grundfarbe des Körpers ist ein helles Grünlichgelb. Die weissliche
Rückendrüse t r i t t deutlich hervor, zumal sie von schwärzlichen Rückenflecken allseitig umsäumt
wird. Der Anus liegt in einem lichten Hof, von dessen seitlichen Rändern nach den Epimeren
hin jederseits ein dunkler, breiter Bogen zieht, ohne jedoch immer die letzteren erreichen zu
können. Palpen und Beine, sowie meistens auch die Epimeren haben eine lichtblaue Farbe.
A u g e n : In der Jugend erscheinen die mittelgrossen Augen, von denen ein verschmolzenes
Doppelpaar auf jeder Seite nahe dem Vorderrande steht, ziemlich hochrot pigmentiert, eine
Färbung, die sich jedoch mit dem zunehmenden Alter der Tiere immer mehr einem fast vollkommenen
Schwarz nähert? Der gegenseitige Abstand der beiden Doppelaugen beziffert sich auf
ca. 0,24 mm. Grösster Durchmesser 0,064 mm.
H a u t : Man kann ohne Mühe eine feine Linierung der Haut erkennen. Die antenniformen
Borsten sind ziemlich fein und von unbedeutender Länge. Sämtliche Drüsenhöfe auf Rücken
und Bauch zeigen insofern eine starke Entwicklung, als ih r Durchmesser in der Regel eine Grösse
von 0,04 mm erreicht. Sie fallen nur deshalb weniger auf, weil ihre verhältnismässig dünne,
durchscheinende Chitinschicht fast jeder Färbung entbehrt.
M a x il le n : Das Maxillarorgan wiederholt die bei Atax und Curvipes typische Kelchform.
Nach hinten gehen zwei in die Medianlinie verwachsene kurze und breite Fortsätze aus, die infolge
ihrer Neigung in das Leibesinnere nur teilweise sichtbar werden und in ihrem freien,
ziemlich gla tt abgestutzten äusseren Ende bei normaler Lage jene seitlich gebogenen Spitzen vermissen
lassen, die bei den meisten Curvipes-Arten, so charakteristisch sind. Dafür sind die stumpfen
Aussenecken des gemeinschaftlichen Hinterrandes ein wenig ausgezogen, so dass der Kelchstiel
an ebengenannter Stelle, breiter erscheint als in seiner Mitte. Die Herstellung eines Quetschpräparates
zeigt jedoch, dass die eben erwähnten Ecken nicht fehlen, dass dieselben aber mehr
dorsalwärts gerichtet sind und infolgedessen vollständig verdeckt werden. Die länglichrunde,
0,024 mm grosse Mundöffnung liegt am Vorderrande, is t ziemlich gross und wird nach vorn von
zwei kräftig entwickelten Vorsprüngen überragt, die eine schmale, vom Mund nach vorn verlaufende
Rinne einfassen.
P a lp e n : Die Taster erinnern in ihrer ganzen Formung und Ausstattung an die entsprechenden
Organe von Curvipes rotundus Kramer. Bei den ausgewachsenen Tieren erlangen sie
ungefähr ein Drittel der Körperlänge. Dabei sind sie annähernd anderthalbmal so dick als die
benachbarten Grundglieder des ersten Beinpaares. Bei einem näheren Vergleich macht sich als
Unterschied geltend, dass die einzelnen Palpenglieder von Curvipes thoracifer Piersig gedrungener
erscheinen als bei Curvipes rotundus Kramer. Besonders auffällig ist dies am vorletzten und mehr
noch am letzten, mit drei deutlichen Nägeln bewehrten Gliede (Fig. 20 c, Taf. IX).
H ü f t p l a t t e n : Das Hüftplattengebiet ist ein ansehnliches Stück vom Vorderrande des
Körpers abgerückt. Die erste Epimere sendet an ihrem inneren Hinterende einen breiten Seitenfortsatz
aus, der, unter der Haut gelegen und bei auffallendem Lichte nicht sichtbar, der Medianlinie
so genähert is t, dass zwischen ihm und dem der ändern Seite nur ein schmaler Zwischenraum
liegt. Bei einigen Exemplaren war sogar eine vollständige Verschmelzung der sich zugekehrten
Ränder erfolgt. In der beigegebenen Ventralansicht habe ich die vorderen Hüftplatten
so dargestellt, wie sie bei auffallendem Lichte von dem Beobachter für gewöhnlich wahrgenommen
werden. Die hinteren Hüftplättenpaare sind durch eine breite Kluft von einander geschieden.
Die d ritte Epimere, sonst durch eine deutliche Furche abgetrennt, vereinigt sich an ihrem inneren
Ende vollständig mit der nachfolgenden, so dass man auch bei stärkerer Vergrösserung eine Naht
nicht mehr wahrnehmen kann. Die Hinterrandsecken sind verhältnismässig wenig nach hinten
Zoologioa. ■ Heft 22. 1 7