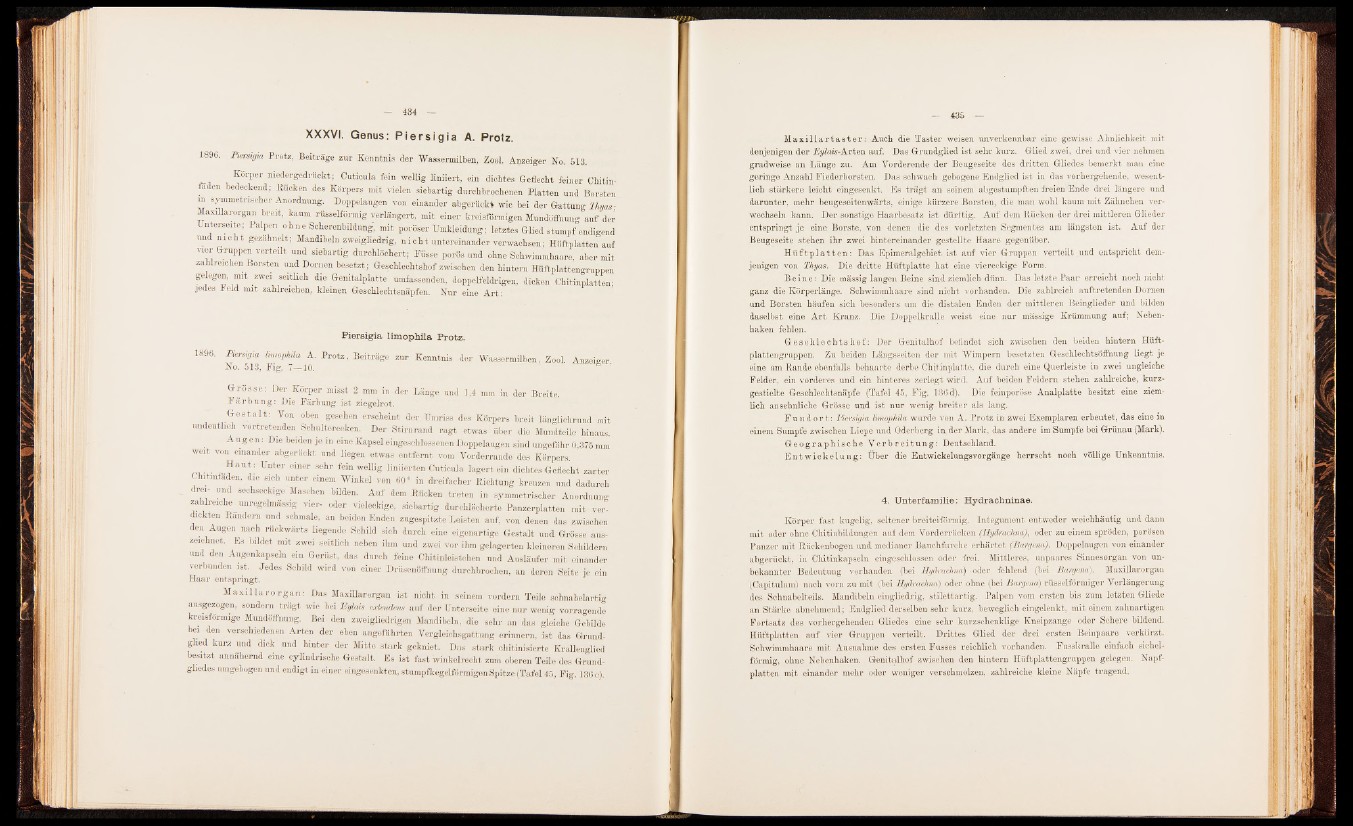
XXXVI. Genus: P l e r s i g i a A. Protz.
1896. Piersigia R a tz , Beiträge zur Kenntnis der Wassermilben, Zool. Anzeiger No. 513.
■ K8rPer niedergedrückt; Cuticula fein wellig Kniiert, ein dichtes Geflecht feiner Chitin-
aden bedeckend; Rücken des Körpers mit vielen siebartig durchbrochenen H a tten und Borsten
m symmetrischer Anordnung. Doppelaugen von einander abgerückt wie bei der Gattung Ihyas-
axi larorgan breit, kaum rüsselförmig verlängert, mit einer kreisförmigen Mundöffnung auf der
Unterseite:; Palpen o h n e Scherenbildung', mit poröser Umkleidung; letztes Glied stumpf endigend
und n i c h t gezahnelt; Mandibeln zweigliedrig, n i c h t untereinander verwachsen; Hüftplatten auf
vier Gruppen verteüt und siebartig durchlöchert; Pässe porös und ohne Schwimmhaare, aber mit
zahlreichen Borsten und Dornen besetzt; Geschlechtshof zwischen den Untern Hüftplattengruppen
gelegen mit zwei seitlich die Genitalplatte umfassenden, doppelfeldrigen, dicken Chitinplatton-
jedes Feld mit zahlreichen, kleinen Geschlechtsnäpfen. Nur eine A rt:
Piersigia limophila Protz.
1896. Piersigia UmopMa A. P rotz, Beiträge zur Kenntnis der Wassermilben. Zool Anzeiger
No. 513, Fig. 7—10. :
G rö s s e : Der Körper misst 2 mm in der Länge und 1,4 mm in der Breite. '
F ä r b u n g : Die Färbung is t ziegelrot.
G e s t a l t : Von oben gesehen erscheint der Umriss des Körpers breit länglichrund mR
undeutlich vortretenden Schulterecken. Der Stirnrand ra g t etwas über die Mundteile hinaus
A u g e n : -Die beiden je in eine Kapsel eingeschlössenen Doppelaugen sind ungefähr 0,375 mm
weit von einander abgeriiekt und liegen etwas entfernt vom Vorderrande des Körpers.
f a u t : Unter einer sekr fein üniierten Cuticula lagert ein dichtes Geflecht zarter
Chitinfaden, die sich unter einem Winkel von 60» in dreifacher Richtung kreuzen und dadurch
drei- und sechseckige Maschen bilden. Auf dem Rücken treten in symmetrischer Anordnung
zahlreiche unregelmassig vier- oder vieleckige, siebartig durchlöcherte Panzerplatten mit ver-
ic ten Rändern und schmale, an beiden Enden zugespitzte Leisten auf, von denen das zwischen
den Augen nach rückwärts Hegende Schild sich durch eine eigenartige Gestalt und Grösse äus-
zeichnet. Es bildet mit zwei seitlich neben ihm und zwei vor ihm gelagerten kleineren Schildern
und den Augenkapseln ein Gerüst, das durch feine Chitinleistchen und Ausläufer mit einander
verbunden ist. Jedes Schild wird von einer Drüsenöffnung, durchbrochen, an deren Seite io ein
Haar entspringt.
M a x i l l a r o r g a n : Das Maxillarorgan ist nicht in seinem vordem Teile schnabelartig
ausgezogen, sondern trä g t wie bei Eylais extmdem auf der Unterseite eine nur wenig vorragende
kreisförmige Mundöffnung. Bei den zweigliedrigen Mandibeln, die sehr an das gleiche Gebilde
bei den verschiedenen Arten der eben angeführten Vergleichsgattung erinnern, ist das Grundglied
kurz und dick und hinter der Mitte sta rk gekniet, Das stark chitinisierte Krallenglieä
besitzt annähernd eine cylindrische Gestalt. Es ist fast winkelreeM zum oberen Teile des Grundgliedes
umgebogen und endigt in einer eingesenkten, stumpfkegelförmigen Spitze (Tafel 45, Fig. 136 c).
M a x i l l a r t a s t e r : Auch die Taster weisen unverkennbar eine gewisse Ähnlichkeit mit
denjenigen der Eylais-Arten auf. Das Grundglied ist sehr kurz. Glied zwei, drei und vier nehmen
gradweise an Länge zu. Am Yorderende der Beugeseite des dritten Gliedes bemerkt man eine
geringe Anzahl Fiederborsten. Das schwach gebogene Endglied ist in das vorhergehende, wesentlich
stärkere leicht eingesenkt. Es trä g t an seinem abgestumpften freien Ende drei längere und
darunter, mehr beugeseitenwärts, einige kürzere Borsten, die man wohl kaum mit Zähnchen verwechseln
kann. Der sonstige Haarbesatz ist dürftig. Auf dem Rücken der drei mittleren Glieder
entspringt je eine Borste, von denen die des vorletzten Segmentes am längsten ist. Auf der
Beugeseite stehen ihr zwei hintereinander gestellte Haare gegenüber.
H ü f t p l a t t e n : Das Epimeralgebiet ist auf vier Gruppen verteilt und entspricht demjenigen
von Thyas. Die dritte Hüftplatte hat eine viereckige Form.
B e in e : Die mässig langen Beine sind ziemlich dünn. Das letzte Paar erreicht noch nicht
ganz die Körperlänge. Schwimmhaare sind nicht vorhanden. Die zahlreich auftretenden Dornen
und Borsten häufen sich besonders um die distalen Enden der mittleren Beinglieder und bilden
daselbst eine A rt Kranz. Die Doppelkralle weist eine nur mässige Krümmung auf; Nebenhaken
fehlen.
G e s c h l e c h t s h o f : Der Genitalhof befindet sich zwischen den beiden hintern Hüftplattengruppen.
Zu beiden Längsseiten der mit Wimpern besetzten Geschlechtsöffnung liegt je
eine am Rande ebenfalls behaarte derbe Chitinplatte, die durch eine Querleiste in zwei ungleiche
Felder, ein vorderes und ein hinteres zerlegt wird. Auf beiden Feldern stehen zahlreiche, kurzgestielte
Geschlechtsnäpfe (Tafel 45, Fig. 136 d). Die feinporöse Analplatte besitzt eine ziemlich
ansehnliche Grösse und ist nur wenig breiter als lang.
F u n d o r t : Piersigia limophila wurde von A. Protz in zwei Exemplaren erbeutet, das eine in
einem Sumpfe zwischen Liepe und Oderberg in der Mark, das andere im Sumpfe bei Grünau (Mark).
G e o g r a p h i s c h e V e r b r e i t u n g : Deutschland.
E n tw i c k e lu n g : Über die Entwickelungsvorgänge herrscht noch völlige Unkenntnis.
4. Unterfamilie: Hydrachninae.
Körper fast kugelig, seltener breiteiförmig. Integument entweder weichhäutig und dann
mit oder ohne Chitinbildungen auf dem Vorderrücken (Hydrachna), oder zu einem spröden, porösen
Panzer mit Rückenbogen und medianer Bauchfurche erhärtet (Bargena). Doppelaugen von einander
abgerückt, in Chitinkapseln eingeschlossen oder frei. Mittleres, unpaares Sinnesorgan von unbekannter
Bedeutung vorhanden (bei Hydrachna) oder fehlend (bei Bargena). Maxillarorgan
(Capitulum) nach vorn zu mit (bei Hydrachna) oder ohne (bei Bargena) rüsselförmiger Verlängerung
des Schnabelteils. Mandibeln eingliedrig, stilettartig. Palpen vom ersten bis zum letzten Gliede
an Stärke abnehmend; Endglied derselben sehr kurz, beweglich eingelenkt, mit einem zahnartigen
Fortsatz des vorhergehenden Gliedes eine sehr kurzschenklige Kneipzange oder Schere bildend.
Hüftplatten auf vier Gruppen verteilt. Drittes Glied der drei ersten Beinpaare verkürzt.
Schwimmhaare mit Ausnahme des ersten Fusses reichlich vorhanden. Fusskralle einfach sichelförmig,
ohne Nebenhaken. Genitalhof zwischen den hintern Hüftplattengruppen gelegen. Napf-
platten mit einander mehr oder weniger verschmolzen, zahlreiche kleine Näpfe tragend.