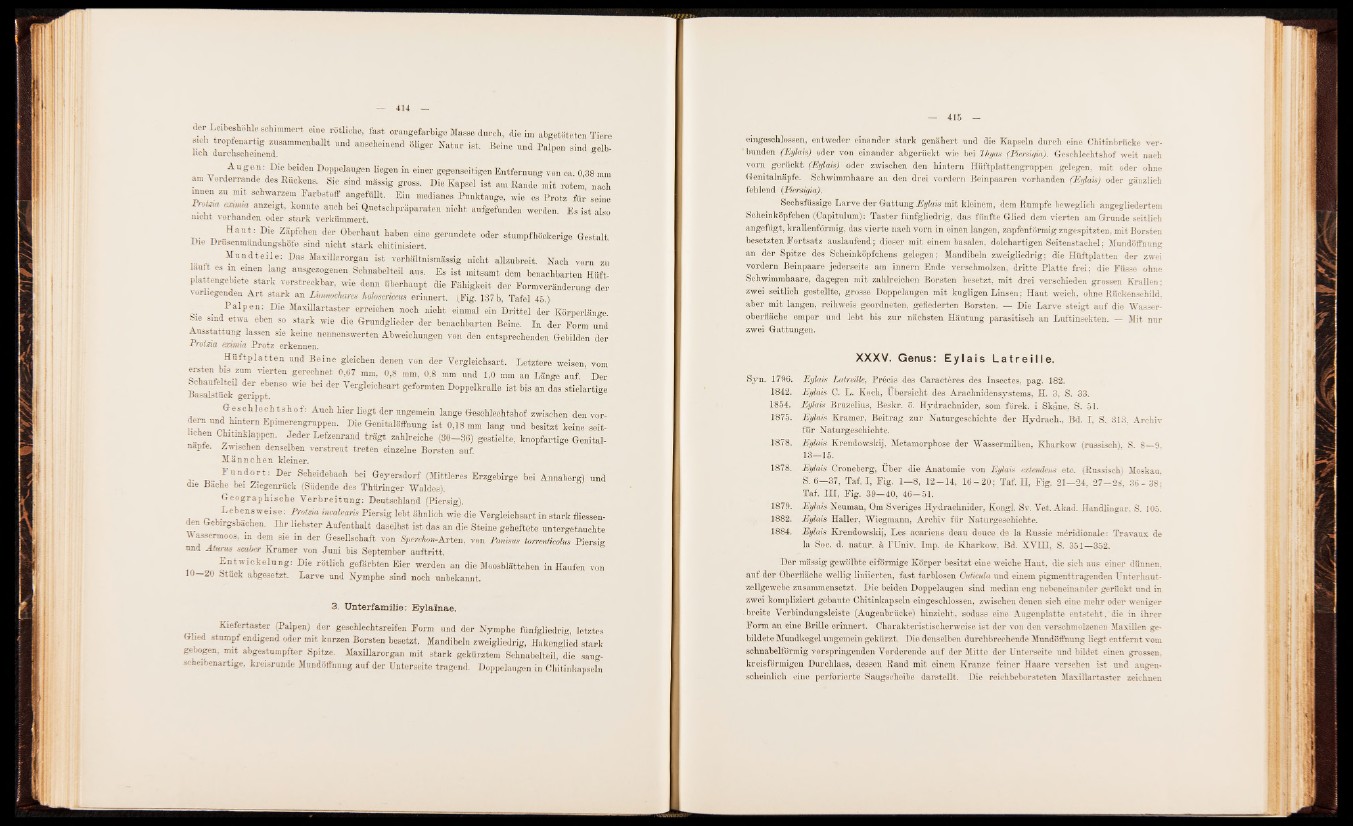
der Leibeshöhle schimmert eine rötliche, fast orangefarbige Masse durch, die im abgetöteten Tiere
sieh tropfenartig zusammenhallt und anscheinend öliger Natur ist. Beine und Palpen sind gelb-
lieh durchscheinend. r e -
Ä u g e n : Die beiden Doppelaugen liegen in einer gegenseitigen Entfernung von ca. 0,38 mm
am Vorderrande des Kückens. Sie sind massig gross. Die Kapsel ist am Kande mit rotem, nach
mnen zu mit schwarzem Earhstoff angefüllt. Ein medianes Punktauge, wie es Protz für seine
Prots,a exwna anzeigt, konnte auch bei Quetschpräparaten nicht aufgefunden werden. Es ist also
nicht vorhanden oder s tark verkümmert.
H a u t : Die Zäpfoben der Oberhaut haben eine gerundete oder stumpf höckerige Gestalt
Die Drusenmündungshöfe sind nicht s tark chitinisiert.
... „ l r " n d t e ile : Das Maxillarorgan ist verhältnismässig nicht allzubreit. Nach vorn zu
a a lt es m einen lang ausgezogenen, Schnabelteil aus. Es ist mitsamt dem benachbarten Hiift-
p a tengebiete s tark vorstreckbar, wie denn überhaupt die Fähigkeit der Formveränderung der
vorliegenden A rt stark an Lmnoclmres holosericeus erinnert. (Fig. 137 b, Tafel 45.).
; . . P a l P en: Die Maxillartaster erreichen noch nioht einmal ein Drittel der Körperlänge.
Sie sind etwa eben so stark wie die Grundglieder der benachbarten Beine. In der Form und
Ausstattung lassen sie keine nennenswerten Abweichungen von den entsprechenden Gebilden der
Prolsia exitnia Protz erkennen.
H u f tp l a t t e n und B e in e gleichen denen von der Vergleiehsart. Letztere weisen, vom
ersten bis zum vierten gerechnet 0,07 mm, 0,8 mm, 0,8 mm und 1,0 mm an Länge auf ’ Der
Schaufelted der ebenso wie bei der Vergleichsart geformten Doppelkralle ist his an das stielartige
jtSasalstück gerippt.
G e s c h l e c h t s h o f : Auch hier liegt der ungemein lange Geschlechtshof zwischen den vor#?'
vT ™ EPimereng™PP“ - ^ Genitalöffnung ist 0,18 mm lang und besitzt keine seitlichen
Chitmklappen. Jeder Lefzenrand trä g t zahlreiche (3 0 -3 6 ) gestielte, knopfartige Genitalnapfe.
Zwischen denselben verstreut treten einzelne Borsten auf.
M ä n n c h e n kleiner.
I ’“ n d o r t : Der Scheidebaeh bei Geyersdorf (Mittleres Erzgebirge bei Annaberg) und
die Bache bei Ziegenrück (Südende des Thüringer Waldes).
G e o g ra p h is c h e V e rb r e itu n g : Deutschland (Piersig).
L e b e n sw e is e : Protzia inmlmris Piersig lebt ähnlich wie die Vergleichsart in s tark fliessen-
en e irgabächen. Ih r liebster Aufenthalt daselbst ist das an die Steine geheftete untergetauchte
Wassermoos, in dem sie in der Gesellschaft von Sperc/m«-Arten, von Panisus torrenticolus Piersig
und Aturus .scaber Kramer von Juni bis September auftritt.
E n tw i c k e lu n g : Die rötlich gefärbten Eier werden an die Moosblättchen in Haufen von
10 20 Stück abgesetzt. Larve und Nymphe sind noch unbekannt.
3. Unterfamilie: Eylainae.
Kiefertaster (Palpen) der geschlechtsreifen Form und der Nymphe fünfgliedrig, letztes
Glied stumpf endigend oder mit kurzen Borsten besetzt. Mandibeln zweigliedrig, Hakenglied stark
gebogen, mit abgestumpfter Spitze. Maxillarorgan mit s tark gekürztem Schnabelteil, die sang-
scheibenartige, kreisrunde Mundüffnung auf der Unterseite tragend. Doppelaugen in Chitinkapseln
eingeschlossen, entweder einander stark genähert und die Kapseln durch eine Chitinbrncke ver-
bunden (Eylais) oder von einander abgerückt wie bei Ihyas (Piersigia). G-eschlechtshof weit nach
vorn gerückt (Eylais) oder zwischen den hintern Hüftplattengruppen gelegen, mit oder ohne
Genitalnäpfe. Schwimmhaare an den drei vordern Beinpaaren vorhanden (Eylais) oder gänzlich
fehlend (Piersigia).
Sechsfüssige Larve der G attung Eylais mit kleinem, dem Kumpfe beweglich angegliedertem
Scheinköpfchen (Capitulum): Taster fünfgliedrig, das fünfte Glied dem vierten am Grunde seitlich
angefügt, krallenförmig, das vierte nach vorn in einen langen, zapfenförmig zugespitzten, mit Borsten
besetzten Fortsatz auslaufend ; dieser mit einem basalen, dolchartigen Seitenstachel; Mundöffnung
an der Spitze des Scheinköpfchens gelegen; Mandibeln zweigliedrig; die Hüftplatten der zwei
vordern Beinpaare jederseits am innern Ende verschmolzen, dritte Pla tte frei; die Füsse ohne
Schwimmhaare, dagegen mit zahlreichen Borsten besetzt, mit drei verschieden grossen Krallen;
zwei seitlich gestellte, grosse Doppelaugen mit kugligen Linsen ; Haut weich, ohne Rückenschild,
aber mit langen, reihweis geordneten, gefiederten Borsten. — Die Larve steigt auf die Wasseroberfläche
empor und lebt bis zur nächsten Häutung parasitisch an Luftinsekten. — Mit nur
zwei Gattungen.
XXXV. Genus: Ey l a i s L a t r e i l l e .
Eylais Latreille, Précis des Caractères des Insectes, pag. 182.
Eylais C. L. Koch, Übersicht des Arachnidensystems, H. 3, S. 33.
Eylais Bruzelius, Beskr. ö. Hydrachnider, som förek. i Skane, S. 51.
Eylais Kramer, Beitrag zur Naturgeschichte der Hydrach., Bd. I, S. 313, Archiv
für Naturgeschichte.
Eylais Krendowskij, Metamorphose der Wasserrailben, Kharkow (russisch), S. 8—9.
13—15,
Eylais Croneberg, Über die Anatomie von Eylais extendens etc. (Russisch) Moskau.
S. 6—37, Taf. I, Fig. 1—8, 12—14, 1 6 -2 0 ; Taf. II , Fig. 21—24, 27—28, 3 6 -3 8 ;
Taf. II I, Fig. 39—40, 46—51.
Eylais Neuman, Om Sveriges Hydrachnider, Kongl. Sv. Vet. Akad. Handlingar, S. 105.
Eylais Haller, Wiegmann, Archiv für Naturgeschichte.
Eylais Krendowskij, Les acariens deau douce de la Russie méridionale: Travaux de
la Soc. d. natur. à l’Univ. Imp. de Kharkow, Bd. XVUI, S. 351—352.
Syn. 1796.
1842.
1854.
1875.
Der massig gewölbte eiförmige Körper besitzt eine weiche Haut, die sich aus einer dünnen,
auf der Oberfläche wellig liniierten, fast farblosen Cuticula und einem pigmenttragenden Unterhautzellgewebe
zusammensetzt. Die beiden Doppelaugen sind median eng nebeneinander gerückt und in
zwei kompliziert gebaute Chitinkapseln eingeschlossen, zwischen denen sich eine mehr oder weniger
.breite Verbindungsleiste (Augenbrücke) hinzieht, sodass eine Augenplatte entsteht, die in ihrer
Form an eine Brille erinnert. Charakteristischerweise ist der von den verschmolzenen Maxillen gebildete
Mundkegel ungemein gekürzt. Die denselben durchbrechende Mundöffnung liegt entfernt vom
schnabelförmig vorspringenden Vorderende auf der Mitte der Unterseite und bildet einen grossen,
kreisförmigen Durchlass, dessen Rand mit einem Kranze feiner Haare versehen ist und augenscheinlich
eine perforierte Saugscheibe darstellt. Die reichbeborsteten Maxillartaster zeichnen
18.78.
1878.
1879.
1882.
1884.