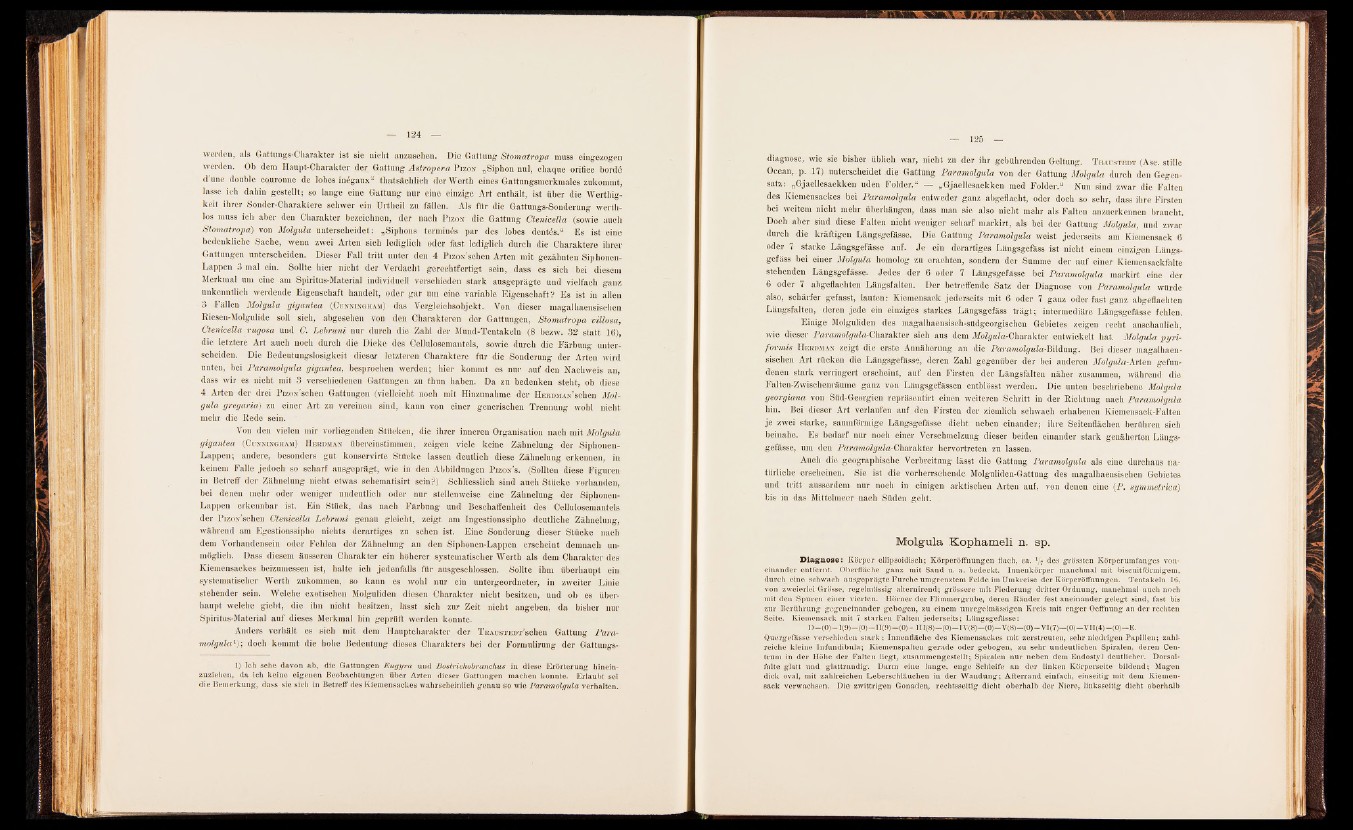
werden, als Gattungs-Charakter ist sie nicht anzusehen. Die Gattung Stomatropa muss eingezogen
werden. Ob dem Haupt-Charakter der. Gattung Astropera Pizos „Siphon nul, chaque orifice bordl
d'une double couronne de lobes inégaux“ thatsächlich der Werth eines Gattungsmerkmales, zukommt,
lasse ich dahin gestellt; so lange eine Gattung nur eine einzige Art enthält, ist über die Werthig-
keit ihrer Sonder-Charaktere schwer ein Urtheil zu fidlen. Als für die Gattungs-Sonderung werthlos
muss ich aber den Charakter bezeichnen, der nach P iz o k die Gattung Ctenicella (sowie auch
Stomatropa) von Molgula unterscheidet äs .„Siphons terminés par des lobes dentés.“ Es ist eine
bedenkliche Sache, wenn zwei Arten sich lediglich oder fast lediglich durch die Charaktere ihrer
Gattungen unterscheiden. Dieser Fall tritt unter den 4 Pizoii’schen Arten mit gezähnten Siphonen-
Lappen 3 mal ein. Sollte hier nicht der Verdacht gerechtfertigt sein, dass es sieh bei diesem
Merkmal um eine am Spiritus-Material individuell verschieden stark ausgeprägte und vielfach ganz
unkenntlich werdende Eigenschaft handelt, oder gar um eine variable Eigenschaft? Es ist in allen
3 Fällen Molgula gigantea (C o n n in o h a m ) das Verglëiéhsobjekt. Von dieser magalhaensischen
Eiesen-Molgulide soll sich, abgesehen von den Charakteren der Gattungen, Stomatropa viUosa,
Ctenicella rugosa und C. Lebruni nur durch die Zahl der Mund-Tentakeln (8 be/.vv. 32 statt 16),
die letztere Art auch noch durch die Dicke des Cellulosemantels, sowie durch die Färbung unterscheiden.
Die Bedeutungslosigkeit dieser letzteren Charaktere für die Sonderung der Arten wird
unten, bei Paramolgula gigantea, besprochen werden; hier kommt es nur auf den Nachweis an,
dass wir es nicht mit 3 verschiedenen Gattungen zu thun haben. Da zu bedenken steht, ob diese
4 Arten der drei PizoN’schen Gattungen (vielleicht noch mit Hinzunahme der HERDMAii'schen Molgula
gregaria) zu einer Art zu vereinen sind, kann von einer generischen Trennung wohl’" nicht
mehr die Rede sein.
Von den vielen mir vorliegenden Stücken, die ihrer inneren Organisation nach mit Molgula
gigantea (C o n n in g h a m ) H e r d m a n übereinstimmen, zeigen viele keine Zähnelung der Siphonen-
Lappen; andere, besonders gut konservirte Stücke lassen deutlich diese Zähnelung erkennen, in
keinem Falle jedoch so scharf ausgeprägt, wie im den Abbildungen Pizosr’s. .(Sollten diese Figuren
in Betreff der Zähnelung nicht etwas schematisirt sein?) Schliesslich sind auch Stücke vorhanden,
bei denen mehr oder weniger undeutlich oder nur stellenweise eine Zähnelung dj|g Siphonen-
Lappen erkennbar ist. Ein Stück, das nach Färbung und Beschaffenheit des Cellulosemantels
der Pizou'schen Ctenicella Lebruni genau gleicht, zeigt am Ingestionssipho deutliche Zähnelung,
während am Egestionssipho nichts derartiges (Szu sehen ist. Eine Sonderung dieser Stücke nach
dem Vorhandensein oder Fehlen der Zähnelung an den Siphonen-Lappen erscheint demnach unmöglich.
Dass diesem äusseren Charakter ein höherer systematischer Werth als dem Charakter des
Kiemensackes .beizumessen ist, halte ich jedenfalls für ausgeschlossen. Sollte ihm überhaupt ein
systematischer Werth zukommen, so kann es wohl nur ein untergeordneter, in zweiter Linie
stehender sein. Welche exotischen Molguliden diesen Charakter nicht besitzen, und ob es überhaupt
welche giebt, die ihn nicht besitzen, lässt sich znr Zeit nicht angeben, da bisher nur
Spiritus-Material auf dieses Merkmal hin geprüft werden konnte.
Anders verhält es sich mit dem Hauptcharakter der TßAusTEDT'schen Gattung Paramolgula1)
; doch kommt die hohe Bedeutung dieses Charakters bei der Formulirung der Gattungs1)
Ich seh e d avon ab, d ie Gattungen E u g y r a u nd B o strich o b ran ch us in d ie se Erörterung hineinzu
ziehen, da ich k e in e eig en en B eobachtungen ü be r Arten die ser Gattungen machen konnte. Erlaubt sei
d ie Bemerkung, dass s ie sich in Betreff des Kiemensackes wahrscheinlich g en a u so w ie P a ram o lg u la verhalten..
diagnose, wie sie bisher üblich war, nicht zu der ihr gebührenden Geltung. Traustedt (Asc. stille
Oeean, p. J.T) .unterscheidet .die Gattung Paramolgula von der Gattung Molgala durch den Gegensatz;.
„Gjaellesaekken uden Folder.“ — „Gjaeltesaekken raed Folder.“ Nun sind zwar die Falten
des Kiemensackes bei Paramolgula entweder ganz abgeflacht, oder doch so sehr, dass ihre Firsten
bei weitem nicht mehr Überhängen, dass man sie also nicht mehr als Falten anznerkennen braucht.
Doch aber sind diese Falten nicht weniger scharf markirt, als bei der Gattung Molgula, und zwar
durch die kräftigen Längsgefässe. Die Gattung Paramolgula weist jederseits am Kiemensack 6
oder 7 starke Längsgefässe auf. Je ein derartiges Längsgefiiss ist nicht einem einzigen Längs-
gefäss bei einer Molgula homolog zu erachten, sondern der Summe der auf einer Kiemensackfalte
stehenden Längsgefässe. Jedes der 6 oder 7 Längsgefässe bei Paramolgula markirt eine der
6 oder 7 abgeflachten Längsfalten. Der betreffende Satz der Diagnose von Paramolgula würde
also, schärfer gefasst, lauten r Kiemensack jederseits m iH oder 7 ganz oder fast ganz abgeflachten
Längsfalten, deren jede ein einziges starkes Längsgefäss trägt; intermediäre Längsgefässe fehlen.
Einige Molguliden des magalhaensisch-sttdgeorgischen Gebietes zeigen recht anschaulich,
wie dieser ParamolgulaOuasktcr sich aus dem AfoZpa&Gharakter entwickelt hat. Molgula pyri-
formis HEäpMAti zeigt die erste. Annäherung an die Paramolgula-Bildung. Bei diekei- magalhaen-
sisehen Art rücken die Längsgefässe, deren Zahl gegenüber der bei anderen Molgula-Arten gefundenen
stark verringert erscheint, auf den Firsten der Längsfalten näher zusammen, während die
Falten-Zwischehräume ganz von Längsgef&ssen entblösst werden. Die nnten beschriebene Molgula
georgiana von Süd-Georgien repräsentirt einen weiteren Schritt in der Richtung nach Paramolgula
b iÄ Bei dieser Art verlaufen auf den Firsten der ziemlich schwach erhabenen Kiemensack-Falten
je zwei starke, saumförmige Längsgefässe dicht neben einander; ihre Seitenflächen berühren sich
beinahe^).; Es bedarf nur noch einer Verschmelzung dieser beiden einander stark genäherten Längs-
gefasse, um den Paramolgula- Charakter hervortreten zü lassen.
Auch die geographische Verbreitung lässt die Gattung Paramolgula als eine durchaus natürliche
erscheinen. Sie ist die vorherrschende Molguliden-Gattung des magalhaensischen Gebietes
und tritt ausserdem nur noch in einigen arktischen Arten auf, von denen eine (P. symmetrica)
bis in das Mittelmeer nach Süden geht. .
Molgula K o p h am e li n. sp.
D i a g n o s e : Körper ellipsoidisch; Körperöffnungen flach, ca. V7 des grössten Körperumfanges voneinander
entfernt. Obei*fläche g a n z mit Sand u. a. bedeckt. Innenkörper manchmal mit biseuitförmigem,
durch e in e schwach a u sg ep rä g te Furche umgrenztem Felde im Umkreise der Körperöffnungen. Tentakeln 16,
von zweierlei Grösse, re g elmä ssig alternirend; g rö sse re mit Fiederung dritter Ordnung, manchmal auch noch
mit den Spuren ein er vierten. Hörner der Flimmergrube, deren Ränder fe st aneinander g e le g t sind, fast bis
zur Berührung g eg en e in an d e r g eb o g en , zu einem unr egelmässigen Kreis mit eng’er Oeffnung an d er rechten
S eite. Kiemensack mit 7 starken Falten jede rseits; L ä n g sg e fä s s e :
D —(0)—1(9)—(0)—11(9)—(0 ) - 111(8)—(0)—IV(8)—(0)—V(8)—(0)—VI(7)—(0)—VII(4)—(0)—E.
Q ue rge fässe verschieden stark ; Innenfläche des Kiemensackes mit zerstreuten, sehr n iedrigen Papillen; zahlre
iche kle ine Infundibuia; Kiemenspalten g e r ad e oder gebog’en, zu sehr undeutlichen Spiralen, deren Centrum
in der Höhe der Falten liegt, zusammengestellt; Spiralen nur n eben dem Endostyl deutlicher. Dor salfa
lte g la tt und glattrandig. Darm e in e lang e , en g e Schle ife an der linken Körperseite bildend; Magen
dick oval, mit zahlreichen Leberschläuchen in der W an du ng; Afterrand einfach, e in seitig mit dem Kiemen sack
verwachsen. D ie zwittrigen Gonaden, re ch tsseitig dicht oberhalb der Niere, linksseitig* dicht oberhalb