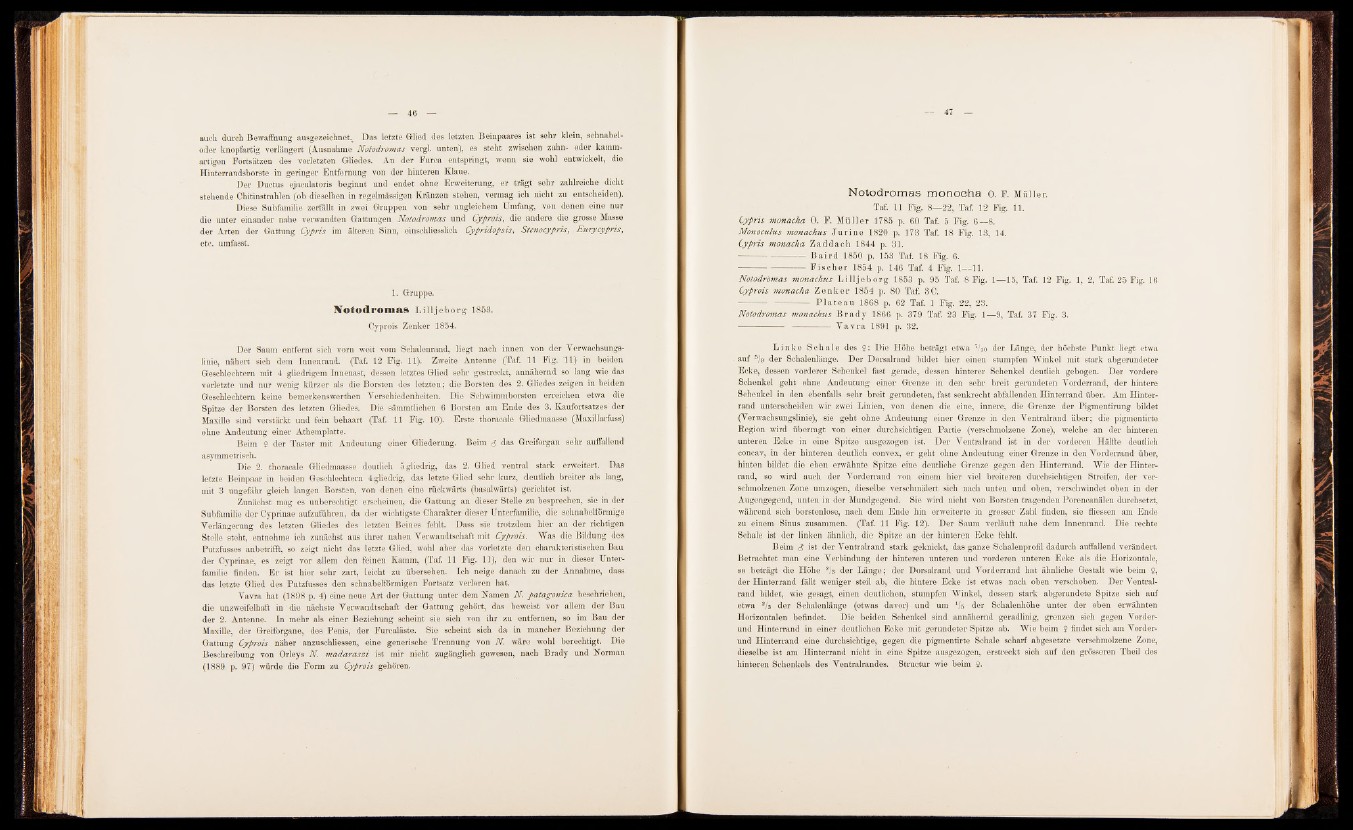
auch durch Bewaffnung ausgezeichnet.^ Das letzte Glied des letzten Beinpaares ist sehr klein, schnabel-
oder knopfartig verlängert (Ausnahme Notodromas vergl. unten), es steht zwischen zahn- oder kamm-
artigen Fortsätzen des vorletzten Gliedes. An der Furca entspringt, wenn sie wohl entwickelt, die
Hinterrandsborste in geringer Entfernung von der hinteren Klaue.
Der Ductus ejaculatoris beginnt und endet ohne Erweiterung, er trägt sehr zahlreiche dicht
stehende Chitinstrahlen (ob dieselben in regelmässigen Kränzen stehen, vermag ich nicht zu entscheiden).
Diese Subfamilie zerfällt in zwei Gruppen von sehr ungleichem Umfang, von denen eine nur
die unter einander nahe verwandten Gattungen Notodromas und Cyprois, die andere die grosse Masse
der Arten der Gattung Cypris im älteren Sinn, einschliesslich Cypridopsis, Stenocypris, Eury cypris,
etc. umfasst.
1. Gruppe.
Notodromas Li 11 j e b o r g 1858.
Cyprois Zenker 1854.
Der Saum entfernt sich vorn weit vom Schalenrand, liegt nach innen von der Verwachsungslinie,
nähert sich dem Innenrand. (Taf. 12 Fig. 11). Zweite Antenne (Taf. 11 Fig. 11) in beiden
Geschlechtern mit 4 gliedrigem Innenast, dessen letztes Glied sehr gestreckt, annähernd so lang wie das
vorletzte und nur wenig kürzer als die Borsten des letzten; die Borsten des 2. Gliedes zeigen in beiden
Geschlechtern keine bemerkenswerthen Verschiedenheiten. Die Schwimmborsten erreichen etwa die
Spitze der Borsten des letzten Gliedes. Die sämmtlichen 6 Borsten am Ende des 8. Kaufortsatzes der
Maxille sind verstärkt und fein behaart (Taf. 11 Fig. 10). Erste thoracale Gliedmaasse (Maxillarfuss)
ohne Andeutung einer Athemplatte.
Beim $ der Taster mit Andeutung einer Gliederung. Beim <J das Greiforgan sehr auffallend
asymmetrisch.
Die 2. thoracale Gliedmaasse deutlich 5 gliedrig, das 2. Glied ventral stark erweitert. Das
letzte Beinpaar in beiden Geschlechtern 4 gliedrig, das letzte Glied sehr kurz, deutlich breiter als lang,
mit 8 ungefähr gleich langen Borsten, von denen eine rückwärts (basalwärts) gerichtet ist.
Zunächst mag es unberechtigt erscheinen, die Gattung an dieser Stelle zu besprechen, sie in der
Subfamilie der Cyprinae aufzuführen, da der wichtigste Charakter dieser Unterfamilie, die schnabelförmige
Verlängerung des letzten Gliedes des letzten Beines fehlt. Dass sie trotzdem hier an der richtigen
Stelle steht, entnehme ich zunächst aus ihrer nahen Verwandtschaft mit Cyprois. Was die Bildung des
Putzfusses anbetrifft, so zeigt nicht das letzte Glied, wohl aber das vorletzte den charakteristischen Bau
der Cyprinae, es zeigt vor allem den feinen Kamm, (Taf. 11 Fig. 11), den wir nur in dieser Unterfamilie
finden. Er ist hier sehr zárt, leicht zu übersehen. Ich neige danach zu der Annahme, dass
das letzte Glied des Putzfusses den schnabelförmigen Fortsatz verloren hat.
Vavra hat (1898 p. 4) eine neue Art der Gattung unter dem Namen N. patagónica beschrieben,
die unzweifelhaft in die nächste Verwandtschaft der Gattung gehört, das beweist vor allem der Bau
der 2. Antenne. In mehr als einer Beziehung scheint sie sich von ihr zu entfernen, so im Bau der
Maxille, der Greiforgane, des Penis, der Furcaläste. Sie scheint sich da in mancher Beziehung der
Gattung Cyprois näher anzuschliessen, eine generische Trennung von N. wäre wohl berechtigt. Die
Beschreibung von Orleys N. madaraszi ist mir nicht zugänglich gewesen, nach Brady und Norman
(1889 p. 97) würde die Form zu Cyprois gehören.
N o to d rom a s m o n o e h a o. F. Müller.
Taf. 11 Fig. 8—22, Taf. 12 Fig. 11.
Cypris monacha 0. F. Müller 1785 p. 60 Taf. 5 Fig. 6—8.
Monoculus monachus J u r i ne 1820 p. 173 Taf. 18 Fig. 13, 14.
Cypris monacha Zaddach 1844 p. 31.
— B a ird 1850 p. 153 Taf. 18 Fig. 6.
-------------------- F isc h e r 1854 p. 146 Taf. 4 Fig. 1—11.
Notodromas monachus L illje b o rg 1853 p. 95 Taf. 8 Fig. lf il5 , Taf. 12 Fig. 1, 2, Taf. 25 Fig. 16
Cyprois monacha Z en k e r 1854 p. 80 Taf. 3C.
— P la te a u 1868 p. 62 Taf. 1 Fig. 22, 23.
Notodromas monachus B rad y 1866 p. 379 Taf. 23 Fig. 1—9, Taf. 37 Fig. 3.
— V avra 1891 p. 32.
L in k e Schale des $: Die Höhe beträgt etwa 7/io der Länge, der höchste Punkt liegt etwa
auf 5/9 der Schalenlänge. Der Dorsalrand bildet hier einen stumpfen Winkel mit stark abgerundeter
Ecke, dessen vorderer Schenkel fast gerade, dessen hinterer Schenkel deutlich gebogen. Der vordere
Schenkel geht ohne Andeutung einer Grenze in den sehr breit gerundeten Vorderrand, der hintere
Schenkel in den ebenfalls sehr breit gerundeten, fast senkrecht abfallenden Hinterrand über. Am Hinterrand
unterscheiden wir zwei Linien, von denen die eine, innere, die Grenze der Pigmentirung bildet
(Verwachsungslinie), sie geht ohne Andeutung einer Grenze in den Ventralrand über; die pigmentirte
Region wird überragt von einer durchsichtigen Partie (verschmolzene Zone), welche an der hinteren
unteren Ecke in eine Spitze ausgezogen ist. Der Ventralrand ist in der vorderen Hälfte deutlich
concav, in der hinteren deutlich convex, er geht ohne Andeutung einer Grenze in den Vorderrand über,
hinten bildet die eben erwähnte Spitze eine deutliche Grenze gegen den Hinterrand. Wie der Hinterrand,
so wird auch der Vorderrand von einem hier viel breiteren durchsichtigen Streifen, der verschmolzenen
Zone umzogen, dieselbe verschmälert sich nach unten und oben, verschwindet oben in der
Augengegend, unten in der Mundgegend. Sie wird nicht von Borsten tragenden Porencanälen durchsetzt,
während sich borstenlose, nach dem Ende hin erweiterte in grösser Zahl finden, sie fliessen am Ende
zu einem Sinus zusammen. (Taf. 11 Fig. 12). Der Saum verläuft nahe dem Innenrand. Die rechte
Schale ist der linken ähnlich, die Spitze an der hinteren Ecke fehlt.
Beim <J ist der Ventralrand stark geknickt, das ganze Schalenprofil dadurch auffallend verändert.
Betrachtet man eine Verbindung der hinteren unteren und vorderen unteren Ecke als die Horizontale,
so beträgt die Höhe 2/s der Länge; der Dorsalrand und Vorderrand hat ähnliche Gestalt wie beim ?,
der Hinterrand fällt weniger steil ab, die hintere Ecke ist etwas nach oben verschoben. Der Ventralrand
bildet, wie gesagt, einen deutlichen, stumpfen Winkel, dessen stark abgerundete Spitze sich auf
etwa 2/3 der Schalenlänge (etwas davor) und um Vs der Schalenhöhe unter der oben erwähnten
Horizontalen befindet. Die beiden Schenkel sind annähernd geradlinig, grenzen sich gegen Vorder-
und Hinterrand in einer deutlichen Ecke mit gerundeter Spitze ab. Wie beim $ findet sich am Vorder-
und Hinterrand eine durchsichtige, gegen die pigmentirte Schale scharf abgesetzte verschmolzene Zone,
dieselbe ist am Hinterrand nicht in eine Spitze ausgezogen, erstreckt sich auf den grösseren Theil des
hinteren Schenkels des Ventralrandes. Structur wie beim $.