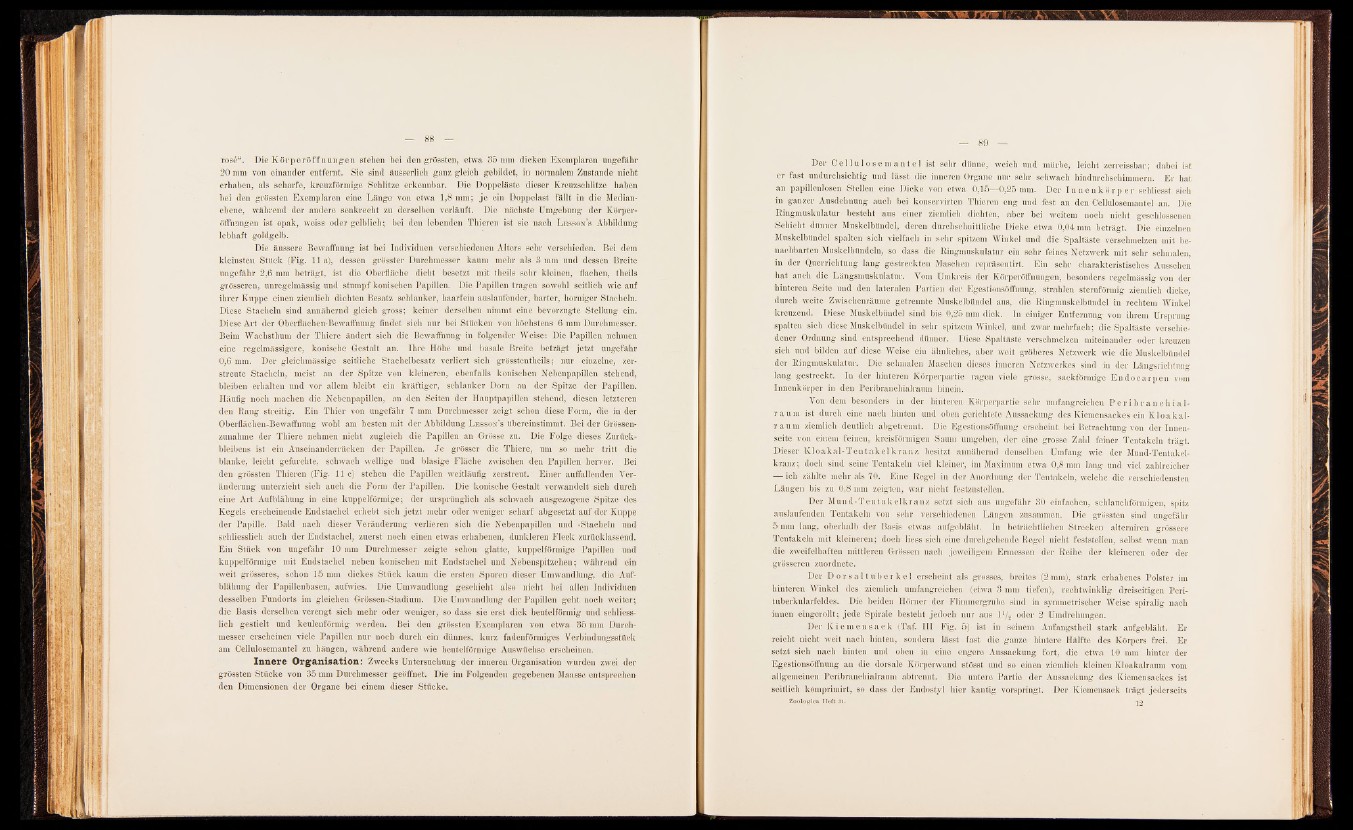
Tose“. Die Körperöffnungen stehen bei den grössten, etwa 35 mm dicken Exemplaren ungefähr
20 mm von einander entfernt. Sie sind äusserlicli ganz gleich gebildet, in normalem Zustande nicht
erhaben, als scharfe, kreuzförmige Schlitze erkennbar. Die Doppeläste dieser Kreuzschlitze haben
bei den grössten Exemplaren eine Länge von etwa 1,8 mm; je ein Doppelast fällt in die Medianebene,
während der andere senkrecht zu derselben verläuft. Die nächste Umgebung der Körperöffnungen
ist opak, weiss oder gelblich; bei den lebenden Thieren ist sie nach L esson’s Abbildung
lebhaft goldgelb.
Die äussere Bewaffnung ist bei Individuen verschiedenen Alters sehr verschieden. Bei dem
kleinsten Stiick (Fig. 11 a), dessen grösster Durchmesser kaum mehr als 3 mm und dessen Breite
ungefähr 2,6 mm beträgt, ist die Oberfläche dicht besetzt mit theils sehr kleinen, flachen, theils
grösseren, unregelmässig und stumpf konischen Papillen. Die Papillen tragen sowohl seitlich wie auf
ihrer Kuppe einen ziemlich dichten Besatz schlanker, haarfein auslaufender, harter, horniger Stacheln.
Diese Stacheln sind annähernd gleich gross; keiner derselben nimmt eine bevorzugte Stellung ein.
Diese Art der Oberflächen-Bewaffnung findet sieh nur bei Stücken von höchstens 6 mm Durchmesser.
Beim Wachsthum der Thiere ändert sich die Bewaffnung in folgender Weise: Die Papillen nehmen
eine regelmässigere, konische Gestalt an. Ihre Höhe und basale Breite beträgt jetzt ungefähr
0,6 mm. Der gleichmässige seitliche Stachelbesatz verliert sich grösstentheils; nur einzelne, zerstreute
Stacheln, meist an der Spitze von kleineren, ebenfalls konischen Nebenpapillen stehend,
bleiben erhalten und vor allem bleibt ein kräftiger, schlanker Dorn an der Spitze der Papillen.
Häufig noch machen die Nebenpapillen, an den Seiten der Hauptpapillen stehend, diesen letzteren
den Rang streitig. Ein Thier von ungefähr 7 mm Durchmesser zeigt schon diese Form, die in der
Oberflächen-Bewaffnung wohl am besten mit der Abbildung L esson’s übereinstimmt. Bei der Grössenzunahme
der Thiere nehmen nicht zugleich die Papillen an Grösse zu. Die Folge dieses Zurückbleibens
ist ein Auseinanderrücken der Papillen. Je grösser die Thiere, um so mehr tritt die
blanke, leicht gefurchte, schwach wellige und blasige Fläche zwischen den Papillen hervor. Bei
den grössten Thieren (Fig. 11c) stehen die Papillen weitläufig zerstreut. Einer auffallenden Veränderung
unterzieht sich auch die Form der Papillen. Die konische Gestalt verwandelt sich durch
eine Art Aufblähung in eine kuppelförmige; der ursprünglich als schwach ausgezogene Spitze des
Kegels erscheinende Endstachel erhebt sich jetzt mehr oder weniger scharf abgesetzt auf der Kuppe
der Papille. Bald nach dieser Veränderung verlieren sich die Nebenpapillen und -Stacheln und
schliesslich auch der Endstachel, zuerst noch einen etwas erhabenen, dunkleren Fleck zurücklassend.
Ein Stück von ungefähr 10 mm Durchmesser zeigte schon glatte, kuppelförmige Papillen und
kuppelförmige mit Endstachel neben konischen mit Endstachel und Nebenspitzchen; während ein
weit grösseres, schon 15 mm dickes Stück kaum die ersten Spuren dieser Umwandlung, die -Aufblähung
der Papillenbasen, aufwies. Die Umwandlung geschieht also nicht bei allen Individuen
desselben Fundorts im gleichen Grössen-Stadium. Die Umwandlung der Papillen geht noch weiter;
die Basis derselben verengt sich mehr oder weniger, so dass sie erst dick beutelförmig und schliesslich
gestielt und keulenförmig werden. Bei den grössten Exemplaren von etwa 35 mm Durchmesser
erscheinen viele Papillen nur noch durch ein dünnes, kurz fadenförmiges Verbindungsstück
am Cellulosemantel zu hängen, während andere wie beutelförmige Auswüchse erscheinen.
Innere Organisation: Zwecks Untersuchung der inneren Organisation wurden zwei der
grössten Stücke von 35 mm Durchmesser geöffnet. Die im Folgenden gegebenen Maasse entsprechen
den Dimensionen der Organe bei einem dieser Stücke.
Der Ce l l u l o s e man t el ist sehr dünne, weich und mürbe, leicht zerreissbar; dabei ist
er fast undurchsichtig und lässt die inneren Organe nur sehr schwach hindurchschimmern. Er hat
an papillenlosen Stellen eine Dicke von etwa 0,15—0,25 mm. Der I n n e n k ö r p e r schliesst sich
in ganzer Ausdehnung auch bei konservirten Thieren eng und fest an den Cellulosemantel an. Die
Ringmuskulatur besteht aus einer ziemlich dichten, aber bei weitem noch nicht geschlossenen
Schicht dünner Muskelbündel, deren durchschnittliche Dicke etwa 0,04 mm beträgt. Die einzelnen
Muskelbündel spalten sich vielfach in sehr spitzem Winkel und die Spaltäste verschmelzen mit benachbarten
Muskelbündeln, so dass die Ringmuskulatur ein sehr feines Netzwerk mit sehr schmalen,
in der Querrichtung lang gestreckten Maschen repräsentirfe l Ein sehr charakteristisches Aussehen
hat auch die Längsmuskulätur. Vom Umkreis der Körperöffnungen, besonders regelmässig von der
hinteren Seite und den lateralen Partien der Egestionsöffnung, strahlen sternförmig ziemlich dicke,
durch weite Zwischenräume getrennte Muskelbündel aus, die Ringmuskelbündel in rechtem Winkel
kreuzend. Diese Muskelbündel sind bis 0,25 mm dick. In einiger Entfernung von ihrem Ursprung
spalten sich diese Muskelbündel in sehr spitzem Winkel, und zwar mehrfach; die Spaltäste verschiedener
Ordnung sind entsprechend dünner. Diese Spaltäste verschmelzen miteinander oder kreuzen
sich- und bilden auf diese Weise ein ähnliches) aber weit gröberes Netzwerk wie die Muskelbündel
der Ringmuskulatur. Die schmalen Maschen dieses inneren Netzwerkes sind in der Längsrichtung
lang gestreckt. In der hinteren Körperpartie ragen viele grosse, sackförmige Endocarpen vom
Innenkörper in den Peribranchialraum hinein.
Von dem besonders in der hinteren Körperpartie sehr umfangreichen P e r i b r a n c h i a l raum
ist durch:eine nach hinten und oben gerichtete Aussackung des Kiemensackes ein Kloakal-
r a u m ziemlich deutlich abgetrennt. Die Egestionsöffnung erscheint bei Betrachtung von der Innenseite
von einem feinen, kreisförmigen Saum umgeben, der eine grosse Zahl feiner Tentakeln trägt.
Dieser Kloakal -Tentakelkranz besitzt annähernd denselben Umfang wie der Mund-Tentakelkranz;
doch sind seine Tentakeln viel kleiner, im Maximum etwa 0,8 mm lang und viel zahlreicher
— ich zählte mehr als 70. Eine Regel in der Anordnung der Tentakeln, welche die verschiedensten
Längen bis zu 0,8 mm zeigten, war nicht festzustellen.
Der Mund-Tentakelkranz setzt sich aus ungefähr 30 einfachen, schlauchförmigen, spitz
auslaufenden Tentakeln von sehr verschiedenen Längen zusammen. Die grössten sind ungefähr
5 mm lang, oberhalb der Basis etwas aufgebläht. In beträchtlichen Strecken alterniren grössere
Tentakeln mit kleineren; doch liess sich eine durchgehende Regel nicht feststellen, selbst wenn man
die zweifelhaften mittleren Grössen nach jeweiligem Ermessen der Reihe der kleineren oder der
grösseren zuordnete.
Der Do r s a l tu ' b e r k e l erscheint als grosses, breites (2 mm), stark erhabenes Polster im
hinteren Winkel des ziemlich umfangreichen (etwa 3 mm tiefen), rechtwinklig dreiseitigen Peri-
tuberkularfeldes. Die beiden Hörner der Flimmergrube sind in symmetrischer Weise spiralig nach
innen eingerollt; jede Spirale besteht jedoch nur aus l l/2 oder 2 Umdrehungen.
Der Ki eme n s a c k (Taf. III Fig. 5) ist in seinem Anfangstheil stark aufgebläht. Er
reicht nicht weit nach hinten, sondern lässt fast die ganze hintere Hälfte des Körpers frei. Er
setzt sich nach hinten und oben in eine engere Aussackung fort, die etwa 10 mm hinter der
Egestionsöffnung an die dorsale Körperwand stösst und so einen ziemlich kleinen Kloakalraum vom
allgemeinen Peribranchialraum abtrennt. Die untere Partie der Aussackung des Kiemensackes ist
seitlich komprimirt, so dass der Endostyl hier kantig vorspringt. Der Kiemensack trägt jederseits
Z o o lo g ic a H e f t 31. j g