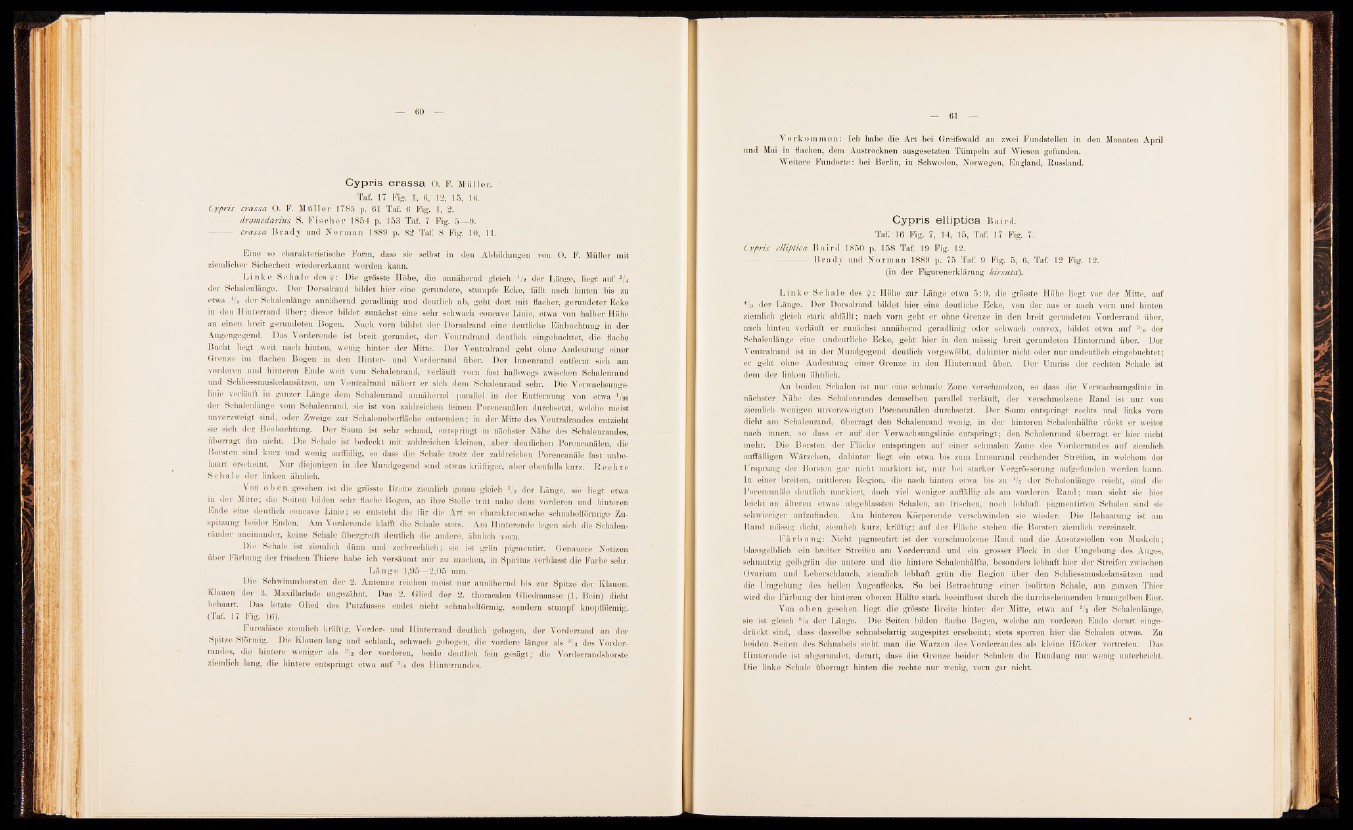
Cypris e r a s s a 0. P. Müller.
Taf. 17 Kg. 1, 6, 12, 15, 16.
Cypris crassa 0. F. Müller 1785 p. 61 Taf. 6 Fig. 1, 2.
— dromedarius S. F isch e r 1854 p. 153 Taf. 7 Fig. 5—9.
— crassa Brady und Norman 1889 p. 82 Taf. 8 Fig. 10, 11.
Eine so charakteristische Form, dass sie selbst in den Abbildungen von 0. F. Müller mit
ziemlicher Sicherheit wiedererkannt werden kann.
L in k e Schale des?: Die grösste Höhe, die annähernd gleich '/g der Länge, liegt auf SU
der Schalenlänge. Der Dorsalrand bildet hier eine gerundete, stumpfe Ecke, fällt nach hinten bis zu
etwa 4/5 der Schalenlänge annähernd geradlinig und deutlich ab, geht dort mit flacher, gerundeter Ecke
in den Hinterrand über; dieser bildet zunächst eine sehr schwach concave Linie, etwa von halber Höhe
an einen breit gerundeten Bogen. Nach vorn bildet der Dorsalrand eine deutliche Einbuchtung in der
Augengegend. Das Yorderende ist breit gerundet, der Ventralrand deutlich eingebuchtet, die flache
Bucht liegt weit nach hinten, wenig hinter der Mitte. Der Ventralrand geht ohne Andeutung einer
Grenze im flachen Bogen in den Hinter- und Vorderrand über. Der Innenrand entfernt sich am
vorderen und hinteren Ende weit vom Schalenrand, verläuft vorn fast halbwegs zwischen Schalenrand
und Schliessmuskelansätzen, am Ventralrand nähert er sieh dem Schalenrand sehr. Die Verwachsungslinie
verläuft in ganzer Länge dem Schalenrand annähernd parallel in der Entfernung von etwa 1/ao
der Schalenlänge vom Sehalenrand, sie ist von zahlreichen feinen Porencanälen durchsetzt, welche meist:,
unverzweigt sind, oder Zweige zur Schalenoberfläche entsenden; in der Mitte des Ventralrandes entzieht
sie sich der Beobachtung. Der Saum ist sehr schmal, entspringt in nächster Nähe des Schalönrandes,
überragt ihn nicht. Die Schale ist bedeckt mit zahlreichen kleinen, aber deutlichen Porencanälen, die
Borsten sind kurz und wenig au Hallig, so dass die Schale trotz der zahlreichen Poreucanälo fast unbehaart
erscheint. Nur diejenigen in der Mundgegend sind etwas kräftiger, aber ebenfalls kurz. Re chte
Schale der linken ähnlich.
Von oben gesehen ist die grösste Breite ziemlich genau gleich '/•> der Länge, sie liegt etwa
in der Mitte; die Seiten bilden sehr flache Bogen, an ihre Stelle tritt nahe dem vorderen und hinteren
Ende eine deutlich concave Linie; so entsteht die für die Art so charakteristische schnabelförmige Zuspitzung
beider Enden. Am Vorderende klafft die Schale stets. Am Hinterende legen sich die Schalenränder
aneinander, keine Schale übergreift deutlich die andere, ähnlich vom.
Die Schale ist ziemlich dünn und zerbrechlich; sie ist grün pigmentirt. Genauere Notizen
über Färbung der frischen Thiere habe ich versäumt mir zu machen, in Spiritus verblasst die Farbe sehr.
Länge 1,95—2,05 mm.
Die Schwimmborsten der 2. Antenne reichen meist nur annähernd bis zur Spitze der Klauen.
Klauen der 3. Maxillarlade ungezähnt. Das 2. Glied der 2. thoracalen Gliedrriaasse (1. Bein) dicht
behaart. Das letzte Glied des Putzfusses endet nicht schnabelförmig, sondern stumpf knopfförmig
(Taf. 17 Fig. 16).
Furcaläste ziemlich kräftig, Vorder- und Hinterrand deutlich gebogen, der Vorderrand an der
Spitze Sförmig. Die Klauen lang und schlank, schwach gebogen, die vordere länger als s/s des Vorder-
randes, die hintere weniger als '-|j der vorderen, beide deutlich fein gesägt; die Vorderrandsborste
ziemlich lang, die hintere entspringt etwa auf 7/s des Hinterrandes
1
— Ö l -
Vorkommen: Ich habe die Art bei Greifswald an zwei Fundstellen in den Monaten April
und Mai in flachen, dem Austrocknen ausgesetzten Tümpeln auf Wiesen gefunden.
Weitere Fundorte: bei Berlin, in Schweden, Norwegen, England, Russland.
Cypris elliptiea Baird.
Taf. 16 Fig. 7, 14, 15, Taf. 17 Fig. 7.
Cypris elliptiea Ba ird 1850 p. 158 Taf. 19 Fig. 12.
- B rady und Norman 1889 p. 75 Taf. 9 Fig. 5, 6, Taf. 12 Fig. 12.
(in der Figurenerklärung hirsutd).
■ L in k e Schale des ?: Höhe zur Länge etwa 5:9, die grösste Höhe liegt vor der Mitte, auf
*19 der Länge. Der Dorsalrand bildet hier eine deutliche Ecke, von der aus er nach vorn und hinten
ziemlich gleich stark abfällt; nach yorn geht er ohne Grenze in den breit gerundeten Vorderrand über,
nach hinten verläuft er zunächst annähernd geradlinig oder schwach convex, bildet etwa auf 5le der
Schalenlänge eine undeutliche Ecke, geht hier in den massig breit gerundeten Hinterrand über. Der
Ventralrand ist in der Mundgegend deutlich vorgewölbt, dahinter nicht oder nur undeutlich eingebuchtet;
er geht ohne Andeutung einer Grenze in den Hinterrand über. Der Umriss der rechten Schale ist
dem der linken ähnlich.
An beiden Schalen ist nur eine schmale Zone verschmolzen, so dass die Verwachsungslinie in
nächster Nähe des Schalenrandes demselben parallel verläuft, der verschmolzene Rand ist nur von
ziemlich wenigen unverzweigten Porencanälen durchsetzt. Der Saum entspringt rechts und links vorn
dicht am Schalenrand, überragt den Schalenrand wenig, in der hinteren Schalenhälfte' rückt er weiter
nach innen, so dass er auf der Verwachsungslinie entspringt; den Schalenrand überragt er hier nicht
mehr. Die Borsten der Fläche entspringen auf einer schmälen Zone des Vorderrandes auf ziemlich
auffälligen Wärzchen, dahinter liegt ein etwa bis zum Innenrand reichender Streifen, in welchem der
Ursprung der Borsten gar nicht markiert ist, nur bei starker Vergrösserung aufgefunden werden kann.
In einer breiten, mittleren Region, die nach hinten etwa bis zu 4/ö der Schalenlänge reicht, sind die
Porencanäle deutlich markiert, doch viel weniger auffällig als am vorderen Rand; man sieht sie hier
leicht an älteren etwas abgeblassten Schalen, an frischen, noch lebhaft pigmentirten Schalen sind sie
schwieriger aufzufinden. Am hinteren Körperende verschwinden sie wieder. Die Behaarung ist am
Rand massig dicht, ziemlich kurz, kräftig; auf der Fläche stehen die Borsten ziemlich vereinzelt.
F ä rb u n g : Nicht pigmentirt ist der verschmolzene Rand und die Ansatzstellen von Muskeln;
blassgelblich ein breiter Streifen am Vorderrand und ein grösser Fleck in der Umgebung des Auges,
schmutzig gelbgrün die untere und die hintere Schalenhälfte, besonders lebhaft hier der Streifen zwischen
Ovarium und Leberschlauch, ziemlich lebhaft grün die Region über den Schliessmuskelansätzen und
die Umgebung des hellen Augenflecks. So bei Betrachtung einer isölirten Schale, am ganzen Thier
wird die Färbung der hinteren oberen Hälfte stark beeinflusst durch die durchscheinenden braungelben Eier.
Von oben gesehen liegt die grösste Breite hinter der Mitte, etwa auf 2/s der S< jhalenlänge,
sie ist gleich ö/9 der Länge. Die Seiten bilden flache Bogen, welche am vorderen Ende derart eingedrückt
sind, dass dasselbe schnabelartig zugespitzt erscheint; stets sperren hier die Schalen etwas. Zu
beiden Seiten des Schnabels sieht man die Warzen des Vorderrandes als kleine Höckei vortreten. Das
Hinterende ist abgerundet, derart, dass die Grenze beider Schalen die Rundung nur wenig unterbricht.
Die'linke Schale überragt hinten die rechte nur wenig, vorn gar nicht.