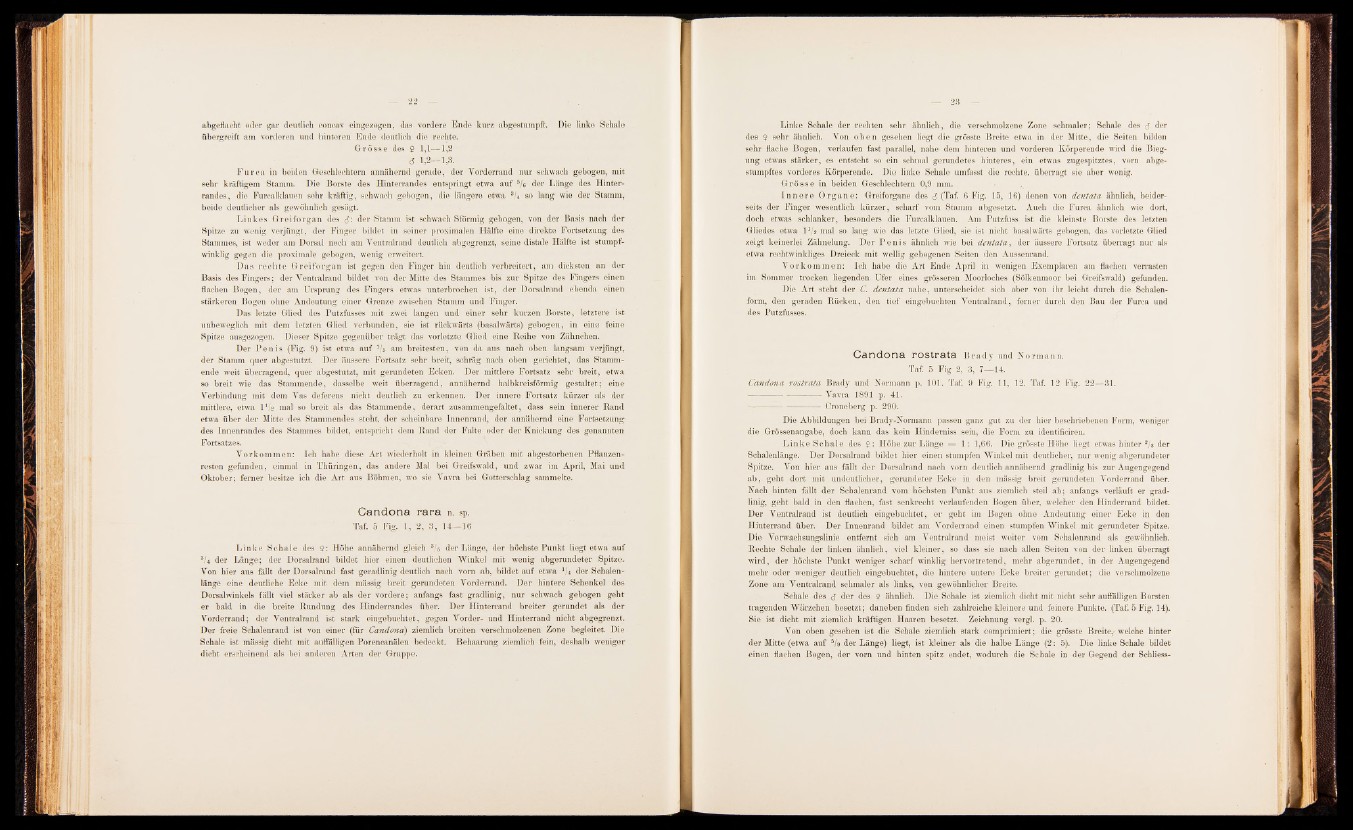
abgeflacht oder gar deutlich concav eingezogen, das vordere Ende kurz abgestumpft. Die linke Schale
übergreift am vorderen und hinteren Ende deutlich die rechte.
Grösse des $ 1,1—1,2
<J 1,2—1,3.
F ü r ca in beiden Geschlechtern annähernd gerade, der Vorderrand nur schwach gebogen, mit
sehr kräftigem Stamm. Die Borste des Hinterrandes entspringt etwa auf 5/6 der Länge des Hinterrandes,
die Furcalklauen sehr kräftig, schwach gebogen, die längere etwa 3U so lang wie der Stamm,
beide deutlicher als gewöhnlich gesägt.
Linkes Greiforgan des der Stamm ist schwach Sförmig gebogen, von der Basis nach der
Spitze zu wenig verjüngt, der Finger bildet in seiner proximalen Hälfte eine direkte Fortsetzung des.
Stammes, ist weder am Dorsal noch am Ventralrand deutlich abgegrenzt, seine distale Hälfte ist stumpfwinklig
gegen die proximale gebogen, wenig erweitert.
Das rechte Greiforgan ist gegen den Finger hin deutlich verbreitert, am dicksten an der
Basis des Fingers; der Ventralrand bildet von der Mitte des Stammes bis zur Spitze des Fingers einen
flachen Bogen, der am Ursprung des Fingers etwas unterbrochen ist, der Dorsalrand ebenda einen
stärkeren Bogen ohne Andeutung einer Grenze zwischen Stamm und Finger.
Das letzte Glied des Putzfusses mit zwei langen und einer sehr kurzen Borste, letztere ist
unbeweglich mit dem letzten Glied verbunden, sie ist rückwärts (basalwärts) gebogen, in eine feine
Spitze ausgezogen. Dieser Spitze gegenüber trägt das vorletzte Glied eine Reihe von Zähnchen.
Der P e n is (Fig. 9) ist etwa auf Vs am breitesten, von da aus nach oben langsam verjüngt,
der Stamm quer abgestutzt. Der äussere Fortsatz sehr breit, schräg nach oben gerichtet, das Stammende
weit überragend, quer abgestutzt, mit gerundeten Ecken. Der mittlere Fortsatz sehr breit, etwa
so breit wie das Stammende, dasselbe weit überragend, annähernd halbkreisförmig gestaltet; eine
Verbindung mit dem Vas deferens nicht deutlich zu erkennen. Der innere Fortsatz kürzer als der
mittlere, etwa 1V2 mal so breit als das Stammende, derart zusammengefaltet, dass sein innerer Rand
etwa über der Mitte des Stammendes steht, der scheinbare Innenrand, der annähernd eine Fortsetzung-
des Innenrandes des Stammes bildet, entspricht dem Rand der Falte oder der Knickung des genannten
Fortsatzes.
Vorkommen: Ich habe diese Art wiederholt in kleinen Gräben mit abgestorbenen Pflanzenresten
gefunden, einmal in Thüringen, das andere Mal bei Greifswald, und zwar im April, Mai und
Oktober; ferner besitze ich die Art aus Böhmen, wo sie Vavra bei Gotterschlag sammelte.
C a n d o n a r a r a n. sp.
Taf. 5 Fig. 1, 2, 3, 14—16
Linke Schale des $: Höhe annähernd gleich 3/s der Länge, der höchste Punkt liegt etwa auf
der Länge; der Dorsalränd bildet hier einen deutlichen Winkel mit wenig abgerundeter Spitze.
Von hier aus fallt der Dorsalrand fast geradlinig deutlich nach vorn ab, bildet auf etwa */* der Schalenlänge
eine deutliche Ecke mit dem mässig breit gerundeten Vorderrand. Der hintere Schenkel des
Dorsatwinkels fällt viel stärker ab als der vordere; anfangs fast gradlinig, nur schwach gebogen geht
er bald in die breite Rundung des Hinderrandes über. Der Hinterrand breiter gerundet als der
Vorderrand; der Ventralrand ist stark eingebuchtet, gegen Vorder- und Hinterrand nicht abgegrenzt.
Der freie Sehalenrand ist von einer (für Candona) ziemlich breiten verschmolzenen Zone begleitet. Die
Schale ist mässig dicht mit auffälligen Porencanälen bedeckt. Behaarung ziemlich fein, deshalb weniger
dicht erscheinend als bei anderen Arten der Gruppe.
Linke Schale der rechten sehr ähnlich,, die verschmolzene Zone schmaler; Schale des <5 der
des $ sehr ähnlich. Von oben gesehen liegt die grösste Breite etwa in der Mitte, die Seiten bilden
sehr flache Bogen, verlaufen fast parallel, nahe dem hinteren und vorderen Körperende wird die Biegung
etwas stärker, es entsteht so ein schmal gerundetes hinteres, ein etwas zugespitztes, vorn abgestumpftes
vorderes Körperende. Die linke Schale umfasst die rechte, überragt sie aber wenig.
Grösse in beiden Geschlechtern 0,9 mm.
In n e re Organe: Greiforgane des £ (Taf. 6 Fig. 15, 16) denen von dentata ähnlich, beiderseits
der Finger wesentlich kürzer, scharf vom Stamm abgesetzt. Auch die Furca ähnlich wie dort,
doch etwas schlanker, besonders die Furcalklauen. Am Putzfuss ist die kleinste Borste des letzten
Gliedes etwa U/2 mal so lang wie das letzte Glied, sie ist nicht basalwärts gebogen, das vorletzte Glied
zeigt keinerlei Zähnelung. Der P en is ähnlich wie bei dentata, der äussere Fortsatz überragt nur als
etwa rechtwinkliges Dreieck mit wellig gebogenen Seiten den Aussenrand.
Vorkommen: Ich habe die Art Ende April in wenigen Exemplaren am flachen verrasten
im Sommer trocken liegenden Ufer eines grösseren Moorloches (Sölkenmoor bei Greifswald) gefunden.
Die Art steht der C. dentata nahe, unterscheidet sich aber von ihr leicht durch die Schalenform,
den geraden Rücken, den tief eingebuchten Ventralrand, ferner durch den Bau der Furca und
des Putzfusses.
C a n d o n a ro s tra ta Brad y und Normann.
Taf. 5 Fig 2, 3, 7—14.
Candona rostrata Brady und Normann p. 101. Taf. 9 Fig. 11, 12. Taf. 12 Fig. 22—31.
— Vavra 1891 p. 41.
-------------- Croneberg p. 290.
Die Abbildungen bei Brady-Normann passen ganz gut zu der hier beschriebenen Form, weniger
die Grössenangabe, doch kann das kein Hinderniss sein, die Form zu identificiren.
Linke Schale des $: Höhe zur Länge = 1: 1,66. Die grösste Höhe liegt etwas hinter 2 ¡3 der
Schalenlänge. Der Dorsalrand bildet hier einen stumpfen Winkel mit deutlicher, nur wenig abgerundeter
Spitze. Von hier aus fällt der Dorsalrand nach vorn deutlich annähernd gradlinig bis zur Augengegend
ab, geht dort mit undeutlicher, gerundeter Ecke in den mässig breit gerundeten Vorderrand über.
Nach hinten fällt der Schalenrand vom höchsten Punkt aus ziemlich steil ab; anfangs verläuft er gradlinig,
geht bald in den flachen, fast senkrecht verlaufenden Bogen über, welcher den Hinderrand bildet.
Der Ventralrand ist deutlich eingebuchtet, er geht im Bogen ohne Andeutung einer Ecke in den
Hinterrand über. Der Innenrand bildet am Vorderrand einen stumpfen Winkel .mit gerundeter Spitze.
Die Verwachsungslinie entfernt sich am Ventralrand meist weiter vom Schalenrand als gewöhnlich.
Rechte Schale der linken ähnlich, viel kleiner, so dass sie nach allen Seiten von der linken überragt
wird, der höchste Punkt weniger scharf winklig hervortretend, mehr abgerundet, in der Augengegend
mehr oder weniger deutlich eingebuchtet, die hintere untere Ecke breiter gerundet; die verschmolzene
Zone am Ventralrand schmaler als links, von gewöhnlicher Breite.
Schale des S der des $ ähnlich. Die Schale ist ziemlich dicht mit nicht sehr auffälligen Borsten
tragenden Wärzchen besetzt; daneben finden sich zahlreiche kleinere und feinere Punkte. (Taf. 5 Fig. 14).
Sie ist dicht mit ziemlich kräftigen Haaren besetzt. Zeichnung vergl. p. 20.
Von oben gesehen ist die Schale ziemlich stark comprimiert; die grösste Breite,- welche hinter
der Mitte (etwa auf 5/9 der Länge) hegt, ist kleiner als die halbe Länge (2: 5). Die linke Schale bildet
einen flachen Bogen, der vorn und hinten spitz endet, wodurch die Schale in der Gegend der Schliess