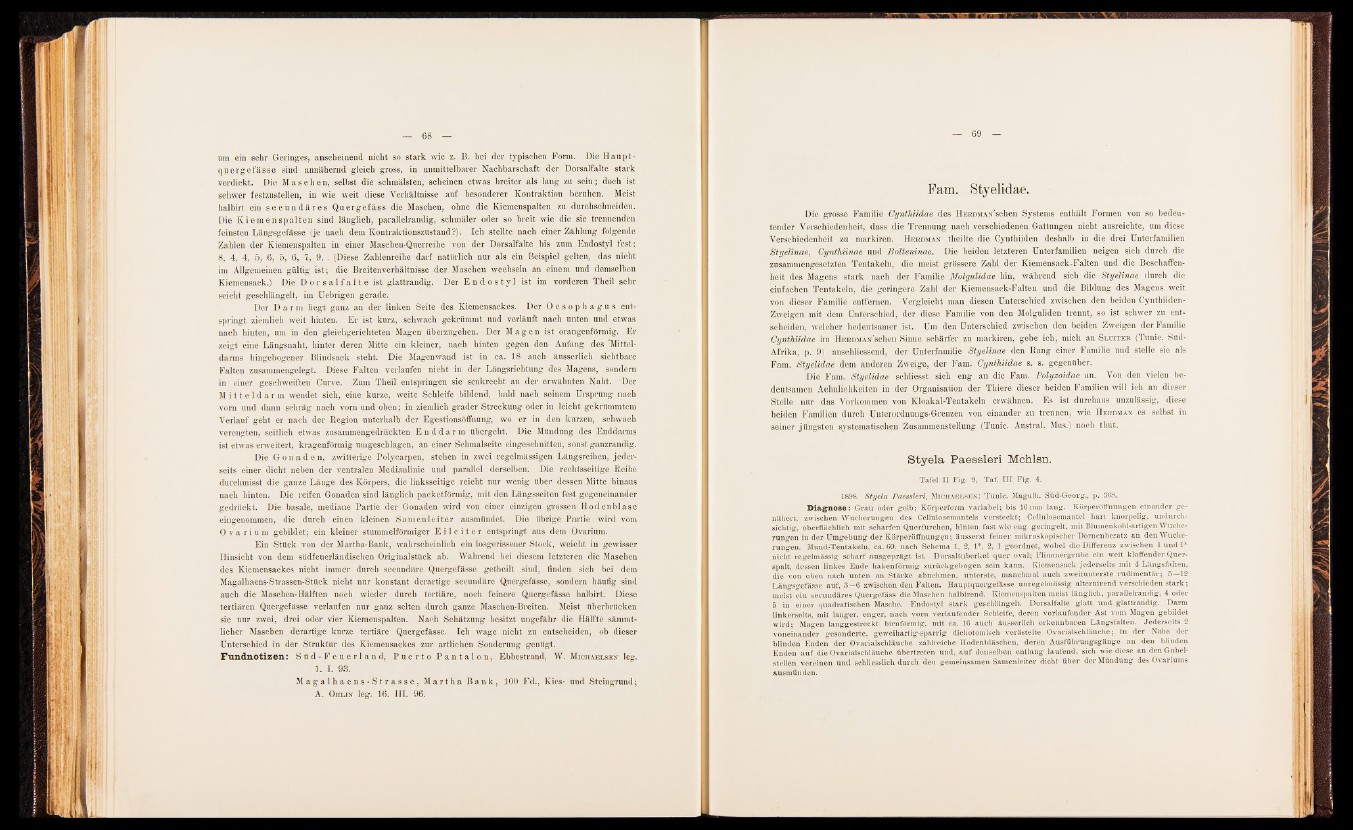
um ein sehr Geringes, anscheinend nicht so stark wie z. B. bei der typischen Form. Die Haupt-
quergefässe sind annähernd gleich gross, in unmittelbarer Nachbarschaft der Dorsalfalte stark
verdickt. Die Maschen, selbst die schmälsten, scheinen etwas breiter als lang zu sein; doch ist
schwer festzustellen, in wie weit diese Verhältnisse auf besonderer Kontraktion beruhen. Meist
halbirt ein s e c u n d ä r e s Quergefäss die Maschen, ohne die Kiemenspalten zu durchschneiden.
Die Ki emenspal t en sind länglich, parallelrandig, schmäler oder so breit wie die sie trennenden
feinsten Längsgefässe (je nach dem Kontraktionszustand?). Ich stellte nach einer Zählung folgende
Zahlen der Kiemenspalten in einer Maschen-Querreihe von der Dorsalfalte bis zum Endostyl fest:
8, 4, 4, 5, 6, 5, 6, 7, 9. . (Diese Zahlenreihe darf natürlich nur als ein Beispiel gelten, das nicht
im Allgemeinen gültig ist; die Breiten Verhältnisse der Maschen wechseln an einem und demselben
Kiemensack.) Die D o r s a l f a l t e ist glattrandig. Der E n d o s t y l ist im vorderen Theil sehr
seicht geschlängelt, im Uebrigen gerade.
Der Da rm liegt ganz an der linken Seite des Kiemensackes. Der O e s o p h a g u s entspringt
ziemlich weit hinten. Er ist kurz, schwach gekrümmt und verläuft nach unten und etwas
nach hinten, um in den gleichgerichteten Magen überzugehen. Der Magen ist orangenförmig. Er
zeigt eine Längsnaht, hinter deren Mitte ein kleiner, nach hinten gegen den Anfang des 'Mitteldarms
hingebogener Blindsack steht. Die Magenwand ist in ca. 18 auch äusserlich sichtbare
Falten zusammengelegt. Diese Falten verlaufen nicht in der Längsrichtung des Magens, sondern
in einer geschweiften Curve. Zum Theil entspringen sie senkrecht an der erwähnten Naht. Der
M i t t e l d a rm wendet sich, eine kurze, weite Schleife bildend, bald nach seinem Ursprung nach
vorn und dann schräg nach vorn und oben; in ziemlich grader Streckung oder in leicht gekrümmtem
Verlauf geht er nach der Region unterhalb der Egestionsöffnung, wo er in den kurzen, schwach
verengten, seitlich etwas zusammengedrückten E n d d a rm übergeht. Die Mündung des Enddarms
ist etwas erweitert, kragenförmig umgeschlagen, an einer Schmalseite eingeschnitten, sonst ganzrandig.
Die Go n a d e n , zwitterige Polycarpen, stehen in zwei regelmässigen Längsreihen, jeder-
seits einer dicht neben der ventralen Medianlinie und parallel derselben. Die rechtsseitige Reihe
durchmisst die ganze Länge des Körpers, die linksseitige reicht nur wenig über dessen Mitte hinaus
nach hinten. Die reifen Gonaden sind länglich packetförmig, mit den Längsseiten fest gegeneinander
gedrückt. Die basale, mediane Partie der Gonaden wird von einer einzigen grossen Hodenblase
eingenommen, die durch einen kleinen Samenleiter ausmündet. Die übrige Partie wird vom
O v a r i um gebildet; ein kleiner stummelförmiger E i l e i t e r entspringt aus dem Ovarium.
Ein Stück von der Martha-Bank, wahrscheinlich ein losgerissener Stock, weicht in gewisser
Hinsicht von dem südfeuerländischen Originalstück ab. Während bei diesem letzteren die Maschen
des Kiemensackes nicht immer durch secundäre Quergefässe getheilt sind, finden sich bei dem
Magalhaens-Strassen-Stück nicht nur konstant derartige secundäre Quergefässe, sondern häufig sind
auch die Maschen-Hälften noch wieder durch tertiäre, noch feinere Quergefässe halbirt. Diese
tertiären Quergefässe verlaufen nur ganz selten durch ganze Maschen-Breiten. Meist überbrücken
sie nur zwei, drei oder vier Kiemenspalten. Nach Schätzung besitzt ungefähr die Hälfte sämmt-
licher Maschen derartige kurze tertiäre Quergefässe. Ich wage nicht zu entscheiden, ob dieser
Unterschied in der Struktur des Kiemensackes zur artlichen Sonderung genügt.
F u n d n o tiz e n : S ü d - F e u e r l a n d , P u e r t o P a n t a l o n , Ebbestrand, W. Michaelsen leg.
1. I. 93.
M a g a l h a e n s - S t r a s s e , Ma r t ha Ban k , 100 Fd., Kies- und Steingrund;
A. Ohlin leg. 16. III. 96.
Farn. Styelidae.
Die grosse Familie Cynthiidae des HERDMAN’schen Systems enthält Formen von so bedeutender
Verschiedenheit, dass die Trennung nach verschiedenen Gattungen nicht ausreichte, um diese
Verschiedenheit zu markiren. H erdman theilte die Cynthiiden deshalb in die drei Unterfamilien
Styelinae, Cynthnnae und Bolteninae. Die beiden letzteren Unterfamilien neigen sich durch die
zusammengesetzten Tentakeln, die meist grössere Zahl der Kiemensack-Falten und die Beschaffenheit
des Magens stark nach der Familie Molgulidae hin, während sich die Styelinae durch die
einfachen Tentakeln, die geringere Zahl der Kiemensack-Falten und die Bildung des Magens weit
von dieser Familie entfernen. Vergleicht man diesen Unterschied zwischen den beiden Cynthiiden-
Zweigen mit dem Unterschied, der diese Familie von den Molguliden trennt, so ist schwer zu entscheiden,
welcher bedeutsamer ist. Um den Unterschied zwischen den beiden Zweigen der Familie
Cynthiidae im HERDMAN’schen Sinne schärfer zu markiren, gebe ich, mich an Sluiter (Tunic. Süd-
Afrika, p. 9) anschliessend, der Unterfamilie Styelinae den Rang einer Familie und stelle sie als
Farn. Styelidae dem anderen Zweige, der Farn. Cynthiidae s. s. gegenüber.
Die Farn. Styelidae schliesst sich eng an die Farn. Polyzoidae an. Von den vielen bedeutsamen
Aehnlichkeiten in der Organisation der Thiere dieser beiden Familien will ich an dieser
Stelle nur das Vorkommen von Kloakal-Tentakeln erwähnen. Es ist durchaus unzulässig, diese
beiden Familien durch Unterordnungs-Grenzen von einander zu trennen, wie Herdman es selbst in
seiner jüngsten systematischen Zusammenstellung (Tunic. Austral. Mus.) noch thut.
Styela Paessleri Mchlsn.
Tafel II F ig . 9, Taf. III Fig. 4.
1898. S ty e la Pae ssle ri, Michaelsen: Tunic. Magalh. Süd-Georg., p. 368.
Diagnose: Grau oder g e lb ; Körperform variab el; bis 16mm lang. Körperöffnungen einander g e nähert,
zwischen Wu cherungen des Cellulosemantels ver steckt; Cellulosemantel hart knorpelig, undurchsichtig,
oberflächlich mit scharfen Querfurehen, hinten fast w ie en g ger ing e lt, mit Blumenkohl-artigen Wucheru
n g en in der Um geb un g der Körperöffnungijn; äusserst feiner mikroskopischer Dornenbesatz an den Wucherungen.
Mund-Tentakeln, ca. 60, nach Schema 1, 2, 1*, 2, 1 g eordnet, wobei die Differenz zwischen 1 und 1*
nicht regelmässig sch arf au sg ep rä g t ist. Dorsaltuberkel quer oval; Fli mm er grub e ein weit klaffender Querspalt,
dessen linkes Ende hakenförmig zu rü ck g eb o g en sein kann. Kiemensack jede rseits mit 4 Längsfalten,
die v on oben nach u nten an S tärke abnehmen, unterste, manchmal auch zweitunterste rudimentär; 5—12
L ä n g sg e fä sse auf, 3—6 zwischen den Falten. Hauptquergefässe unr egelmässig alternirend verschieden s ta r k ;
meist ein secundäres Quergefäss die Maschen halbirend. Kiemenspalten meist länglich, parallelrandig, 4 oder
5 in einer quadratischen Masche. Endostyl stark geschlän gelt. Dorsalfalte g la tt und glattrandig. Darm
link er se its, mit lange r, enger , nach vorn verlaufender Schleife, deren vorlaufender A st vom Mag'en geb ilde t
wird; Magen lang g e stre ck t b imförmig, mit ca. 16 auch äusserlich erkennbaren Längsfalten. Jederseits 2
von einan d er geson d erte, geweihartig-sparrig dichotomisch ve r ä ste lte Ovarialschläuche; in der Nähe der
blinden Enden der Ovarialschläuche zahlreiche Hodenbläschen, deren A u sfü hrun g sg äng e an den blinden
Enden au f die Ovarialschläuche übertreten und, a u f denselben en tlan g laufend, sich wie diese an den Gabelstellen
vereinen u nd schliesslich durch den gemeinsamen Samenleiter dicht über der Mündung des Ovariums
ausmünden.