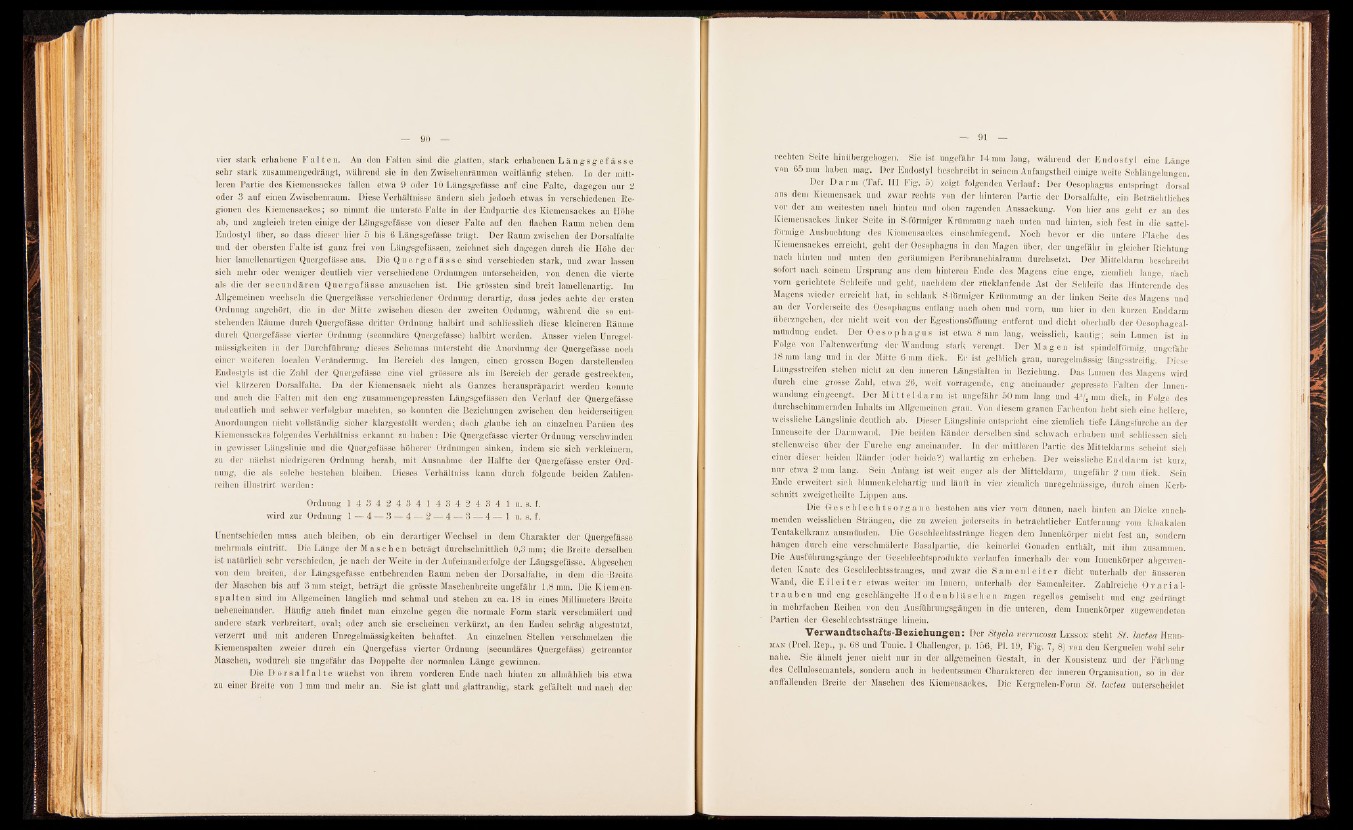
vier stark erhabene Fa l t e n . An den Falten sind die glatten, stark erhabenen L ä n g s g e f ä s s e
sehr stark zusammengedrängt, während sie in den Zwischenräumen weitläufig stehen. In der mittleren
Partie des Kiemensackes fallen etwa 9 oder 10 Längsgefässe auf eine Falte, dagegen nur 2
oder 3 auf einen Zwischenraum. Diese Verhältnisse ändern sich jedoch etwas in verschiedenen Regionen
des Kiemensackes; so nimmt die unterste Falte in der Endpartie des Kiemensackes an Höhe
ab, und zugleich treten einige der Längsgefässe von dieser Falte auf den flachen Raum neben dem
Endostyl über, so dass dieser hier 5 bis 6 Längsgefässe trägt. Der Raum zwischen der Dorsalfalte
und der obersten Falte ist ganz frei von Längsgefässen, zeichnet sich dagegen durch die Höhe der
hier lamellenartigen Quergefässe aus. Die Qu e r g e f ä s s e sind verschieden stark, und zwar lassen
sich mehr oder weniger deutlich vier verschiedene Ordnungen unterscheiden, von denen die vierte
als die der secundären Quergefässe anzusehen ist. Die grössten sind breit lamellenartig. Im
Allgemeinen wechseln die Quergefässe verschiedener Ordnung derartig, dass jedes achte der ersten
Ordnung angehört, die in der Milte zwischen diesen der zweiten Ordnung, während die so entstehenden
Räume durch Quergefässe dritter Ordnung halbirt und schliesslich diese kleineren Räume
durch Quergefässe vierter Ordnung (secundäre Quergefässe) halbirt werden. Ausser vielen Unregelmässigkeiten
in der Durchführung dieses Schemas untersteht die Anordnung der Quergefässe noch
einer weiteren localen Veränderung. Im Bereich des langen, einen grossen Bogen darstellenden
Endostyls ist die Zahl der Quergefässe eine viel grössere, als im Bereich der gerade gestreckten,
viel kürzeren Dorsalfalte. Da der Kiemensack nicht als Ganzes herauspräparirt werden konnte
und auch die Falten mit den eng zusammengepressten Längsgefässen den Verlauf der Quergefässe
undeutlich und schwer verfolgbar machten, so konnten die Beziehungen zwischen den beiderseitigen
Anordnungen nicht vollständig sicher klargestellt werden; doch glaube ich an einzelnen Partien des
Kiemensackes.folgendes Verhältniss erkannt zu haben: Die Quergefässe vierter Ordnung verschwinden
in gewisser Längslinie und die Quergefässe höherer Ordnungen sinken, indem sie sich verkleinern,
zu der nächst niedrigeren Ordnung herab, mit Ausnahme der Hälfte der Quergefässe erster Ordnung,
die als solche bestehen bleiben. Dieses Verhältniss kann durch folgende beiden Zahlenreihen
illustrirt werden:
Ordnung 1 4 3 4 2 4 3 4 1 4 3 4 2 4 3 4 1 u. s. f.
wird zur Ordnung 1 ^ 4 — 3 — 4 — 2— 4 — 3—- 4 — 1 u. s. f.
Unentschieden muss auch bleiben, ob ein derartiger Wechsel in dem Charakter der Quergefässe
mehrmals eintritt. Die Länge der Ma s che n beträgt durchschnittlich 0,3 mm; die Breite derselben
ist natürlich sehr verschieden, je nach der Weite in der Aufeinanderfolge der Längsgefässe. Abgesehen
von dem breiten, der Längsgefässe entbehrenden Raum neben der Dorsalfalte, in dem die Breite
der Maschen bis auf 3 mm steigt, beträgt die grösste Maschenbreite ungefähr 1,8 mm. Die Kiemenspal
ten sind im Allgemeinen länglich und schmal und stehen zu ca. 18 in eines Millimeters Breite
nebeneinander. Häufig auch findet man einzelne gegen die normale Form stark verschmälert und
andere stark verbreitert, oval; oder auch sie erscheinen verkürzt, an den Enden schräg abgestutzt,
verzerrt und mit anderen Unregelmässigkeiten behaftet. An einzelnen Stellen verschmelzen die
Kiemenspalten zweier durch ein Quergefäss vierter Ordnung (secundäres Quergefäss) getrennter
Maschen, wodurch sie ungefähr das Doppelte der normalen Länge gewinnen.
Die Do r s a l f a l t e wächst von ihrem vorderen Ende nach hinten zu allmählich bis etwa
zu einer Breite von 1 mm und mehr an. Sie ist glatt und glattrandig, stark gefältelt und nach der
rechten Seite hinübergebogen. Sie ist ungefähr 14mm lang, während der Endostyl eine Länge
von 65 mm haben mag. Der Endostyl beschreibt in seinem Anfangstheil einige weite Schlängelungen.
Der Darm (Taf. III Fig. 5) zeigt folgenden Verlauf: Der Oesophagus entspringt dorsal
aus dem Kiemensack und zwar rechts von der hinteren Partie der Dorsalfalte, ein Beträchtliches
vor der am weitesten nach hinten und oben ragenden Aussackung. Von hier aus geht er an des
Kiemensackes linker Seite in S-förmiger Krümmung nach unten und hinten, sich fest in die sattelförmige
Ausbuchtung des Kiemensackes einschmiegend. Noch bevor er die untere Fläche des
Kiemensackes erreicht, geht der Oesophagus in den Magen über, der ungefähr in gleicher Richtung
nach hinten und unten den geräumigen Peribranchialraum durchsetzt. Der Mitteldarm beschreibt
sofort nach seinem Ursprung aus dem hinteren Ende des Magens eine enge, ziemlich lange nach
vorn gerichtete Schleife und geht, nachdem der rücklaufende Ast der Schleife das Hinterende des
Magens wieder erreicht hat, in schlank S-förmiger Krümmung an der linken Seite des Magens und
an der Vorderseite des Oesophagus entlang nach oben und vorn, um hier in den kurzen Enddarm
überzugehen, der nicht weit von der Egestionsöffnung entfernt und dicht oberhalb der Oesophageal-
mündung endet. Der Oe s o p h a g u s ist etwa 8 mm lang, weisslich, kantig; sein Lumen ist in
Folge von Faltenwerfung der Wandung stark verengt. Der Magen ist spindelförmig, ungefähr
18 mm lang und in der Mitte 6 mm dick. Er ist gelblich grau, unregelmässig längsstreifig. Diese
Längsstreifen stehen nicht zu den inneren Längsfalten in Beziehung. Das Lumen des Magens wird
durch eine grosse Zahl, etwa 26, weit vorragende, eng aneinander gepresste Falten der Innenwandung
eingeengt. Der Mi t t e ld a rm ist ungefähr 50 mm lang und 4'/2 mm dick, in Folge des
durchschimmernden Inhalts im Allgemeinen grau. Von diesem grauen Farbenton hebt sich eine hellere,
weissliche Längslinie deutlich ab. Dieser Längslinie entspricht eine ziemlich tiefe Längsfurche an der
Innenseite der Darmwand. Die beiden Ränder derselben sind schwach erhaben und scbliessen sich
stellenweise über der Furche eng aneinander. In der mittleren Partie des Mitteldarms scheint sich
einer dieser beiden Ränder (oder beide?) wallartig zu erheben. Der weissliche Enddarm ist kurz
nur etwa 2 mm lang. Sein Anfang ist weit enger als der Mitteldarm, ungefähr 2 mm dick. Sein
Ende erweitert sich blumenkelchartig und läuft in vier ziemlich unregelmässige, durch einen Kerb-
schnitt zweigetheilte Lippen aus.
Die Ge s c h l e c h t s o r g a n e bestehen aus vier vorn dünnen, nach hinten an Dicke zunehmenden
weisslichen Strängen, die zu zweien jederseits in beträchtlicher Entfernung vom kloakalen
Tentakelkranz ausmünden. Die Geschlechtsstränge liegen dem Innenkörper nicht fest an sondern
hängen durch eine verschmälerte Basalpartie, die keinerlei Gonaden enthält, mit ihm zusammen.
Die Ausführungsgänge der Geschlechtsprodukte verlaufen innerhalb der vom Innenkörper abgewendeten
Kante des Geschlechtsstranges, und zwar die S ame n l e i t e r dicht unterhalb der äusseren
Wand, die E i l e i t e r etwas weiter im Innern, unterhalb der Samenleiter. Zahlreiche Ova r i a l t
r a u b e n und eng geschlängelte Ho d e n b l ä s c h e n ragen regellos gemischt und eng gedrängt
in mehrfachen Reihen von den Ausführungsgängen in die unteren, dem Innenkörper zugewendeten
Partien der Geschlechtsstränge hinein.
Verwandtschafts-Beziehungen: Der Styela verrucosa Lesson steht St. lactea H erd-
m a k (Prel. Rep., p. 68 und Tunie. I Challenger, p. 156, M. 19, Fig. 7, 8) von den Kerguelen wohl sehr
nahe.;;i’Sie ähnelt , jener nicht nur in der allgemeinen Gestalt, in der Konsistenz und der Färbung
des Cellulosemantels, sondern auch in bedeutsamen Charakteren der inneren Organisation, so in der
auffallenden Breite der Maschen des Kiemensackes. Die Kerguelen-Form St. lactea unterscheidet