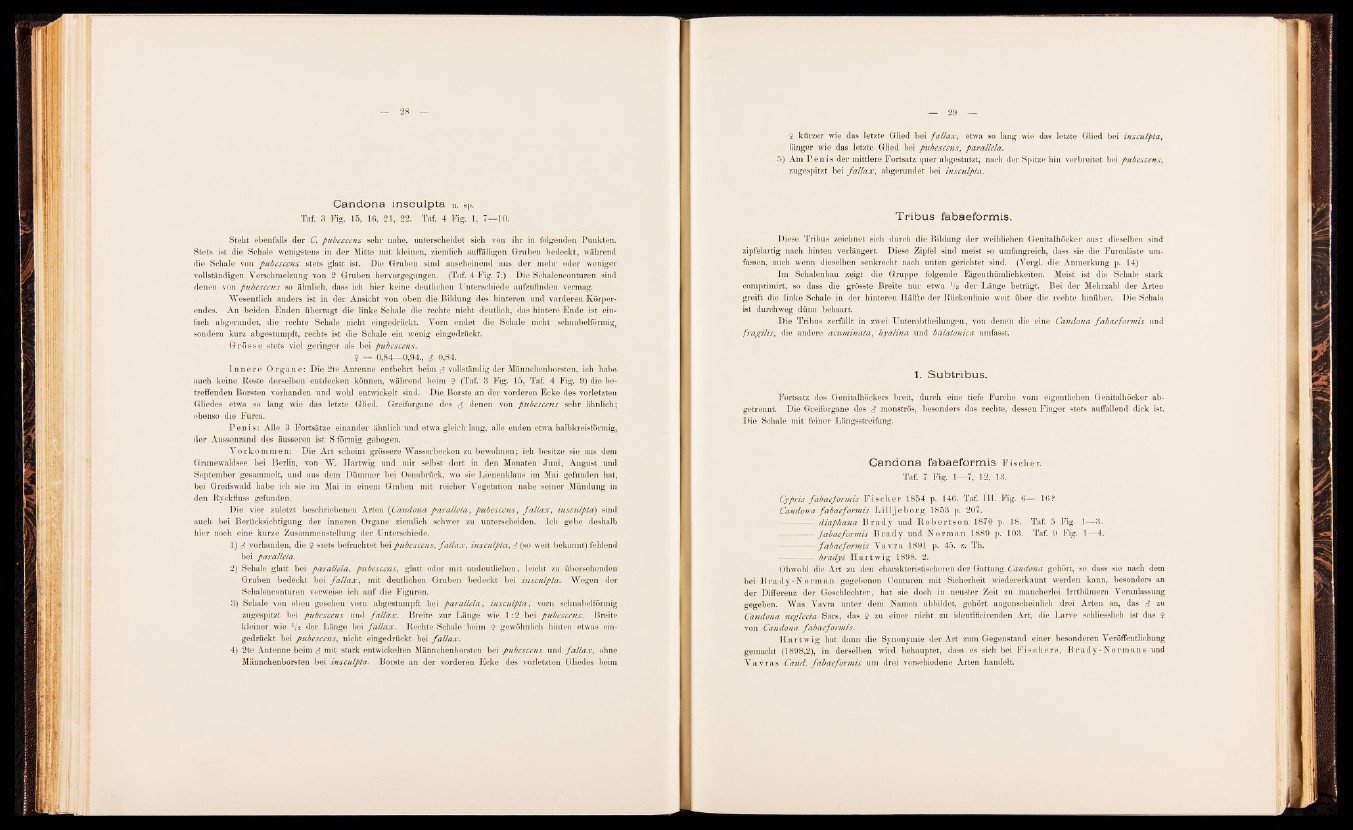
C a n d o n a in s e u lp ta n. sp.
Taf. 3 Fig. 15, 16, 21, 22. Taf. 4 Fig. 1, 7—10.
Steht ebenfalls der C. pubescens sehr nahe, unterscheidet sich von ihr in folgenden Punkten.
Stets ist die Schale wenigstens in der Mitte mit kleinen, ziemlich auffälligen Gruben bedeckt, während
die Schale von pubescens stets glatt ist. Die Gruben sind anscheinend aus der mehr oder weniger
vollständigen Verschmelzung von 2 Gruben hervorgegangen. (Taf. 4 Fig. 7.) Die Schalenconturen sind
denen von pubescens so ähnlich, dass ich hier keine deutlichen Unterschiede aufzufinden vermag.
Wesentlich anders ist in der Ansicht von oben die Bildung des hinteren und vorderen Körperendes.
An beiden Enden überragt die linke Schale die rechte nicht deutlich, das hintere Ende ist einfach
abgerundet, die rechte Schale nicht eingedrückt. Vorn endet die Schale nicht schnabelförmig^
sondern kurz abgestumpft, rechts ist die Schale ein wenig eingedrückt.
Grösse stets viel geringer als bei pubescens.
<J 0,84.
In n e re Organe: Die 2te Antenne entbehrt beim 3 vollständig der .Männchenborsten, ich habe
auch keine Beste derselben entdecken können, während beim 9 (Taf. 3 Fig. 15, Taf. 4 Fig. 9) die betreffenden
Borsten vorhanden und wohl entwickelt sind. Die Borste an der vorderen Ecke des vorletzten
Gliedes etwa so lang wie das letzte Glied. Greiforgane des 3 denen von pubescens sehr ähnlich;
ebenso die Furca.
P en is: Alle 3 Fortsätze einander ähnlich und etwa gleich lang, alle enden etwa halbkreisförmig,
der Aussenrand des äusseren ist S förmig gebogen.
Vorkommen: Die Art scheint grössere Wasserbecken zu bewohnen; ich besitze sie aus dem
Grünewaldsee bei Berlin, von W. Hartwig und mir selbst dort in den Monaten Juni, August und
September gesammelt, und aus dem Dümmer bei Osnabrück, wo sie Lienenklaus im Mai gefunden hat,
bei Greifswald, habe ich sie im Mai in einem Graben mit reicher Vegetation nahe seiner Mündung in
den Ryckfluss gefunden.
Die vier zuletzt beschriebenen Arten (Candona parallela, pubescens, fallax, inseulpta) sind
auch bei Berücksichtigung der inneren Organe ziemlich schwer zu unterscheiden. Ich gebe deshalb
hier noch eine kurze Zusammenstellung der Unterschiede.
1) J vorhanden, die 9 stets befruchtet bei pubescens, fallax, inseulpta, 3 (so weit bekannt) fehlend
bei parallela.
2) Schale glatt bei parallela, pubescens, glatt oder mit undeutlichen, leicht zu übersehenden
Gruben bedeckt bei fa lla x , mit deutlichen Gruben bedeckt bei inseulpta. Wegen der
Schalenconturen verweise ich auf die Figuren.
3) Schale von oben gesehen vorn abgestumpft bei parallela, inseulpta, vorn schnabelförmig
zugespitzt bei pubescens und fallax. Breite zur Länge wie 1:2 bei pubescens. Breite
kleiner wie 1/2 der Länge bei fallax. Rechte Schale beim 9 gewöhnlich hinten etwas eingedrückt
bei pubescens, nicht eingedrückt bei fallax.
4) 2te Antenne beim 3 mit stark entwickelten Männchenborsten bei pubescens und fallax, ohne
Männchenborsten bei inseulpta. Borgte an der vorderen Ecke des vorletzten Gliedes beim
9 kürzer wie das letzte Glied bei fallax, etwa so lang wie das letzte Glied bei inseulpta,
länger wie das letzte Glied bei pubescens, parallela.
5) Am P en is der mittlere Fortsatz quer abgestutzt, nach der Spitze hin verbreitet bei pubescens,
zugespitzt bei fallax, abgerundet bei inseulpta.
T r ib u s fabaeformis.
Diese Tribus zeichnet sich durch die Bildung der weibüchen Genitalhöcker aus: dieselben sind
zipfelartig nach hinten verlängert. Diese Zipfel sind meist so umfangreich, dass sie die Furcaläste umfassen,
auch wenn dieselben senkrecht nach unten gerichtet sind. (Vergl. die Anmerkung p. 14)
Im Schalenbau zeigt die Gruppe folgende Eigenthümlichkeiten. Meist ist die Schale stark
comprimirt, so dass die grösste Breite nur etwa 1js der Länge beträgt. Bei der Mehrzahl der Arten
greift die linke Schale in der hinteren Hälfte der Rückenlinie weit über die rechte hinüber. Die Schale
ist durchweg dünn behaart.
Die Tribus zerfällt in zwei Unterabtheilungen, von .denen die eine Candona fabaeformis und
fragilis, die andere acuminata, hyalina und balatonica umfasst.
1. S u b trib u s.
Fortsatz des Genitalhöckers breit, durch eine tiefe Furche vom eigentlichen Genitalhöcker abgetrennt.
Die Greiforgane des 3 monströs, besonders das rechte, dessen Finger stets auffallend dick ist.
Die Schale mit feiner Längsstreifung.
C a n d o n a fab a e fo rm is Fischer.
Taf. 7 Fig. 1—7, 12, 13.
Cypris fabaeformis F isch e r 1854 p. 146. Taf. III. Fig. 6— 16?
Candona fabaeformis L illje b o rg 1853 p. 207.
diaphana B rad y und R o b e rtso n 1870 p. 18. Taf. 5 Fig. 1—3.
— fabaeformis Brady und Norman 1889 p. 103. Taf. 9 Fig. 1—4.
— fabaeformis Vavra 1891 p. 45. z. Th.
— bradyi H a rtw ig 1898. 2.
Obwohl die Art zu den charakteristischeren der Gattung Candona gehört, so dass sie nach dem
bei Brady-No rm an gegebenen Conturen mit Sicherheit wiedererkannt werden kann, besonders an
der Differenz der Geschlechter, hat sie doch in neuster Zeit zu mancherlei Irrthümern Veranlassung
gegeben. Was Vavra unter dem Namen abbildet, gehört augenscheinlich drei Arten an, das 3 zu
Candona neglecta Sars, das 9 zu einer nicht zu identificirenden Art, die Larve schliesslich ist das 9
von Candona fabaeformis.
H a rtw ig hat dann die Synonymie der Art zum Gegenstand einer besonderen Veröffentlichung
gemacht (1898,2), in derselben wird behauptet, dass es sich bei F isch e rs, Brady-Normans und
V av ra s Cand. fabaeformis um drei verschiedene Arten handelt.