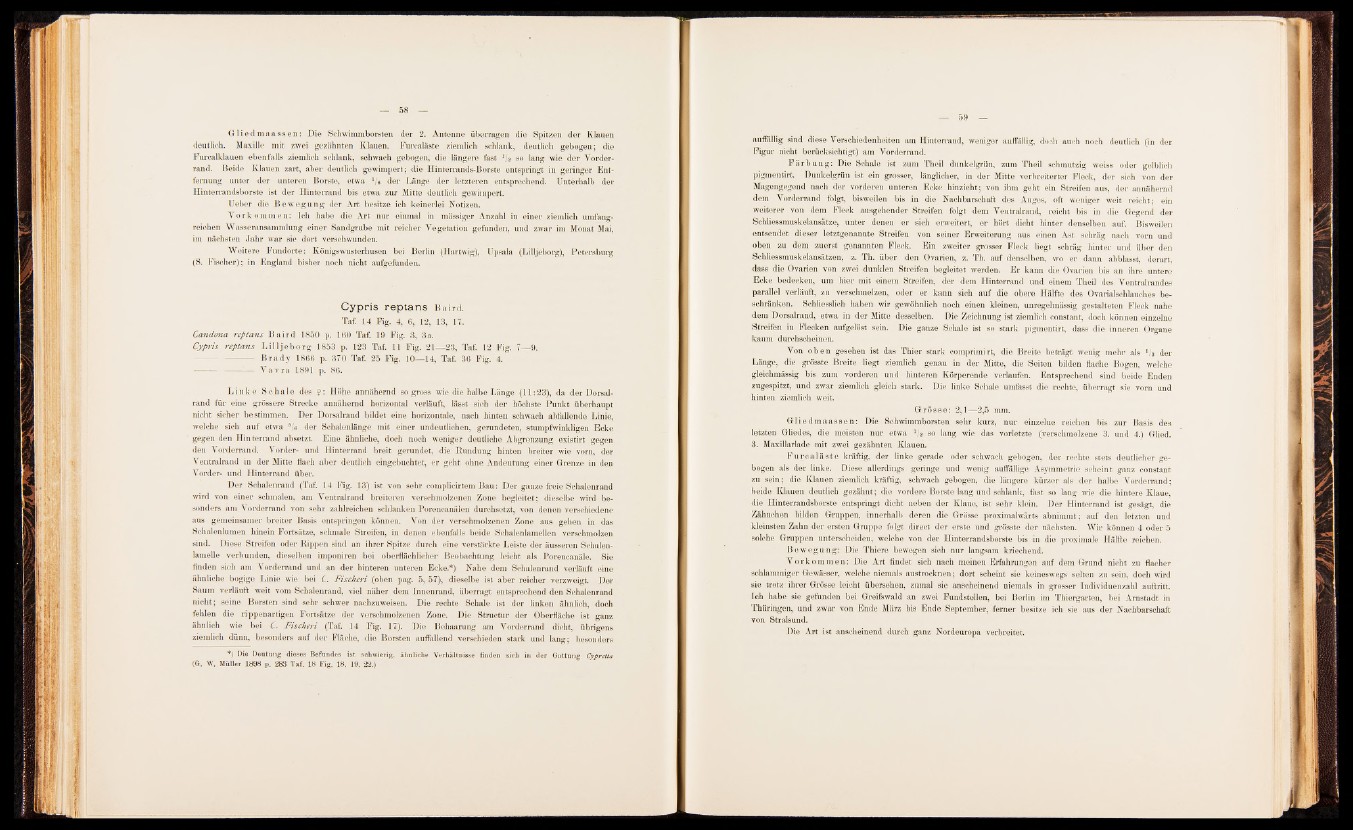
G liedm a a ssen : Die Schwimmborsten der 2. Antenne überragen die Spitzen der Klauen
deutlich. Maxille mit zwei gezähnten Klauen. Furcaläste ziemlich schlank, deutlich gebogen; die
Furcalklauen ebenfalls ziemlich schlank, schwach gebogen, die längere fast 1la so lang wie der Vorderrand.
Beide Klauen zart, aber deutlich gewimpert; die Hinterrands-Borste entspringt in geringer Entfernung
unter der unteren Borste, etwa Vö der Länge der letzteren entsprechend. Unterhalb der
Hinterrandsborste ist der Hinterrand bis etwa zur Mitte deutlich gewimpert.
Ueber die Bewegung der Art besitze ich keinerlei Notizen.
Vorkommen: Ich habe die Art nur einmal in mässiger Anzahl in einer ziemlich umfangreichen
Wasseransammlung einer Sandgrube mit reicher Vegetation gefunden, und zwar im Monat Mai,
im nächsten Jahr war sie dort verschwunden.
Weitere Fundorte: Königswusterhusen bei Berlin (Hartwig), Upsala (Lilljeborg), Petersburg
(S. Fischer); in England bisher noch nicht aufgefunden.
Cypris re p ta n s Baird.
Taf. 14 Fig. 4, 6, 12, 13, 17.
Candona reptans Ba ird 1850 p. 160 Taf. 19 Fig. 3, 3 a.
Cypris reptans L illjeb o rg 1853 p. 123 Taf. 11 Fig. 21—23, Taf. 12 Fig. 7—9.
Brady 1866 p. 370 Taf. 25 Fig. 10—14, Taf. 36 Fig. 4.
— V avra 1891 p. 86.
L in k e S chale des ?: Höhe annähernd sogross wie die halbe Länge (11:23), da der Dorsalrand
für eine grössere Strecke annähernd horizontal verläuft, lässt sich der höchste Punkt überhaupt
nicht sicher bestimmen. Der Dorsalrand bildet eine horizontale, nach hinten schwach abfallende Linie,
welche sich auf etwa 5/6 der Schalenlänge mit einer undeutlichen, gerundeten, stumpfwinkligen Ecke
gegen den Hinterrand absetzt. Eine ähnliche, doch noch weniger deutliche Abgrenzung existirt gegen
den Vorderrand. Vorder- und Hinterrand breit gerundet, die Rundung hinten breiter wie vorn, der
Ventralrand in der Mitte flach aber deutlich eingebuchtet, er geht ohne Andeutung einer Grenze in den
Vorder- und Hinterrand über.
Der Schalenrand (Taf. 14 Fig. 13) ist von sehr complicirtem Bau: Der ganze freie Schalenrand
wird von einer schmalen, am Ventralrand breiteren verschmolzenen Zone begleitet; dieselbe wird besonders
am Vorderrand von sehr zahlreichen schlanken Porencanälen durchsetzt, von denen verschiedene
aus gemeinsamer breiter Basis entspringen können. Von der verschmolzenen Zone aus gehen in das
Schalenlumen hinein Fortsätze, schmale Streifen, in denen ebenfalls beide Schalenlamellen verschmolzen
sind. Diese Streifen oder Rippen sind an ihrer Spitze durch eine verstärkte Leiste der äusseren Schalenlamelle
verbunden, dieselben imponiren bei oberflächlicher Beobachtung leicht als Porencanäle. Sie
finden sich am Vorderrand und an der hinteren unteren Ecke.*) Nahe dem Schalenrand verläuft eine
ähnliche bogige Linie wie bei C. Fiseheri (oben pag. 5, 57), dieselbe ist aber reicher verzweigt. Der
Saum verläuft weit vom Schalenrand, viel näher dem Innenrand, überragt entsprechend den Schalenrand
nicht; seine Borsten sind sehr schwer nachzuweisen. Die rechte Schale ist der linken ähnlich, doch
fehlen die rippenartigen Fortsätze der verschmolzenen Zone. Die Structur der Oberfläche ist ganz
ähnlich wie bei C. Fiseheri (Taf. 14 Fig. 17). Die Behaarung am Vorderrand dicht, übrigens
ziemlich dünn, besonders auf der Fläche, die Borsten auffallend verschieden stark und lang; besonders
*) Die Deutung dieses Befundes ist schwierig, ähnliche Verhältnisse finden sich in der Gattung Cypretta
(G. W. Müller 1898 p. 283 Taf. 18 Fig. 18, 19, 2 2 ) Z.
auffällig sind diese Verschiedenheiten am Hinterrand, weniger auffällig, doch auch noch deutlich (in der
Figur nicht berücksichtigt) am Vorderrand.
F ärbung: Die Schale ist zum Theil dunkelgrün, zum Theil schmutzig weiss oder gelblich
pigmentirt. Dunkelgrün ist ein grösser, länglicher, in der Mitte verbreiterter Fleck, der sich von der
Magengegend nach der vorderen unteren Ecke hinzieht; von ihm geht ein Streifen aus, der annähernd
dem Vorderrand folgt, bisweilen bis in die Nachbarschaft des Auges, oft weniger weit reicht; ein
weiterer von dem Fleck ausgehender Streifen folgt dem Ventralrand, reicht bis in die Gegend der
Schliessmuskelansätze, unter denen er sich erweitert, er hört dicht hinter denselben auf. Bisweilen
entsendet dieser letztgenannte Streifen von seiner Erweiterung aus einen Ast schräg nach vorn und
oben zu dem zuerst genannten Fleck. Ein zweiter grösser Fleck liegt schräg hinter und über den
Schliessmuskelansätzen, z. Th. über den Ovarien, z. Th. auf denselben, wo er dann ab blasst, derart
dass die Ovarien von zwei dunklen Streifen begleitet werden. Er kann die Ovarien bis an ihre untere
Ecke bedecken, um hier mit einem Streifen, der dem Hinterrand und einem Theil des Ventralrandes
parallel verläuft, zu verschmelzen, oder er kann sich auf die obere Hälfte des Ovarialschlauches beschränken.
Schliesslich haben wir gewöhnlich noch einen kleinen, unregelmässig gestalteten Fleck nahe
dem Dorsalrand, etwa in der Mitte desselben. Die Zeichnung ist ziemlich constant, doch können einzelne
Streifen in Flecken aufgelöst sein. Die ganze Schale ist so stark pigmentirt, dass die inneren Organe
kaum durchscheinen.
Von oben gesehen ist das Thier stark comprimirt, die Breite beträgt wenig mehr als lU der
Länge, die grösste Breite liegt ziemlich genau in der Mitte, die Seiten bilden flache Bogen, welche
gleichmässig bis zum vorderen und hinteren Körperende verlaufen. Entsprechend sind beide Enden
zugespitzt, und zwar ziemUch gleich stark. Die linke Schale umfasst die rechte, überragt sie vorn und
hinten ziemlich weit.
Grösse: 2,1#-—2,5 mm.
Glied maassen: Die Schwimmborsten sehr kurz, nur einzelne reichen bis zur Basis des
letzten Gliedes, die meisten nur etwa V2 so lang wie das vorletzte (verschmolzene 3. und 4.) Glied.
3. Maxillarlade mit zwei gezähnten Klauen.
F u rc a lä ste kräftig, der linke gerade oder schwach gebogen, der rechte stets deutlicher gebogen
als der linke. Diese allerdings geringe und wenig auffällige Asymmetrie scheint ganz constant
zu sein; die Klauen ziemlich kräftig, schwach gebogen, die längere kürzer als der halbe Vorderrand;
beide Klauen deutlich gezähnt; die vordere Borste lang und schlank, fast so lang wie die hintere Klaue,
die Hinterrandsborste entspringt dicht neben der Klaue, ist sehr klein. Der Hinterrand ist gesägt, die
Zähnchen bilden Gruppen, innerhalb deren die Grösse proximalwärts abnimmt; auf den letzten und
kleinsten Zahn der ersten Gruppe folgt direct der erste und grösste der nächsten. Wir können 4 oder 5
solche Gruppen unterscheiden, welche von der Hinterrandsborste bis in die proximale Hälfte reichen.
Bewegung: Die Thiere bewegen sich nur langsam kriechend.
Vorkommen: Die Art findet sich nach meinen Erfahrungen auf dem Grund nicht zu flacher
schlammiger Gewässer, welche niemals austrocknen; dort scheint sie keineswegs selten zu sein, doch wird
sie trotz ihrer Grösse leicht übersehen, zumal sie anscheinend niemals in grösser Individuenzahl auftritt.
Ich habe sie gefunden bei Greifswald an zwei Fundstellen, bei Berlin im Thiergarten, bei Arnstadt in
Thüringen, und zwar von Ende März bis Ende September, ferner besitze ich sie aus der Nachbarschaft
von Stralsund.
Die Art ist anscheinend durch ganz Nordeuropa verbreitet.