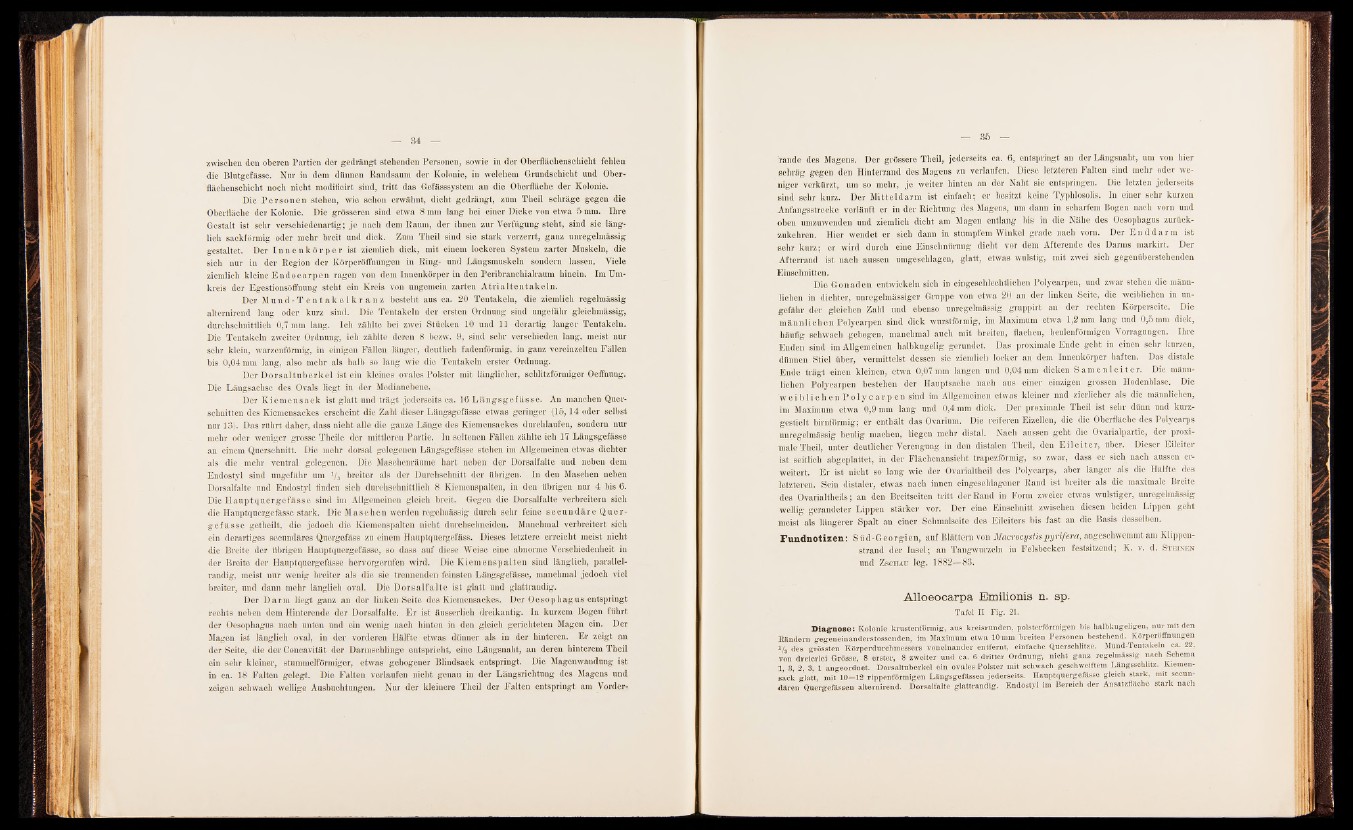
zwischen den oberen Partien der gedrängt stehenden Personen, sowie in der Oberflächenschicht fehlen
die Blutgefässe. Nur in dem dünnen Randsaum der Kolonie, in welchem Grundschicht und Oberflächenschicht
noch nicht modificirt sind, tritt das Gefässsystem an die Oberfläche der Kolonie.
Die Personen stehen, wie schon erwähnt, dicht gedrängt, zum Theil schräge gegen die
Oberfläche der Kolonie. Die grösseren sind etwa 8 mm lang bei einer Dicke von etwa 5 mm. Ihre
Gestalt ist sehr verschiedenartig; je nach dem Raum, der ihnen zur Verfügung steht, sind sie länglich
sackförmig oder mehr breit und dick. Zum Theil sind sie stark verzerrt, ganz unregelmässig
gestaltet. Der I n n e n k ö r p e r ist ziemlich dick, mit einem lockeren System zarter Muskeln, die
sich nur in der Region der Körperöffnungen in Ring- und Längsmuskeln sondern lassen. Viele
ziemlich kleine Endocarpen ragen von dem Innenkörper in den Peribranchialraum hinein. Im Umkreis
der Egestionsöffnung steht ein Kreis von ungemein zarten Atrialtentakeln.
Der Mund - T e n t a k e l k r a n z besteht aus ca. 20 Tentakeln, die ziemlich regelmässig
alternirend lang oder kurz sind. Die Tentakeln der ersten Ordnung sind ungefähr gleichmässig,
durchschnittlich 0,7 mm lang. Ich zählte bei zwei Stücken 10 und 11 derartig langer Tentakeln.
Die Tentakeln zweiter Ordnung, ich zählte deren 8 bezw. 9, sind sehr verschieden lang, meist nur
sehr klein, warzenförmig, in einigen Fällen länger, deutlich fadenförmig, in ganz vereinzelten Fällen
bis 0,04 mm lang, also mehr als halb so lang wie die Tentakeln erster Ordnung.
Der Dorsaltuberkel ist ein kleines ovales Polster mit länglicher, schlitzförmiger Oeffnung.
Die Längsachse des Ovals liegt in der Medianebene.
Der Kiemensack ist glatt und trägt jederseits ca. 16 Längsgefässe. An manchen Querschnitten
des Kiemensackes erscheint die Zahl dieser Längsgefässe etwas geringer (15,14 oder selbst
nur 13). Das rührt daher, dass nicht alle die ganze Länge des Kiemensackes durchlaufen, sondern nur
mehr oder weniger grosse Theile der mittleren Partie. In seltenen Fällen zählte ich 17 Längsgefässe
an einem Querschnitt. Die mehr dorsal gelegenen Längsgefässe stehen im Allgemeinen etwas dichter
als die mehr ventral gelegenen. Die Maschenräume hart neben der Dörsalfalte und neben dem
Endostyl sind ungefähr um 1/3 breiter als der Durchschnitt der übrigen. In den Masehen neben
Dorsalfalte und Endostyl finden sich durchschnittlich 8 Kiemenspalten, in den übrigen nur 4 bis 6.
Die Hauptquergefässe sind im Allgemeinen gleich breit. Gegen die Dorsalfalte verbreitern sieh
die Hauptquergefässe stark. Die Maschen werden regelmässig durch sehr feine secundäreQuer -
gefässe getheilt, die jedoch die Kiemenspalten nicht durchscbneiden. Manchmal verbreitert sich
ein derartiges secundäres Quergefäss zu einem Hauptquergefäss. Dieses letztere erreicht meist nieht
die Breite der übrigen Hauptquergefässe, so dass auf diese Weise eine abnorme Verschiedenheit in
der Breite der Hauptquergefässe hervorgerufen wird. Die Kiemenspalten sind länglich, parallel-
randig, meist nur wenig breiter als die sie trennenden feinsten Längsgefässe, manchmal jedoch viel
breiter, und dann mehr länglich oval. Die Dorsalfalte ist glatt und glattrandig.
Der Darm liegt ganz an der linken Seite des Kiemensaekes. Der Oesophagus entspringt
rechts neben dem Hinterende der Dorsalfalte. Er ist äusserlich dreikantig. In kurzem Bogen führt
der Oesophagus nach unten und ein wenig nach hinten in den gleich gerichteten Magen ein. Der
Magen ist länglich oval, in der vorderen Hälfte etwas dünner als in der hinteren. Er zeigt an
der Seite, die der Concavität der Darmschlinge entspricht, eine Längsnaht, an deren hinterem Theil
ein sehr kleiner, stummelförmiger, etwas gebogener Blindsack entspringt. Die Magenwandung ist
in ca. 18 Falten gelegt. Die Falten verlaufen nicht genau in der Längsrichtung des Magens und
zeigen schwach wellige Ausbuchtungen. Nur der kleinere Theil der Falten entspringt am Vorder?
rande des Magens. Der grössere Theil, jederseits ca. 6, entspringt än der Längsnaht, um von hier
schräg gegen den Hinterrand des Magens zu verlaufen. Diese letzteren Falten sind mehr oder weniger
verkürzt, um so mehr, je weiter hinten an der Naht sie entspringen. Die letzten jederseits
sind sehr kurz. Der Mitteldarm ist einfach; er besitzt keine Typhlosolis. In einer sehr kurzen
Anfangsstrecke verläuft er in der Richtung des Magens, um dann in scharfem Bogen nach vom und
oben umzuwenden und ziemlich dicht am Magen entlang bis in die Nähe des Oesophagus zurückzukehren.
Hier wendet er sich dann in stumpfem Winkel grade nach vorn. Der En d d a rm ist
sehr kurz; er wird durch eine Einschnürung dicht vor dem Afterende des Darms markirt. Der
Afterrand ist nach aussen umgeschlagen, glatt, etwas wulstig, mit zwei sich gegenüberstehenden
Einschnitten.
Die Gonaden entwickeln sich in eingeschlechtlichen Polycarpen, und zwar stehen die männlichen
in dichter, unregelmässiger Gruppe von etwa 20 an der linken Seite, die weiblichen in ungefähr
der gleichen Zahl und ebenso unregelmässig gruppirt an der rechten Körperseite. Die
männlichen Polycarpen sind dick wurstförmig, im Maximum etwa 1 ,2 mm lang und 0,5 mm dick,
häufig schwach gebogen, manchmal auch mit breiten, flachen, beulenförmigen Vorlegungen. Ihre
Enden sind im Allgemeinen halbkugelig gerundet. Das proximale Ende geht in einen sehr kurzen,
dünnen Stiel über, vermittelst dessen sie ziemlich locker an dem Innenkörper haften. Das distale
Ende trägt einen kleinen, etwa 0,07mm langen und 0,04mm dicken Samen l e i t e r . Die männlichen
Polycarpen bestehen der Hauptsache nach aus einer einzigen grossen Hodenblase. Die
we i b l i c h e n P o l y c a r p e n sind im Allgemeinen etwas kleiner nnd zierlicher als die männlichen,
im Maximum etwa 0,9 mm lang und 0,4 mm dick. Der proximale Theil ist sehr dünn und kurzgestielt
bimförmig; er enthält das Ovarium. Die reiferen Eizellen, die die Oberfläche des Polycarps
unregelmässig beulig machen, liegen mehr distal. Nach aussen geht die Ovarialpartie, der proximale
Theil, unter deutlicher Verengung in den distalen Theil, den Eileiter, über. Dieser Eileiter
ist seitlich abgeplattet, in der Flächenansicht trapezförmig, so zwar, dass er sich nach aussen erweitert.
Er ist nicht so lang wie der Ovarialtheil des Polycarps, aber länger als die Hälfte des
letzteren. Sein distaler, etwas nach innen eingeschlagener Rand ist breiter als die maximale Breite
des Ovarialtheils; an den Breitseiten tritt der Rand in Form zweier etwas wulstiger, unregelmässig
wellig gerandeter Lippen stärker vor. Der eine Einschnitt zwischen diesen beiden Lippen geht
meist als längerer Spalt an einer Schmalseite des Eileiters bis fast an die Basis desselben.
Fundnotizen: Süd-Georgien, auf Blättern von Macrocystispyrifera, angeschwemmt am Klippenstrand
der Insel; an Tangwurzeln in Felsbecken festsitzend; K. v. d. Steinen
und Z s c h a u leg. 1 8 8 2— 8 3 .
A llo e o c a rp a Emilionis n. sp.
T a fe l H F ig . 21.
D i a g n o s e : Kolonie krustenförmig, aus kreisrunden, polsterförmigen bis halbkuge ligen, nur mit den
Rändern g eg ene inan de rsto ssend en , im Maximum etwa 10 mm b reiten Per sonen bestehend. Körperöffnungen
i / 3 des grössten Körperdurchmessers von einan d er entfernt, ein fach e Querschlitze. Mund-Tentakeln ca. 22,
von dreierlei Grösse, 8 erster, 8 zweiter und ca. 6 dritter Ordnung, nicht g a n z regelmässig nach Schema
1, 3, 2, 3, 1 angeordnet. Dorsaltuberkel ein o v a le s Polster mit schwach geschweiftem Längsschlitz. Kiemen-
sá c lí g latt, mit 10—12 rippenförmigen L äng sg e fä ssen jede rseits. Hauptquergefässe gleich stark, mit secun daren
Que rge fässen alternirend. Dor salfalte glattrandig. End ostyl im Bereich der Ansatzfläche stark nach