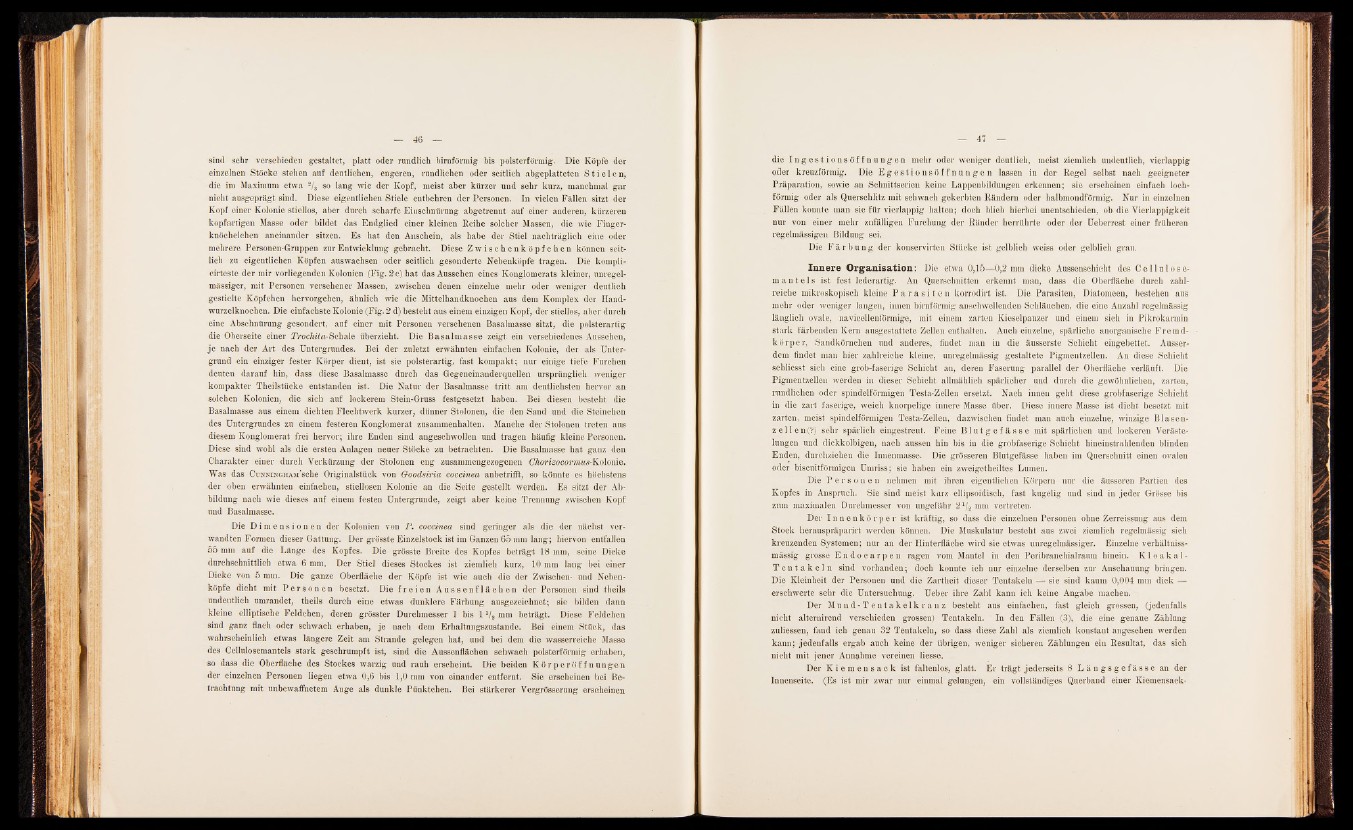
sind sehr verschieden gestaltet, platt oder rundlich bimförmig bis polsterförmig. Die Köpfe der
einzelnen Stöcke stehen auf deutlichen, engeren, rundlichen oder seitlich abgeplatteten S t i e l e n ,
die im Maximum etwa 2/s so lang wie der Kopf, meist aber kürzer und sehr kurz, manchmal gar
nicht ausgeprägt sind. Diese eigentlichen Stiele entbehren der Personen. In vielen Fällen sitzt der
Kopf einer Kolonie stiellos, aber durch scharfe Einschnürung abgetrennt auf einer anderen, kürzeren
kopfartigen Masse oder bildet das Endglied einer kleinen Reihe solcher Massen, die wie Fingerknöchelchen
aneinander sitzen. Es hat den Anschein, als habe der Stiel nachträglich eine oder
mehrere Personen-Gruppen zur Entwicklung gebracht. Diese Zwi s c h e n k ö p f c h e n können seitlich
zu eigentlichen Köpfen auswachsen oder seitlich gesonderte Nebenköpfe tragen. Die kompli-
cirteste der mir vorliegenden Kolonien (Fig. 2 c) hat das Aussehen eines Konglomerats kleiner, unregelmässiger,
mit Personen versehener Massen, zwischen denen einzelne mehr oder weniger deutlich
gestielte Köpfchen hervorgehen, ähnlich wie die Mittelhandknochen aus dem Komplex der Handwurzelknochen.
Die einfachste Kolonie (Fig. 2 d) besteht aus einem einzigen Kopf, der stiellos, aber durch
eine Abschnürung gesondert, auf einer mit Personen versehenen Basalmasse sitzt, die polsterartig
die Oberseite einer Trochita-Schale überzieht. Die Basalmasse zeigt ein verschiedenes Aussehen,
je nach der Art des Untergrundes. Bei der zuletzt erwähnten einfachen Kolonie, der als Untergrund
ein einziger fester Körper dient, ist sie polsterartig, fast kompakt; nur einige tiefe Furchen
deuten darauf hin, dass diese Basalmasse durch das Gegeneinanderquellen ursprünglich weniger
kompakter Theilstücke entstanden ist. Die Natur der Basalmasse tritt am deutlichsten hervor an
solchen Kolonien, die sich auf lockerem Stein-Gruss festgesetzt haben. Bei diesen besteht die
Basalmasse aus einem dichten Flechtwerk kurzer, dünner Stolonen, die den Sand und die Steinchen
des Untergrundes zu einem festeren Konglomerat Zusammenhalten. Manche der Stolonen treten aus
diesem Konglomerat frei hervor; ihre Enden sind angeschwollen und tragen häufig kleine Personen.
Diese sind wohl als die ersten Anlagen neuer Stöcke zu betrachten. Die Basalmasse hat ganz den
Charakter einer durch Verkürzung der Stolonen eng zusammengezogenen Chorizocormus-Kolonie.
Was das C uN N iN G H AM Sche Originalstück von Goodsiria coccínea anbetrifft, so könnte es höchstens
der oben erwähnten einfachen, stiellosen Kolonie an die Seite gestellt werden. Es sitzt der Abbildung
nach wie dieses auf einem festen Untergründe, zeigt aber keine Trennung zwischen Kopf
und Basalmasse.
Die Dime n s i o n e n der Kolonien von P. coccínea sind geringer als die der nächst verwandten
Formen dieser Gattung. Der grösste Einzelstock ist im Ganzen 65 mm lang; hiervon entfallen
55 mm auf die Länge des Kopfes. Die grösste Breite des Kopfes beträgt 18 mm, seine Dicke
durchschnittlich etwa 6 mm. Der Stiel dieses Stockes ist ziemlich kurz, 10 mm lang bei einer
Dicke von 5 mm. Die ganze Oberfläche der Köpfe ist wie auch die der Zwischen- und Nebenköpfe
dicht mit Pe r s o n e n besetzt. Die f r e i e n Au s s e n f l ä c h e n der Personen sind theils
undeutlich umrandet, theils durch eine etwas dunklere Färbung ausgezeichnet; sie bilden dann
kleine elliptische Feldchen, deren grösster Durchmesser 1 bis 1 */2 mm beträgt. Diese Feldchen
sind ganz flach oder schwach erhaben, je nach dem Erhaltungszustände. Bei einem Stück, das
wahrscheinlich etwas längere Zeit am Strande gelegen hat, und bei dem die wasserreiche Masse
des Cellulosemantels stark geschrumpft ist, sind die Aussenflächen schwach polsterförmig erhaben,
so dass die Oberfläche des Stockes warzig und rauh erscheint. Die beiden Kör p e r ö f fn u n g e n
der einzelnen Personen liegen etwa 0,6 bis 1,0 mm von einander entfernt. Sie erscheinen bei Betrachtung
mit unbewaffnetem Auge als dunkle Pünktchen. Bei stärkerer Vergrösserung erscheinen
die I n g e s t i o n s ö f f n u n g e n mehr oder weniger deutlich, meist ziemlich undeutlich, vierlappig
oder kreuzförmig. Die E g e s t i o n s ö f f n u n g e n lassen in der Regel selbst nach geeigneter
Präparation, sowie an Schnittserien keine Lappenbildungen erkennen; sie erscheinen einfach lochförmig
oder als Querschlitz mit schwach gekerbten Rändern oder halbmondförmig. Nur in einzelnen
Fällen konnte man sie für vierlappig halten; doch blieb hierbei unentschieden, ob die Vierlappigkeit
nur von einer mehr znfälligen Furchung der Ränder herrührte oder der Ueberrest einer früheren
regelmässigen Bildung sei.
Die F ä r b u n g der konservirten Stücke ist gelblich weiss oder gelblich grau.
Innere Organisation: Die etwa 0,15—0,2mm dicke Aussenschicht des Ce l l u lo s e ma
n t e l s ist fest lederartig. An Querschnitten erkennt man, dass die Oberfläche durch zahlreiche
mikroskopisch kleine P a r a s i t e n korrodirt ist. Die Parasiten, Diatomeen, bestehen aus
mehr oder weniger langen, innen birnförmig aDschwellenden Schläuchen, die eine Anzahl regelmässig
länglich ovale, navicellenförmige, mit einem zarten Kieselpanzer und einem sich in Pikrokarmin
stark färbenden Kern ausgestattete Zellen enthalten. Auch einzelne, spärliche anorganische Fremdkörper,
Sandkörnchen und anderes, findet man in die äusserste Schicht eingebettet. Ausser-
dem findet man hier zahlreiche kleine, unregelmässig gestaltete Pigmentzellen. An diese Schicht
sehliesst sich eine grob-faserige Schicht an, deren Faserung parallel der Oberfläche verläuft. Die
Pigmentzellen werden in dieser Schicht allmählich spärlicher und durch die gewöhnlichen, zarten,
rundlichen oder spindelförmigen Testa-Zellen ersetzt. Nach innen geht diese grobfaserige Schicht
in die zart faserige, weich knorpelige innere Masse über. Diese innere Masse ist dicht besetzt mit
zarten, meist spindelförmigen Testa-Zellen, dazwischen findet man auch einzelne, winzige Blasenz
e ll en(?) sehr spärlich eingestreut. Feine B l u t g e f ä s s e mit spärlichen und lockeren Verästelungen
und dickkolbigen, nach aussen hin bis in die grobfaserige Schicht hineinstrahlenden blinden
Enden, durchziehen die Innenmasse. Die grösseren Blutgefässe haben im Querschnitt einen ovalen
oder biscuitförmigen Umriss; sie haben ein zweigetheiltes Lumen.
Die P e r s o n e n nehmen mit ihren eigentlichen Körpern nur die äusseren Partien des
Kopfes in Anspruch. Sie sind meist kurz ellipsoidisch, fast kugelig und sind in jeder Grösse bis
zum maximalen Durchmesser von ungefähr 21/2 mm vertreten.
Der I n n e n k ö r p e r ist kräftig, so dass die einzelnen Personen ohne Zerreissung aus dem
Stock herauspräparirt werden können. Die Muskulatur besteht aus zwei ziemlich regelmässig sich
kreuzenden Systemen; nur an der Hinterfläche wird sie etwas unregelmässiger. Einzelne verhältniss-
mässig grosse E n d o c a r p e n ragen vom Mantel in den Peribranchialraum hinein. K1 o a k a 1 -
T e n t a k e l n sind vorhanden; doch konnte ich nur einzelne derselben zur Anschauung bringen.
Die Kleinheit der Personen und die Zartheit dieser Tentakeln — sie sind kaum 0,004 mm dick —
erschwerte sehr die Untersuchung. Ueber ihre Zahl kann ich keine Angabe machen.
Der Mund- T e n t a k e l k r a n z besteht aus einfachen, fast gleich grossen, (jedenfalls
nicht alternirend verschieden grossen) Tentakeln. In den Fällen (3), die eine genaue Zählung
zuliessen, fand ich genau 32 Tentakeln, so dass diese Zahl als ziemlich konstant angesehen werden
kann; jedenfalls ergab auch keine der Übrigen, weniger sicheren Zählungen ein Resultat, das sich
nicht mit jener Annahme vereinen Hesse.
Der K i em e n s a c k ist faltenlos, glatt. Er trägt jederseits 8 L ä n g s g e f ä s s e an der
Innenseite. (Es ist mir zwar nur einmal gelungen, ein vollständiges Querband einer Kiemensack