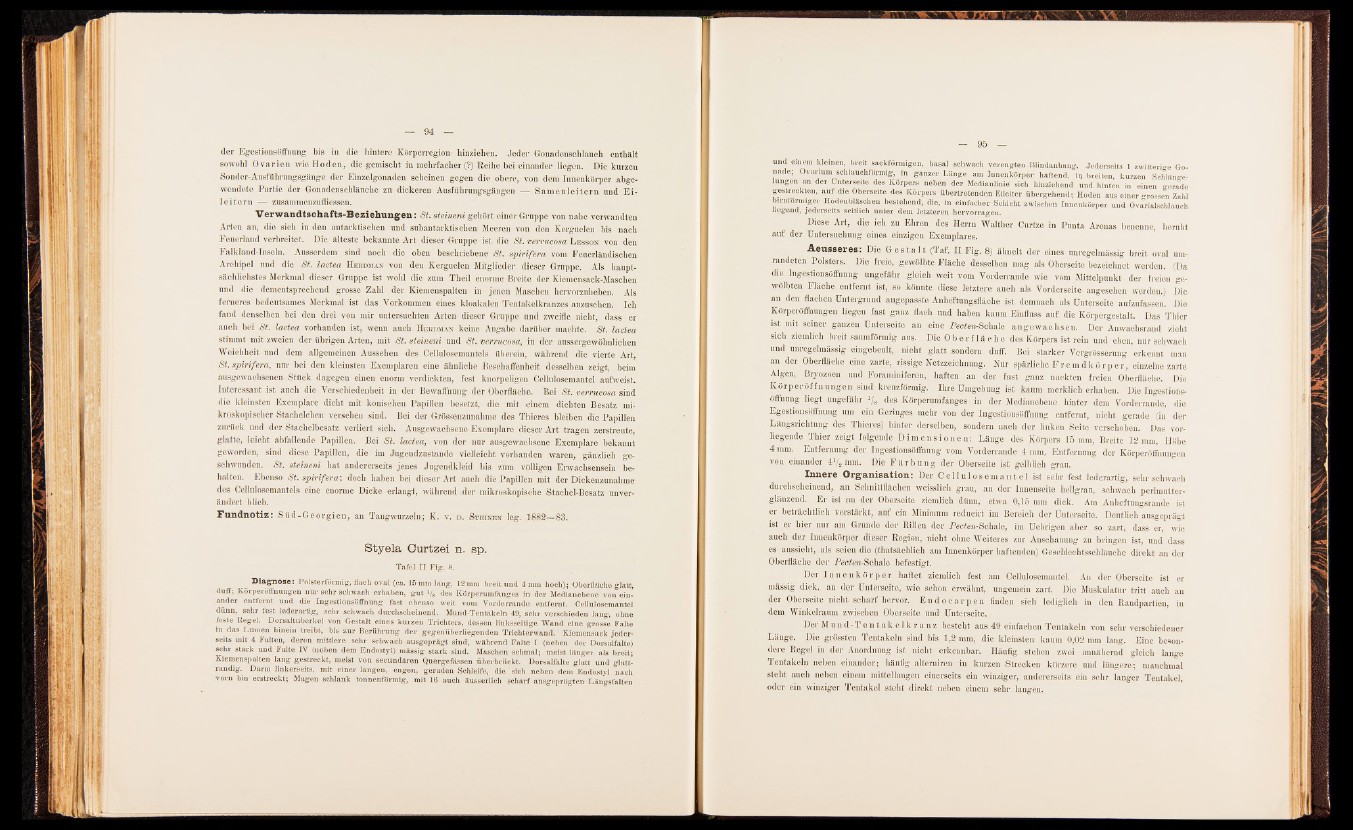
der Egestionsßffhung bis in die hintere Körperregion- hinziehen. Jeder Gonadenschlauch enthält
sowohl Ovarien wie Hoden, die gemischt in mehrfacher® Reihe bei einander liegen. Die kurzen
Sonder-Ausführungsgänge der Einzelgonaden scheinen gegen die obere, von dem Innenkörper abgewendete
Partie der Gonadensehläuche zn dickeren Ausführungsgängen -^Samen l ei t er n und Ei-
1 eitern ^ znsammenzufliessen.
Verwandtschafts-Beziehungen: St. steineni gehört einer Gruppe von nahe verwandten
Arten an, die sich in den antarktischen und subantarktischen Meeren von den Kerguelen bis nach
Feuerland verbreitet. Die älteste bekannte Art dieser Gruppe ist die St. verrucosa Lesson von den
Falkland-Inseln. Ausserdem sind noch die oben beschriebene St. spirifera vom Feuerländischen
Archipel und die St. lactea Herdman von den Kerguelen Mitglieder dieser Gruppe. Als hauptsächlichstes
Merkmal dieser Gruppe ist wohl die zum Theil enorme Breite der Kiemensack-Maschen
und die dementsprechend grosse Zahl der Kiemenspalten in jenen Maschen hervorzuheben. Als
ferneres bedeutsames Merkmal ist das Vorkommen eines kloakalen Tentakelkranzes anzusehen. Ich
fand denselben bei den drei von mir untersuchten Arten dieser Gruppe und zweifle nicht, dass er
auch bei St. lactea vorhanden ist, wenn auch Herdman keine Angabe darüber machte. St. lactea
stimmt mit zweien der übrigen Arten, mit St. steineni und St. verrucosa, in der aussergewöhnlichen
Weichheit und dem allgemeinen Aussehen des Cellulosemantels überein, während die vierte Art
St. spirifera, nur bei den kleinsten Exemplaren eine ähnliche Beschaffenheit desselben zeigt, beim
ausgewachsenen Stück dagegen einen enorm verdickten, fest knorpeligen Cellulosemantel aufweist.
Interessant ist auch die Verschiedenheit in der Bewaffnung der Oberfläche. Bei St. verrucosa sind
die kleinsten Exemplare dicht mit konischen Papillen besetzt, die mit einem dichten Besatz mikroskopischer
Stachelchen versehen sind. Bei der Grössenzunahme des Thieres bleiben die Papillen
zurück und der Stachelbesatz verliert sich. Ausgewachsene Exemplare dieser Art tragen zerstreute,
glatte, leicht abfallende Papillen. Bei St. lactea, von der nur ausgewachsene Exemplare bekannt
geworden, sind diese Papillen, die im Jugendzustande vielleicht vorhanden waren, gänzlich geschwunden.
St. steineni hat andererseits jenes Jugendkleid bis zum völligen Erwachsensein behalten.
Ebenso St. spirifera; doch haben bei dieser Art auch die Papillen mit der Dickenzunahme
des Cellulosemantels eine enorme Dicke erlangt, während der mikroskopische Stachel-Besatz unverändert
blieb.
Fundnotiz: Stid-Georgien, an Tangwurzeln; K. v. d. S te in e n leg. 1882—83. ..
S ty e la Ourtzei n. sp.
T a fel II F ig . 8.
®*a £ n o s e : ^>0^ er^örniig'. flach o v a l (ca. 15 mm lang, 12 mm breit und 4 mm hoch); Oberfläche glatt,
duff; Körperöffnungen nur sehr schwach erhaben, g u t 1/s d es Körperumfanges in der Medianebene von einander
entfernt und die In gestion söffn un g fast ebenso w e it vom Vorde rran d e. entfernt. Cellulosemantel
dünn, sehr fe st lederartig, sehr schwach durchscheinend. Mund-Tentakeln 49, sehr v erschieden lang, ohne
fe ste Regel. Dorsaltuberkel von Gestalt ein es kurzen Trichters, dessen link sseitig e Wand e in e g ro sse Falte
in das Lumen hinein treibt, bis zur Berührung der g e g en ü b e r lieg en d en T rich te rw an d.’ Kiemensack jede r-
se its mit 4 Falten, deren mittlere sehr schwach ausg ep rä g t sind, während F a lte I (neben der Dorsalfalte)
sehr stark und Falte IV (neben dem Endostyl) mässig stark sind. Maschen schmal; meist länge r als breit;
Kiemenspalten la n g gestreckt, meist v on secundären Quergefässen überbrückt. Dorsalfalte g la tt und glatt-
randig. Darm linkerseits, mit ein er langen, en g en , ge r ad en Schleife, d ie sich n eben dem Endostyl nach
vorn hin erstreckt; Magen schlank tonnenförmig, mit 16 auch äusserlich sch arf au sgep rägten Längsfalten
! • •mml S Ä I Ä 1 SS
— 95 t- t
und einem kleinen, breit sackförmigen, basal schwach v er en g ten Blindanhang. Jederseits 1 zwitter ige Gon
ade ; Ovanum schlauchförmig, in gan zer L äng e am Innenkörper haftend, iij breiten, kurzen S chlängelun
g en an der Unterseite des Körpers n eben der Medianlinie! sich hinziehend und hinten in einen gerade
gestreckten , a u f d ie Oberseite des Körpers übertretenden Eileiter übe rgeh en d ; Hoden aus einer grossen Zahl
birnlormiger Hodenbläschen bestehend, die, in einfacher Schicht zwischen Innenkörper und Ovarialschlauch
liegend, jede rseits seitlich u nter dem letzteren heryorragen.
Diese Art, die ich zu Ehren des Herrn Walther Curtze in Punta Arenas benenne, beruht
auf der Untersuchung eines einzigen Exemplares.
Aeusseres: Die Ge s t a l t (Taf. II Fig. 8) ähnelt der eines unregelmässig breit oval umrandeten
Polsters. Die freie, gewölbte Fläche desselben mag als Oberseite bezeichnet werden. (Da
die Ingesjfensöffnung ungefähr gleich weit vom Vorderrande wie vom Mittelpunkt der freien gewölbten
Fläche entfernt ist, so könnte diese letztere auch als Vorderseite angesehen werden.) Die
an den flachen; Untergrund angepasste Anheftungsfläche ist demnach als Unterseite aufzufassen. Die
Körperöffnungen liegen fast ganz flach und haben kaum Einfluss auf die Körpergestalt. Das Thier
ist mit seiner ganzen Unterseite an eine B m tm Schale angewachsen. Der Anwachsrand zieht
sieh ziemlich breit saumförmig aus. Uf eQb e r f l f e h e des Körpers ist rein und eben, nur schwach
u Ä unregelmässig eingebeult, nicht glatt sondern duff. BÄtarkei- Vergrösserung erkennt man
an der Oberfläche eine zarte, rissige Netzzeichnung. Nur spärliche F r emd k ö r p e r , einzelne zarte
Algen, Bryipen und Foraminiferen, haften an der fast ganz nackten freien Oberfläche. Die
Körper| ffnungen sind kreuzförmig. Ehre,Umgebung ist kaum merklich erhaben. Die Ingestions-
Öffnung liegt ungefähr 1/8 des Körperumfanges in der Medianebene hinter dem Vorderrande, die
Egestionsüflhung um ein Geringes mehr von der Ingestionsöffnung entfernt, nicht gerade (in der
Längslichtung des Thieres) hinter derselben, sondern nach der linken Seite verschoben. Das vorliegende
Thier zeigt folgende Dimen s i o ne n: Länge des Körpers 15 mm, Breite 12 mm, Höhe
4 mm. Entfernung, der Ingestionsöffhung vom Vorderrande 4 mm, Entfernung der Körperöffnungen
von einander 4: ;, nun. Die F ä r b u n g der Oberseite ist gelblich grau.
Innere Organisation: Der Ce l l u l o s ema n t e l ist sehr fest lederartig, sehr schwach
durchscheinend, an Schnittflächen weisslich grau, an der Innenseite hellgrau, schwach perlmulterglänzend.
Er ist an der Oberseite ziemlich dünn, etwa 0,15 mm dick. Am Anheftungsrande ist
er beträchtlich verstärkt, auf ein Minimum reducirt im Bereich der Unterseite. Deutlich ausgeprägt
ist ,er hier nur am Grunde der Rillen der Pecten-Schale, im Uebrigen aber so zart, dass er, wie
auch der Innenkörper dieser Region, nicht ohne Weiteres zur Anschauung zu bringen ist, und dass
es aussieht, als seien, die (thatsächlich am Innenkörper haftenden) Geschlechtsschläuche direkt an der
Oberfläche der Pectew-Schale befestigt.
Der I n n e n k ö r p e r haftet ziemlich fest am Cellulosemantel. An der Oberseite ist er
määsig dick, an der Unterseite, wie schon erwähnt, ungemein zart. Die Muskulatur tritt auch an
der Oberseite nicht scharf hervor. E n d o c a r p e n flnden sich lediglich in den Randpartien, in
dem Winkelraum zwischen Oberseite und Unterseite.
Der Mu n d -T e n t a k e l k r a n z besteht aus 49 einfachen Tentakeln von sehr verschiedener
Länge. Die grössten Tentakeln sind bis 1,2 mm, die kleinsten kaum 0,02 mm lang. Eine besondere
Regel in der Anordnung ist nicht erkennbar. Häufig stehen zwei annähernd gleich lange
Tentakeln neben einander; häufig alterniren in kurzen Strecken kürzere und längere; manchmal
steht auch neben einem mittellangen einerseits ein winziger, andererseits ein sehr langer Tentakel,
oder ein winziger Tentakel steht direkt neben einem sehr langen.