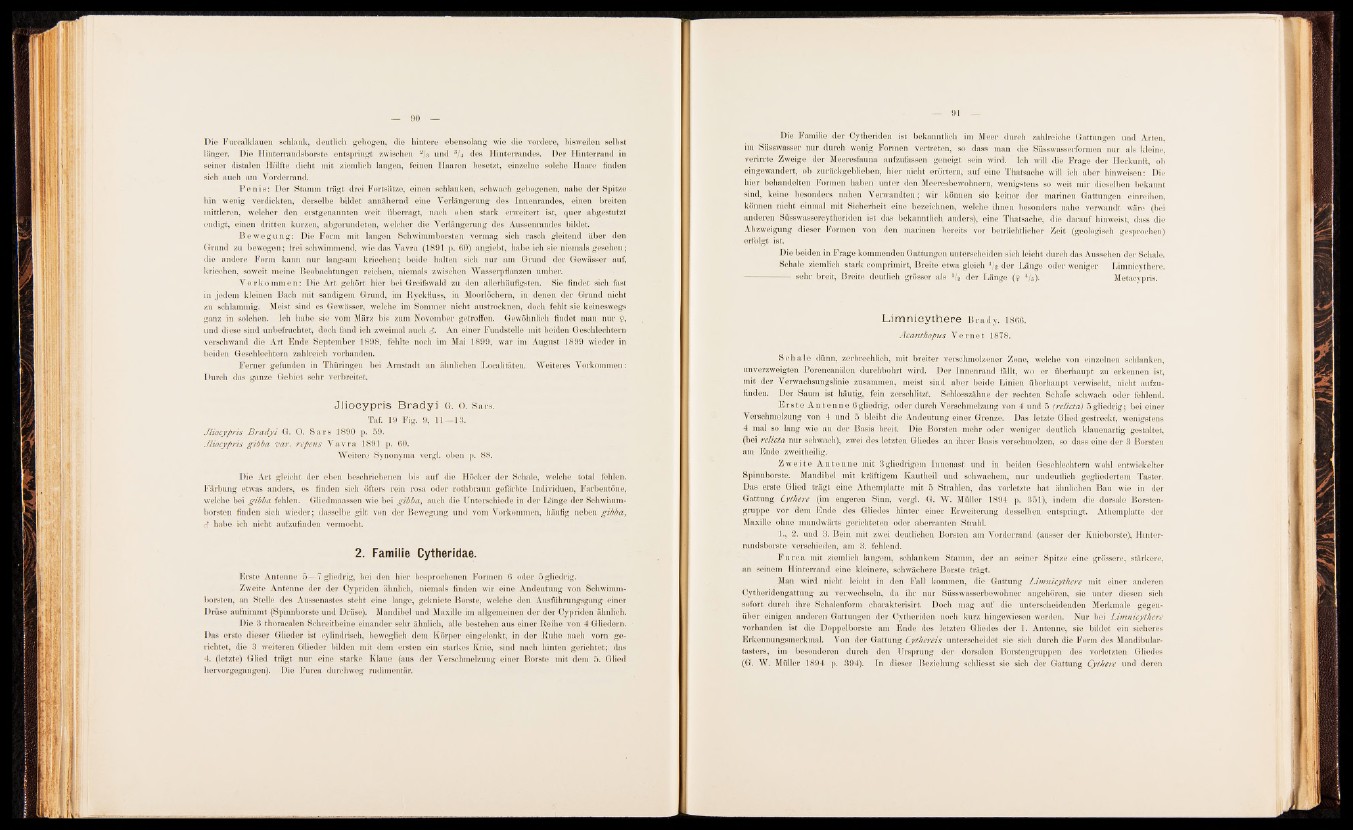
Die Furcalklauen schlank, deutlich gebogen, die hintere ebensolang wie die vordere, bisweilen selbst
länger. Die Hinterrandsborste entspringt zwischen 2/s und des liinterrandes. Der Hinterrand in
seiner distalen Hälfte dicht mit ziemlich langen, feinen Haaren besetzt, einzelne solche Haare finden
sich auch am Vorderrand.
P en is: Der Stamm trägt drei Fortsätze, einen schlanken, schwach gebogenen, nahe der Spitze
hin wenig verdickten, derselbe bildet annähernd eine Verlängerung des Innenrandes, einen breiten
mittleren, welcher den erstgenannten weit überragt, nach oben stark erweitert ist, quer abgestutzt
endigt, einen dritten kurzen, abgerundeten, welcher die Verlängerung des Aussenrandes bildet.
Bewegung: Die Form mit langen Schwimmborsten vermag sich rasch gleitend über den
Grund zu bewegen; frei schwimmend, wie das Vavra (1891 p. 60) angiebt, habe ich sie niemals gesehen;
die andere Form kann nur langsam kriechen; beide halten sich nur am Grund der Gewässer auf,
kriechen, soweit meine Beobachtungen reichen, niemals zwischen Wasserpflanzen umher.
Vorkommen: Die Art gehört hier bei Greifswald zu den allerhäufigsten. Sie findet sich fast
in jedem kleinen Bach mit sandigem Grund, im Ryckfluss, in Moorlöchern, in denen der Grund nicht
zu schlammig. Meist sind es Gewässer, welche im Sommer nicht austrocknen, doch fehlt sie keineswegs
ganz in solchen. Ich habe sie vom März bis zum November getroffen. Gewöhnlich findet man nur ?,
und diese sind unbefruchtet, doch fand ich zweimal auch An einer Fundstelle mit beiden Geschlechtern
verschwand die Art Ende September 1898, fehlte noch im Mai 1899, war im August 1899 wieder in
beiden Geschlechtern zahlreich vorhanden.
Ferner gefunden in Thüringen bei Arnstadt an ähnlichen Localitäten. Weiteres Vorkommen:
Durch das ganze Gebiet sehr verbreitet.
J lio e y p ris B ra d y i G. 0. Sars.
Taf. 19 Fig. 9, 11—13.
Jlioeypris Bradyi G. 0. Sa rs 1890 p. 59.
Jlioeypris gibba var. repens Vavra 1891 p. 60.
Weitere Synonyma vergl. oben p. 88.
Die Art gleicht der eben beschriebenen bis auf die Höcker der Schale, welche total fehlen.
Färbung etwas anders, es finden sich öfters rein rosa oder rothbraun gefärbte Individuen, Farbentöne,
welche bei gibba fehlen. Gliedmaassen wie bei gibba, auch die Unterschiede in der Länge der Sehwimmborsten
finden sich wieder; dasselbe gilt von der Bewegung und vom Vorkommen, häufig neben gibba,
J habe- ich nicht aufzufinden vermocht.
2. Familie Cytheridae.
Erste Antenne 5—7 gliedrig, bei den hier besprochenen Formen 6 oder ögliedrig.
Zweite Antenne der der Cypriden ähnlich, niemals finden wir eine Andeutung von Schwimmborsten,
an Stelle des Aussenastes steht eine lange, gekniete Borste, welche den Ausführungsgang einer
Drüse aufnimmt (Spinnborste und Drüse). Mandibel und Maxille im allgemeinen der der Cypriden ähnlich.
Die 3 thoracalen Schreitbeine einander sehr ähnlich, alle bestehen aus einer Reihe von 4 Gliedern.
Das erste dieser Glieder ist cylindrisch, beweglich dem Körper eingelenkt, in der Ruhe nach vorn gerichtet,
die 3 weiteren Glieder bilden mit dem ersten ein starkes Knie, sind nach hinten gerichtet; das
4. (letzte) Glied trägt nur eine starke Klaue (aus der Verschmelzung einer Borste mit dem 5. Glied
hervorgegangen). Die Furca durchweg rudimentär.
Die Familie der Cytheriden ist bekanntlich im Meer durch zahlreiche Gattungen und Arten,
im Süsswasser nur durch wenig Formen vertreten, so dass man die Süsswasserformen nur als kleine
verirrte Zweige der Meeresfauna aufzufassen geneigt sein wird. Ich will die Frage der Herkunft, ob
eingewandert, ob zurückgeblieben, hier nicht erörtern, auf eine Thatsache will ich aber hinweisen: Die
hier behandelten Formen haben unter den Meeresbewohnern, wenigstens so weit mir dieselben bekannt
sind, keine besonders nahen Verwandten; wir können sie keiner der marinen Gattungen einreihen
können nicht einmal mit Sicherheit eine bezeichnen, welche ihnen besonders nahe verwandt wäre (bei
anderen Süsswassercytheriden ist das bekanntlich anders), eine Thatsache, die darauf hinweist, dass die
Abzweigung dieser Formen von den marinen bereits vor beträchtlicher Zeit (geologisch gesprochen)
erfolgt ist. Die beiden in Frage kommenden Gattungen unterscheiden sich leicht durch das Aussehen der Schale.
Schale ziemlich stark comprimirt, Breite etwa gleich 1/‘2 der Länge oder weniger Limnicythere.
— sehr breit, Breite deutlich grösser als 112 der Länge ($ ^/s). Metacypris.
L im n ic y th e re Brady. 1866.
Acanthopus V e rn e t 1878.
Schale dünn, zerbrechlich, mit breiter verschmolzener Zone, welche von einzelnen schlanken,
unverzweigten Porencanälen durchbohrt wird. Der Innenrand fallt, wo er überhaupt zu erkennen ist,
mit der Verwachsungslinie zusammen, meist sind aber beide Linien überhaupt verwischt, nicht aufzufinden.
Der Saum ist häutig, fein zerschlitzt. Schlosszähne der rechten Schale schwach oder fehlend.
E rs te An ten n e ögliedrig, oder durch Verschmelzung von 4 und 5 [relicta) ögliedrig; bei einer
Verschmelzung von 4 und 5 bleibt die Andeutung einer Grenze. Das letzte Glied gestreckt, wenigstens
4 mal so lang wie an der Basis breit. Die Borsten mehr oder weniger deutlich klauenartig gestaltet,
(bei relicta nur schwach), zwei des letzten Gliedes an ihrer Basis verschmolzen, so dass eine der 3 Borsten
am Ende zweitheilig.
Zweite Antenne mit 3gliedrigem Innenast und in beiden Geschlechtern wohl entwickelter
Spinnborste. Mandibel mit kräftigem Kautheil und schwachem, nur undeutlich gegliedertem Taster.
Das erste Glied trägt eine Athemplatte mit 5 Strahlen, das vorletzte hat ähnlichen Bau wie in der
Gattung Cythere (im engeren Sinn, vergl. G. W. Müller 1894 p. 351), indem die dorsale Borstengruppe
vor dem Ende des Gliedes hinter einer Erweiterung desselben entspringt. Athemplatte der
Maxille ohne mundwärts gerichteten oder aberranten Strahl.
1., 2. und 3. Bein mit zwei deutlichen Borsten am Vorderrand (ausser der Knieborste), Hmterrandsborste
verschieden, am 3. fehlend.
Furc a mit ziemlich langem, schlankem Stamm, der an seiner Spitze eine grössere, stärkere,
an seinem Hinterrand eine ldeinere, schwächere Borste trägt.
Man wird nicht leicht in den Fall kommen, die Gattung Limnicythere mit einer anderen
Cytheridengattung zu verwechseln, da ihr nur Süsswasserbewohner angehören, sie unter diesen sich
sofort durch ihre Schalenform charakterisirt. Doch mag auf die unterscheidenden Merkmale gegenüber
einigen anderen Gattungen der Cytheriden noch kurz hingewiesen werden. Nur bei Limnicythere
vorhanden ist die Doppelborste am Ende des letzten Gliedes der 1. Antenne, sie bildet ein sicheres
Erkennungsmerkmal. Von, der Gattung Cythereis unterscheidet sie sich durch die Form des Mandibulartasters,
im besonderen durch den Ursprung der dorsalen’ Borstengruppen des vorletzten Gliedes
(G. W. Müller 1894 p. 394). In dieser Beziehung schliesst sie sich der Gattung Cythere und deren