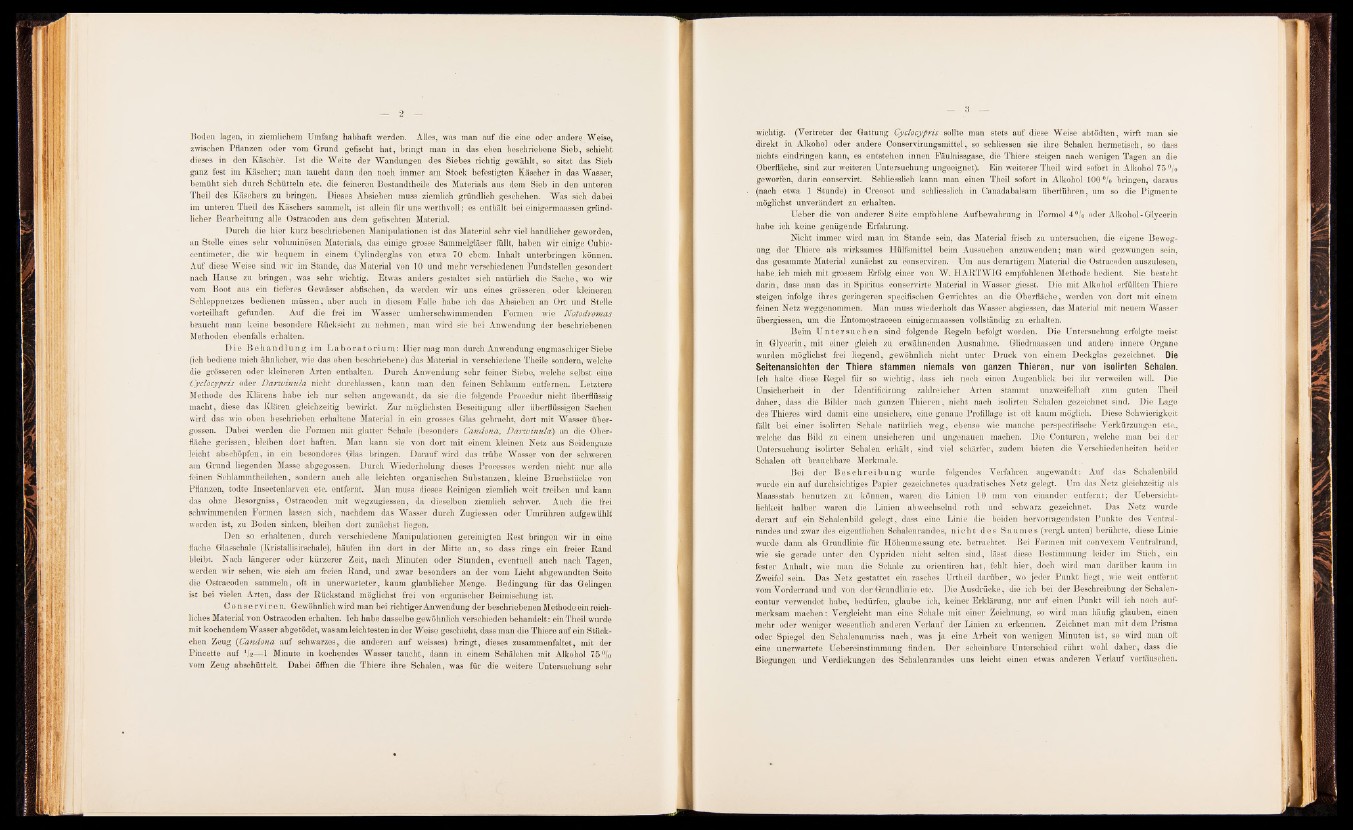
Boden lagen, in ziemlichem Umfang habhaft werden. Alles, was man auf die eine oder anders Weise,
zwischen Pflanzen oder vom Grund gefischt hat, bringt man in das eben beschriebene Sieb, schiebt
dieses in den Käscher. Ist die Weite der Wandungen des Siebes richtig gewählt, so sitzt das Sieb
ganz fest im Käscher; man taucht dann den noch immer am Stock befestigten Käscher in das Wasser,
bemüht sich durch Schütteln etc. die feineren Bestandteile des Materials aus dem Sieb in den unteren
Theil des Käschers zu bringen. Dieses Absieben muss ziemlich gründlich geschehen. Was sich dabei
im unteren Theil des Käschers sammelt, ist allein für uns werthvoll; es enthält bei einigermaassen gründlicher
Bearbeitung alle Ostracoden aus dem gefischten Material.
Durch die hier kurz beschriebenen Manipulationen ist das Material sehr viel handlicher geworden,
an Stelle eines sehr voluminösen Materials, das einige grosse Sammelgläser füllt, haben wir einige Cubic-
centimeter, die wir bequem in einem Cylinderglas von etwa 70 cbcm. Inhalt unterbringen können.
Auf diese Weise sind wir im Stande, das Material von 10 und mehr verschiedenen Fundstellen gesondert
nach Hause zu bringen, was sehr wichtig. Etwas anders gestaltet sich natürlich die Sache, wo wir
vom Boot aus ein tieferes Gewässer abfischen, da werden wir uns eines grösseren oder kleineren
Schleppnetzes bedienen müssen, aber auch in diesem Falle habe ich das Absieben an Ort und Stelle
vorteilhaft gefunden. Auf die frei im Wasser umherschwimmenden Formen wie Notodromas
braucht man keine besondere Rücksicht zu nehmen, man wird sie bei Anwendung der beschriebenen
Methoden ebenfalls erhalten.
Die Beh an d lu n g im L ab o ra to rium : Hier mag man durch Anwendung engmaschiger Siebe
(ich bediene mich ähnlicher, wie das oben beschriebene) das Material in verschiedene Theile sondern, welche
die grösseren oder kleineren Arten enthalten. Durch Anwendung sehr feiner Siebe, welche selbst eine
Cyclöcypris oder Darwinula nicht durchlassen, kann man den feinen Schlamm entfernen. Letztere
Methode des Klärens habe ich nur selten angewandt, da sie die folgende Procedur nicht überflüssig
macht, diese das Klären gleichzeitig bewirkt. Zur möglichsten Beseitigung aller überflüssigen Sachen
wird das wie oben beschrieben erhaltene Material in ein grosses Glas gebracht, dort mit Wasser übergossen.
Dabei werden die Formen mit glatter Schale (besonders Candona, Darwinula) an die Oberfläche
gerissen, bleiben dort haften. Man kann sie von dort mit einem kleinen Hetz aus Seidengaze
leicht abschöpfen, in ein besonderes Glas bringen. Darauf wird das trübe Wasser von der schweren
am Grund liegenden Masse abgegossen. Durch Wiederholung dieses Processes werden nicht nur alle
feinen Schlammtheilchen, sondern auch alle leichten organischen Substanzen, kleine Bruchstücke von
Pflanzen, todte Insectenlarven etc. entfernt. Man muss dieses Reinigen ziemlich weit treiben und kann
das ohne Besorgniss, Ostracoden mit wegzugiessen, da dieselben ziemlich schwer. Auch die frei
schwimmenden Formen lassen sich, nachdem das Wasser durch Zugiessen oder Umrühren aufgewühlt
worden ist, zu Boden sinken, bleiben dort zunächst liegen.
Den so erhaltenen, durch verschiedene Manipulationen gereinigten Rest bringen wir in eine
flache Glasschale (Kristallisirschale), häufen ihn dort in der Mitte an, so dass rings ein freier Rand
bleibt. Nach längerer oder kürzerer Zeit, nach Minuten oder Stunden, eventuell auch nach Tagen,
werden wir sehen, wie sich am freien Rand, und zwar besonders an der vom Licht abgewandten Seite
die Ostracoden sammeln, oft in unerwarteter, kaum glaublicher Menge. Bedingung für das Gelingen
ist bei vielen Arten, dass der Rückstand möglichst frei von organischer Beimischung ist.
Conserviren. Gewöhnlich wird man bei richtiger Anwendung der beschriebenen Methode ein reichliches
Material von Ostracoden erhalten. Ich habe dasselbe gewöhnlich verschieden behandelt: ein Theil wurde
mit kochendem Wasser abgetödet, was am leichtesten in der Weise geschieht, dass man die Thiere auf ein Stückchen
Zeug (iCandona auf schwarzes, die anderen auf weisses) bringt, dieses zusammenfaltet, mit der
Pincette auf Vs—-4 Minute in kochendes Wasser taucht, dann in einem Schälchen mit Alkohol 75°./o
vom Zeug abschüttelt. Dabei öffnen die Thiere ihre Schalen, was für die weitere Untersuchung sehr
wichtig. (Vertreter der Gattung Cyclöcypris sollte man stets auf diese Weise abtödten, wirft man sie
direkt in Alkohol oder andere Conservirungsmittel, so schliessen sie ihre Schalen hermetisch, so dass
nichts eindringen kann, es entstehen innen Fäulnissgase, die Thiere steigen nach wenigen Tagen an die
Oberfläche, sind zur weiteren Untersuchung ungeeignet). Ein weiterer Theil wird sofort in Alkohol 7 5 °/o
geworfen, darin conservirt. Schliesslich kann man einen Theil sofort in Alkohol 100 °/o bringen, daraus
(nach etwa 1 Stunde) in Creosot und schliesslich in Canadabalsam überführen, um so die Pigmente
möglichst unverändert zu erhalten.
Ueber die von anderer Seite empfohlene Aufbewahrung in Formol 4°/o oder Alkohol - Glycerin
habe ich keine genügende Erfahrung.
Nicht immer wird man im Stande sein, das Material frisch zu untersuchen, die eigene Bewegung
der Thiere als wirksames Hülfsmittel beim Aussuchen anzuwenden; man wird gezwungen sein,
das gesammte Material zunächst zu conserviren. Um aus derartigem Material die Ostracoden auszulesen,
habe, ich mich mit grossem Erfolg einer von W. HARTWIG empfohlenen Methode bedient. Sie besteht
darin, dass man das in Spiritus conservirte Material in Wasser giesst. Die mit Alkohol erfüllten Thiere
steigen infolge ihres geringeren specifischen Gewichtes an die Oberfläche, werden von dort mit einem
feinen Netz weggenommen. Man muss wiederholt das Wasser abgiessen, das Material mit neuem Wasser
übergiessen, um die Entomostraceen einigermaassen vollständig zu erhalten.
Beim Unte rsu ch en sind folgende Regeln befolgt worden. Die Untersuchung erfolgte meist
in Glycerin, mit einer gleich zu erwähnenden Ausnahme. Gliedmaassen und andere innere Organe
wurden möglichst frei liegend, gewöhnlich nicht unter Druck von einem Deckglas gezeichnet. Die
Seitenansichten der Thiere stammen niemals von ganzen Thieren, nur von isolirten Schalen.
Ich halte diese Regel für so wichtig, dass ich noch einen Augenblick bei ihr verweilen will. Die
Unsicherheit in der Identificirung zahlreicher Arten stammt unzweifelhaft zum guten Theil
daher, dass die Bilder nach ganzen Thieren, nicht nach isolirten Schalen gezeichnet sind. Die Lage
des Thieres wird damit eine unsichere, eine genaue Profillage ist oft kaum möglich. Diese Schwierigkeit
fallt bei einer isolirten Schale natürlich weg, ebenso wie manche perspectifische Verkürzungen etc.,
welche das Bild zu einem unsicheren und ungenauen machen. Die Conturen, welche man bei der
Untersuchung isolirter Schalen erhält, sind viel schärfer, zudem bieten die Verschiedenheiten beider
Schalen oft brauchbare Merkmale.
Bei der Be sch re ib u n g wurde folgendes Verfahren angewandt: Auf das Schalenbild
wurde ein auf durchsichtiges Papier gezeichnetes quadratisches Netz gelegt. Um das Netz gleichzeitig als
Maassstab benutzen zu können, waren die Linien 10 mm von einander entfernt; der Uebersicbt-
lichkeit halber waren die Linien abwechselnd roth und schwarz gezeichnet. Das Netz wurde
derart auf ein Schalenbild gelegt, dass eine Linie die beiden hervorragendsten Punkte des Ventralrandes
und zwar des eigentlichen Sehalenrandes, nich t des Saumes (vergl. unten) berührte, diese Linie
wurde dann als Grundlinie für Höhenmessung etc. betrachtet. Bei Formen mit convexem Ventralrand,
wie sie gerade unter den Cypriden nicht selten sind, lässt diese Bestimmung leider im Stieh, ein
fester Anhalt, wie man die Schale zu orientiren hat, fehlt hier, doch wird man darüber kaum im
Zweifel sein. Das Netz gestattet ein rasches Urtheil darüber, wo jeder Punkt liegt, wie weit entfernt
vom Vorderrand und von der Grundlinie etc. Die Ausdrücke, die ich bei der Beschreibung derSchalen-
contur verwendet habe, bedürfen, glaube ich, keiner Erklärung, nur auf einen Punkt will ich noch aufmerksam
machen: Vergleicht man eine Schale mit einer Zeichnung, so wird man häufig glauben, einen
mehr oder weniger wesentlich anderen Verlauf der Linien zu erkennen. Zeichnet man mit dem Prisma
oder Spiegel den Schalenumriss nach, was ja eine Arbeit von wenigen Minuten ist, so wird man oft
eine unerwartete Uebereinstimmung finden. Der scheinbare Unterschied rührt wohl daher, dass die
Biegungen und Verdickungen des Schalenrandes uns leicht einen etwas anderen Verlauf vortäuschen.