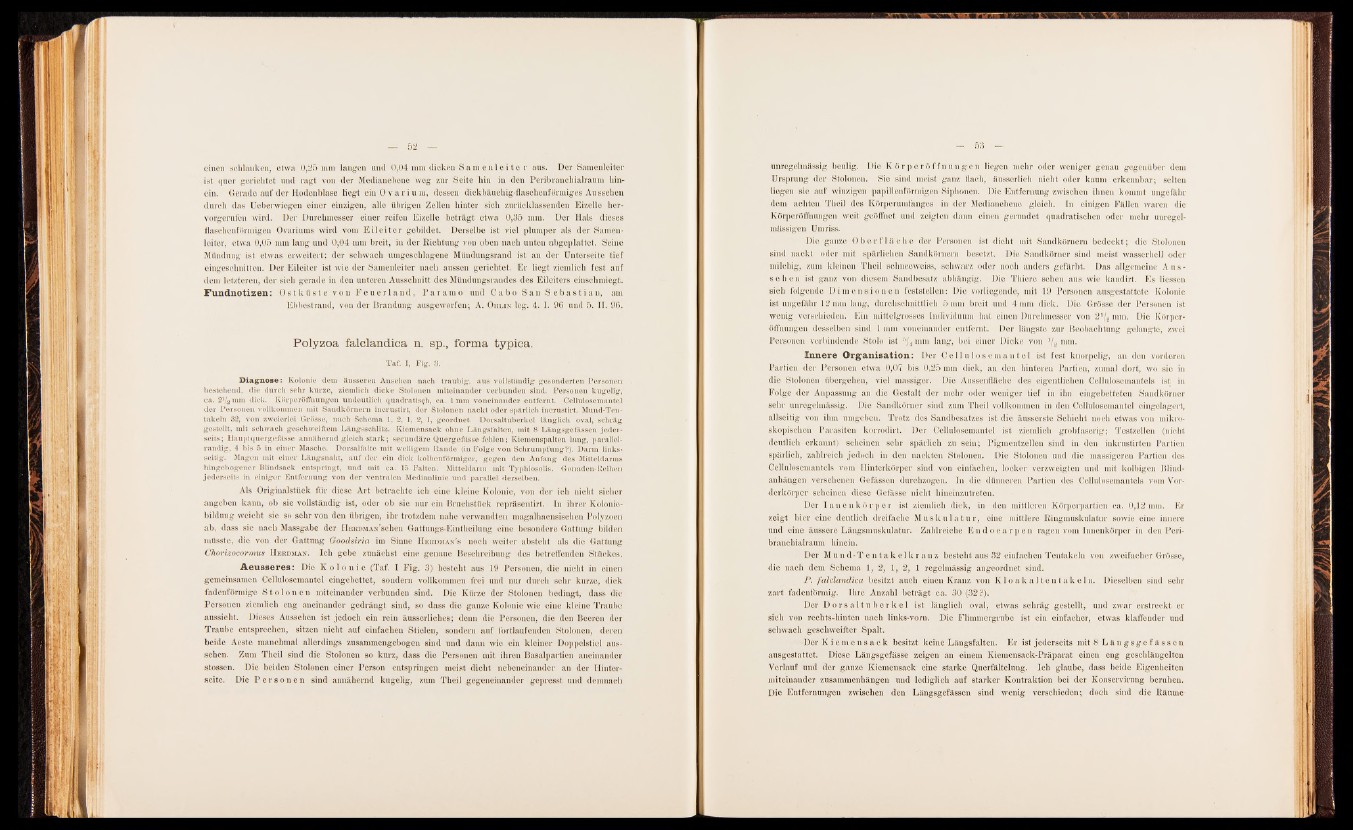
einen schlanken, etwa 0,25 mm langen und 0,04 mm dicken S a m e n 1 e i t e r aus. Der Samenleiter
ist quer gerichtet und ragt von der Medianebene weg zur Seite hin in den Peribranchialraum hinein.
Gerade auf der Hodenblase liegt ein Ovar i um, dessen dickbäuchig-flaschenförmiges Aussehen
durch das Ueberwiegen einer einzigen, alle übrigen Zellen hinter sich zurücklassenden Eizelle hervorgerufen
wird. Der Durchmesser einer reifen Eizelle bet ragt etwa 0 ,35 mm. Der Hals dieses
flaschenförmigen Ovariums wird vom Ei lei ter gebildet. Derselbe ist viel plumper als der Samenleiter,
etwa 0,05 mm lang und 0,04 mm breit, in der Richtung von oben nach unten abgeplattet. Seine
Mündung ist etwas erweitert; der schwach umgeschlagene Mündungsrand ist an der Unterseite tief
eingeschnitten. Der Eileiter ist wie der Samenleiter nach aussen gerichtet. Er liegt ziemlich fest auf
dem letzteren, der sich gerade in den unteren Ausschnitt des Mündungsrandes des Eileiters einschmiegt.
Fundnotizen: Os tk ü s t e von F e u e r l a n d , P a r amo und Cabo San Se b a s t i a n , am
Ebbestrand, von der Brandung ausgeworfen; A. O i i l in leg. 4. I. 9 6 und 5 . II. 9 6 .
P o ly z o a fa lc lan d ic a n. sp., fo rm a ty p ica.
Taf. I, F ig . 3.
Diagnose: Kolonie dem äusseren Ansehen nach traubig, aus v ollständ ig g eson d erten Personen
bestehend, die durch sehr kurze, ziemlich dicke Stolonen miteinander verbunden sind. Per sonen k ug e lig ,
ca. 2Vi mm dick. Körperöffnungen undeutlich quadratisch, ca. 1 mm von einan d er entfernt. Cellulosemantel
der Per sonen vollkommen mit Sandkörnern incrustirt, der Stolonen nack t oder spärlich incrustirt. Mund-Tentakeln
32, von zw eier le i Grösse, nach Schema 1, 2, 1, 2, 1, g eordnet. Dorsaltuberkcl länglich oval, schräg
gestellt, mit schwach geschw eiftem Längsschlitz. Kiemensack ohne L ängsfalten , mit 8 L ä n g sg e fä ssen jeder-
se its; Haup tq u erge fässe annähernd g le ich s ta r k ; secundäre Que rge fässe fe h len ; Kiemenspalten lang, parallel-
ran d ig, 4 bis 5 in eiuer Masche. Dorsalfalte mit we lligem Rande (in F o lg e v on Schrumpfung?). Darm linksse
itig . Magen mit ein e r Längsnaht, a u f der ein dick kolbenförmiger, g e g e n den A n fan g des Mitteldarms
h in g eb o g en e r Blindsack entspringt, und mit ca. 15 Falten. Mitteldarm mit Typhlosolis. Gonaden-Reihen
jed e r se its in e in ig er Entfernung von der ven tralen Medianlinie und parallel derselben.
Als Originalstück für diese Art betrachte ich eine kleine Kolonie, von der ich nicht sicher
angeben kann, ob sie vollständig ist, oder ob sie nur ein Bruchstück repräsentirt. In ihrer Koloniebildung
weicht sie so sehr von den übrigen, ihr trotzdem nahe verwandten magalhaensischen Polyzoen
ab, dass sie nach Massgabe der HERDMAN’schen Gattungs-Eintheilung eine besondere Gattung bilden
müsste, die von der Gattung Ooodsiria im Sinne H e r d m a n ’s noch weiter absteht als die Gattung
Chorizocormus H e r d m a n . Ich gebe zunächst eine genaue Beschreibung des betreffenden Stückes.
Aeusseres: Die K o l o n i e (Taf. I Fig. 3) besteht aus 19 Personen, die nicht in einen
gemeinsamen Cellulosemantel eingebettet, sondern vollkommen frei und nur durch sehr kurze, dick
fadenförmige S to lo n e n miteinander verbunden sind. Die Kürze der Stolonen bedingt, dass die
Personen ziemlich eng aneinander gedrängt sind, so dass die ganze Kolonie wie eine kleine Traube
aussieht. Dieses Aussehen ist jedoch ein rein äusserliches; denn die Personen, die den Beeren der
Traube entsprechen, sitzen nicht auf einfachen Stielen, sondern auf fortlaufenden Stolonen, deren
beide Aeste manchmal allerdings zusammengebogen sind und dann wie ein kleiner Doppelstiel aus-
sehen. Zum Theil sind die Stolonen so kurz, dass die Personen mit ihren Basalpartien aneinander
stossen. Die beiden Stolonen einer Person entspringen meist dicht nebeneinander an der Hinterseite.
Die P e r s o n e n sind annähernd kugelig, zum Theil gegeneinander gepresst und demnach
unregelmässig beulig. Die K ö r p e r Öf fnungen liegen mehr oder weniger genau gegenüber dem
Ursprung der Stolonen. Sie sind meist ganz flach, äusserlich nicht oder kaum erkennbar; selten
liegen sie auf winzigen papillenförmigen Siphonen. Die Entfernung zwischen ihnen kommt ungefähr
dem achten Theil des Körperumfanges in der Medianebene gleich. In einigen Fällen waren die
Körperöffnungen weit geöffnet und zeigten dann einen gerundet quadratischen oder mehr uuregel-
mässigen Umriss.
Die ganze Ob e r f l ä c h e der Personen ist dicht mit Sandkörnern bedeckt; die Stolonen
sind nackt oder mit spärlichen Sandkörnern besetzt. Die Sandkörner sind meist wasserhell oder
milchig, zum kleinen Theil sebneeweiss, schwarz oder noch anders gefä rbt. Das allgemeine Auss
e hen ist ganz von diesem Sandbesatz abhängig. Die Thiere sehen aus wie kandirt. Es Hessen
sich folgende Dime n s i o n e n feststellen: Die vorliegende, mit 19 Personen ausgestattete Kolonie
ist ungefähr 12 mm lang, durchschnittlich 5 mm breit und 4 mm dick. Die Grösse der Personen ist
wenig verschieden. Ein mittelgrosses Individuum hat einen Durchmesser von 2l/g mm. Die Körperöffnungen
desselben sind 1 mm voneinander entfernt. Der längste zur Beobachtung gelangte, zwei
Personen verbindende Stolo ist 5/4 mm lang, bei einer Dicke von xl2 mm.
Innere Organisation: Der C e 11 u 1 o s e m a n t e 1 ist fest knorpelig, an den vorderen
Partien der Personen etwa 0,07 bis 0,25 mm dick, an den hinteren Partien, zumal dort, wo sie in
die Stolonen übergehen, viel massiger. Die Aussenfläche des eig entliehen Cellulosemantels ist in
Folge der Anpassung an die Gestalt der mehr oder weniger tief in ihn eingebetteten Sandkörner
sehr unregelmässig. Die Sandkörner sind zum Theil vollkommen in den Ccllulosemantel eingelagert,
allseitig von ihm umgeben. Trotz des Sandbesatzes ist die äusserste Schicht noch etwas von mikroskopischen
Parasiten korrodirt. Der Cellulosemantel ist ziemlich grobfaserig; Testzellen (nicht
deutlich erkannt) scheinen sehr spärlich zu sein; Pigmentzellen sind in den inkrustirten Partien
spärlich, zahlreich jedoch in den nackten Stolonen. Die Stolonen und die massigeren Partien des
Cellulosemantels vom Hinterkörper sind von einfachen, locker verzweigten und mit kolbigen Blindanhängen
versehenen Gefässen durchzogen. In die dünneren Partien des Cellulosemantels vom Vorderkörper
scheinen diese Gefässe nicht hineinzutreten.
Der I n n e n k ö r p e r ist ziemlich dick, in den mittleren Körperpartien ca. 0,12mm. Er
zeigt hier eine deutlich dreifache Mus ku l a t u r , eine mittlere Ringmuskulatur sowie eine innere
und eine äussere Längsmuskulatur. Zahlreiche E n d o c a r p e n ragen vom Innenkörper in den Peribranchialraum
hinein.
Der Mun d -Te n t a k e l k r an z besteht aus 32 einfachen Tentakeln von zweifacher Grösse,
die nach dem Schema 1, 2, 1, 2, 1 regelmässig angeordnet sind.
P. falclandica besitzt auch einen Kranz von K lo a k a l t e n t a k e l n . Dieselben sind sehr
zart fadenförmig. Ihre Anzahl beträgt ca. 30 (32?).
Der Do r s a l t u b e r k e l ist länglich oval, etwas schräg gestellt, und zwar erstreckt er
sich von rechts-hinten nach links-vorn. Die Flimmergrube ist ein einfacher, etwas klaffender und
schwach geschweifter Spalt.
Der K i e m e n s a c k besitzt keine Längsfalten. Er ist jederseits mit 8 L ä n g s g e f ä s s e n
ausgestattet. Diese Längsgefässe zeigen an einem Kiemensack-Präparat einen eng geschlängelten
Verlauf und der ganze Kiemensack eine starke Querfältelung. Ich glaube, dass beide Eigenheiten
miteinander Zusammenhängen und lediglich auf starker Kontraktion bei der Konservirung beruhen.
Die Entfernungen zwischen den Längsgef ässen sind wenig verschieden; doch sind die Räume