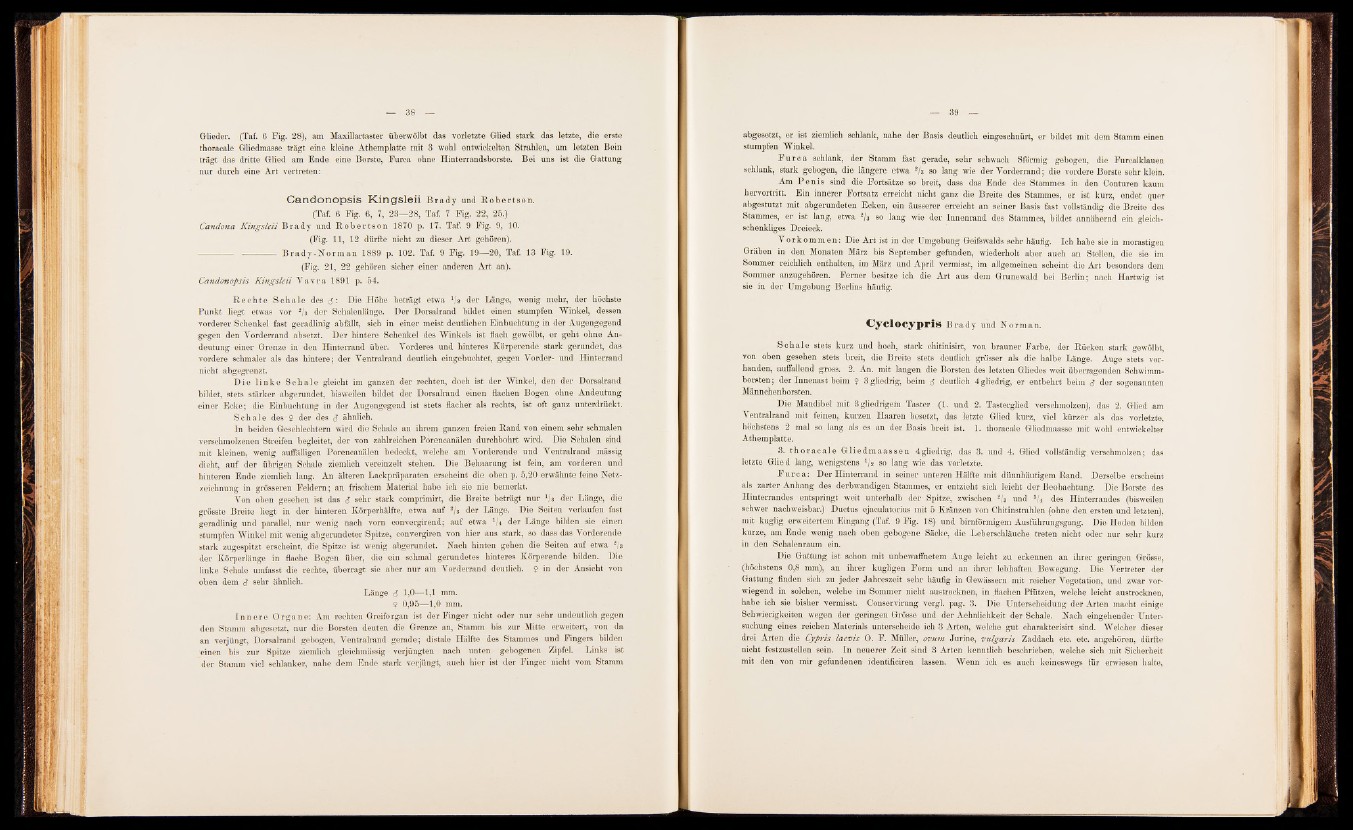
Glieder. (Taf. 6 Fig. 28), am Maxillartaster überwölbt das vorletzte Glied stark das letzte, die erste
thoracale Gliedmasse trägt eine kleine Athemplatte mit 3 wohl entwickelten Strahlen, am letzten Bein
trägt das dritte Glied am Ende eine Borste, Furca ohne Hinterrandsborste. Bei uns ist die Gattung
nur durch eine Art vertreten:
C a n d o n o p s is K in g sle ii B rady und Robe rtson.
(Taf. 6 Fig. 6, 7, 23—28, Taf. 7 Fig. 22, 25.)
Candona Kingsleii Brady und R o b e rtso n 1870 p. 17. Taf. 9 Fig. 9, 10.
(Fig. 11, 12 dürfte nicht zu dieser Art gehören).
---------- ---------- B rad y -N o rm an 1889 p. 102. Taf. 9 Fig. 19—20, Taf. 13 Fig. 19.
(Fig. 21, 22 gehören sicher einer anderen Art an).
Candonopsis Kingsleii Y avra 1891 p. 54.
R e ch te Schale des 3: Die Höhe beträgt etwa 1/a der Länge, wenig mehr, der höchste
Punkt liegt etwas vor 2/3 der Schalenlänge. Der Dorsalrand bildet einen stumpfen Winkel, dessen
vorderer Schenkel fast geradlinig abfällt, sich in einer meist deutlichen Einbuchtung in der Augengegend
gegen den Yorderrand absetzt. Der hintere Schenkel des Winkels ist flach gewölbt, er geht ohne Andeutung
einer Grenze in den Hinterrand über. Yorderes und hinteres Körperende stark gerundet, das
vordere schmaler als das hintere; der Yentralrand deutlich eingebuchtet, gegen Yorder- und Hinterrand
nicht abgegrenzt.
Die lin k e S chale gleicht im ganzen der rechten, doch ist der Winkel, den der Dorsalrand
bildet, stets stärker abgerundet, bisweilen bildet der Dorsalrand einen flachen Bogen ohne Andeutung
einer Ecke; die Einbuchtung in der Augengegend ist stets flacher als rechts, ist oft ganz unterdrückt.
Schale des 2 der des 3 ähnlich.
In beiden Geschlechtern wird die Schale an ihrem ganzen freien Rand von einem sehr schmalen
verschmolzenen Streifen begleitet, der von zahlreichen Porencanälen durchbohrt wird. Die Schalen sind
mit kleinen, wenig auffälligen Porencanälen bedeckt, welche am Yorderende und Yentralrand mässig
dicht, auf der übrigen Schale ziemlich vereinzelt stehen. Die Behaarung ist fein, am vorderen und
hinteren Ende ziemlich lang. An älteren Lackpräparaten erscheint die oben p. 5,20 erwähnte feine Netz-
zeiehnung in grösseren Feldern; an frischem Material habe ich sie nie bemerkt.
Yon oben gesehen ist das 3 sehr stark comprimirt, die Breite beträgt nur 1js der Länge, die
grösste Breite liegt in der hinteren Körperhälfte, etwa auf 2/3 der Länge. Die Seiten verlaufen fast
geradlinig und parallel, nur wenig nach vorn convergirend; auf etwa 1U der Länge bilden sie einen
stumpfen Winkel mit wenig abgerundeter Spitze, convergiren von hier aus stark, so dass das Yorderende
stark zugespitzt erscheint, die Spitze ist wenig abgerundet. Nach hinten gehen die Seiten auf etwa 2/3
der Körperlänge in flache Bogen über, die ein schmal gerundetes hinteres Körperende bilden. Die
linke Schale umfasst die rechte, überragt sie aber nur am Yorderrand deutlich. 2 in der Ansicht von
oben dem 3 sehr ähnlich.
Länge 3 1,0—1,1 mm.
2 0,95—1,0 mm.
In n e re Organe: Am rechten Greiforgan ist der Finger nicht oder nur sehr undeutlich gegen
den Stamm abgesetzt, nur die Borsten deuten die Grenze an, Stamm bis zur Mitte erweitert, von da
an verjüngt, Dorsalrand gebogen, Yentralrand gerade; distale Hälfte des Stammes und Fingers bilden
einen bis zur Spitze ziemlich gleichmässig verjüngten nach unten gebogenen Zipfel. Links ist
der Stamm viel schlanker, nahe dem Ende stark verjüngt, auch hier ist der Finger nicht vom Stamm
abgesetzt, er ist ziemlich schlank, nahe der Basis deutlich eingeschnürt, er bildet mit dem Stamm einen
stumpfen Winkel..
F u rc a schlank, der Stamm fast gerade, sehr schwach Sförmig gebogen, . die Furcalklauen
schlank, stark gebogen, die längere etwa 2/3 so lang wie der Yorderrand; die vordere Borste sehr klein.
Am Pen is sind die Fortsätze so breit, dass das Ende des Stammes in den Conturen kaum
hervortritt. Ein innerer Fortsatz erreicht nicht ganz die Breite des Stammes, er ist kurz, endet quer
abgestutzt mit. abgerundeten Ecken, ein äusserer erreicht an seiner Basis fast vollständig die Breite des
Stammes, er ist lang, etwa 2/s so lang wie der Innenrand des Stammes, bildet annähernd ein gleichschenkliges
Dreieck.
Y 0 r k 0 m m e n : Die Art ist in der Umgebung Geifswalds sehr häufig. Ich habe sie in morastigen
Gräben in den Monaten März bis September gefunden, wiederholt aber auch an Stellen, die sie im
Sommer reichlich enthalten, im März und April vermisst, im allgemeinen scheint die Art besonders dem
Sommer anzugehören. Ferner besitze ich die Art aus dem Grunewald bei Berlin; nach Hartwig ist
sie in der Umgebung Berlins häufig.
Cyclocypris B rad y und Norman.
Schale stets kurz und hoch, stark chitinisirt, von brauner Farbe, der Rücken stark gewölbt,
von oben gesehen stets breit, die Breite stets deutlich grösser als die halbe Länge. Auge stets vorhanden,
auffallend gross. 2. An. mit langen die Borsten des letzten Gliedes weit überragenden Schwimmborsten;
der Innenast beim 2 3gliedrig, beim 3 deutlich 4gliedrig, er entbehrt beim 3 der sogenannten
Männchenborsten.
Die Mandibel mit 3gliedrigein Taster (1. und 2. Tasterglied verschmolzen), das 2. Glied am
Yentralrand mit feinen, kurzen Haaren besetzt, das letzte Glied kurz, yiel kürzer als das vorletzte,
höchstens 2 mal so lang als es an der Basis breit ist. 1. thoracale Gliedmaasse mit wohl entwickelter
Athemplatte.
_ 3. th o ra c a le Gliedmaassen 4gliedrig, das 3. und 4. Glied vollständig verschmolzen; das
letzte Glied lang, wenigstens V2 so lang wie das vorletzte.
F u rc a : Der Hinterrand in seiner unteren Hälfte mit dünnhäutigem Rand Derselbe erscheint
als zarter Anhang des derbwandigen Stammes, er entzieht sich leicht der Beobachtung. Die Borste des
Hinterrandes entspringt weit unterhalb der Spitze, zwischen 2/3 und 3/* des Hinterrandes (bisweilen
schwer nachweisbar.) Ductus ejaculatorius mit 5 Kränzen von Chitinstrahlen (ohne den ersten und letzten),
mit kuglig erweitertem Eingang (Taf. 9 Fig. 18) und bimförmigem Ausführungsgang. Die Hoden bilden
kurze, am Ende wenig .nach oben gebogene Säcke, die Leberschläuche treten nicht oder nur sehr kurz
in den Schalenraum ein.
Die Gattung ist schon mit unbewaffnetem Auge leicht zu erkennen an ihrer geringen Grösse,
(höchstens 0,8 mm), an ihrer kugligen Form und an ihrer lebhaften Bewegung. Die Vertreter der
Gattung finden sich zu jeder Jahreszeit sehr häufig in Gewässern, mit reicher Vegetation, und zwar vorwiegend
in solchen, welche im Sommer nicht austrocknen, in flachen Pfützen, welche leicht austrocknen,
habe ich sie bisher vermisst. Conservirung vergl. pag. 3. Die Unterscheidung: der Arten macht einige
Schwierigkeiten wegen der geringen Grösse und der Aehnlichkeit der Schale. Nach eingehender Untersuchung
eines reichen Materials unterscheide ich 3 Arten, welche gut charakterisirt sind. Welcher dieser
drei Arten die Cypris laevis O. F. Müller, ovum Jurine, vulgaris Zaddach etc. etc. angehören, dürfte
nicht festzustellen sein. In neuerer Zeit sind 3 Arten kenntlich beschrieben, welche sich mit Sicherheit
mit den von mir gefundenen identificiren lassen. Wenn ich es auch keineswegs für erwiesen halte,