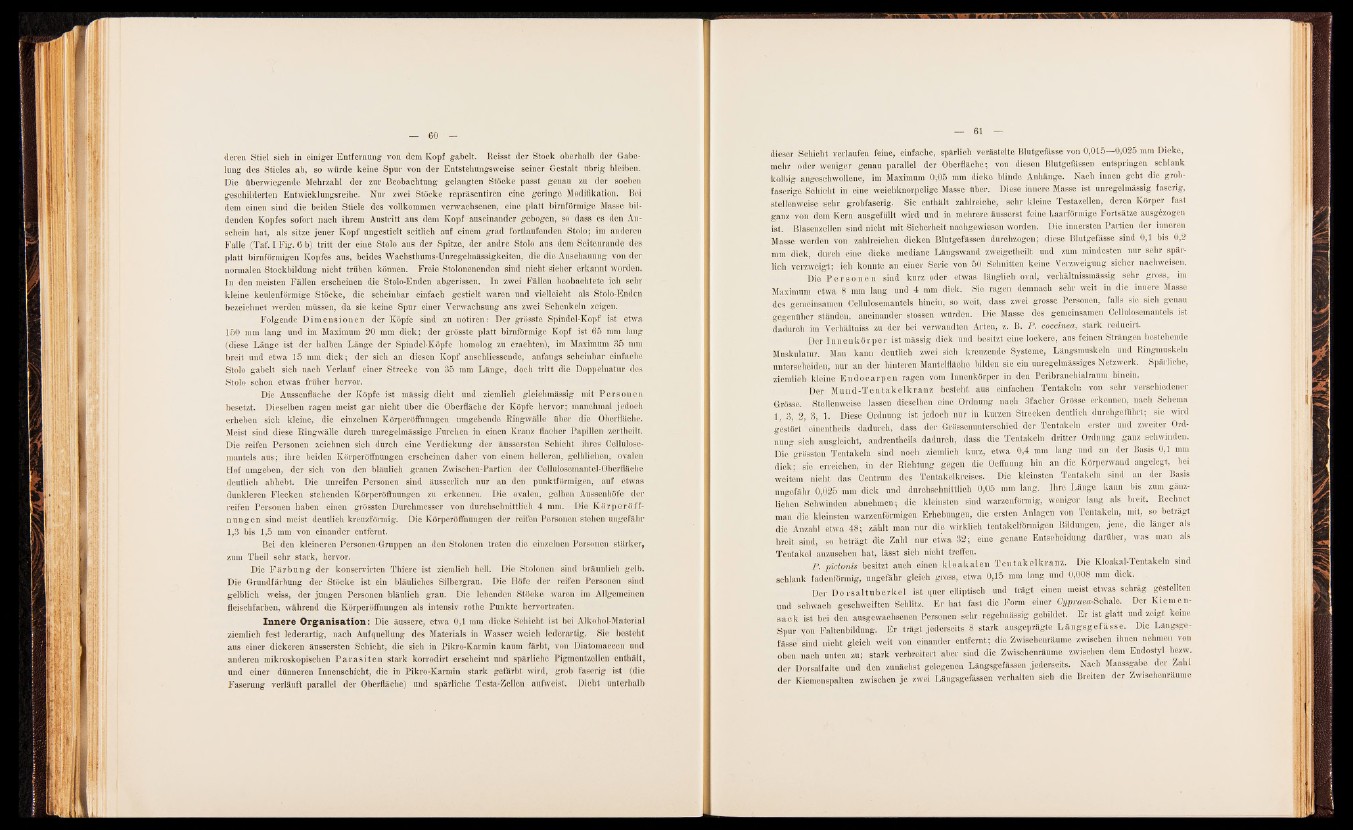
deren Stiel sich in einiger Entfernung von dem Kopf gabelt. Reisst der Stock oberhalb der Gabelung
des Stieles ab, so würde keine Spur von der Entstehungsweise seiner Gestalt übrig bleiben.
Die überwiegende Mehrzahl der zur Beobachtung gelangten Stöcke passt genau zu der soeben
geschilderten Entwicklungsreihe. Nur zwei Stöcke repräsentiren eine geringe Modifikation. Bei
dem einen sind die beiden Stiele des vollkommen verwachsenen, eine platt bimförmige Masse bildenden
Kopfes sofort nach ihrem Austritt aus dem Kopf auseinander gebogen, so dass es den Anschein
hat, als sitze jener Kopf ungestielt seitlich auf einem grad fortlaufenden Stolo; im anderen
Falle (Taf. I Fig. 6 b) tritt der eine Stolo aus der Spitze, der andre Stolo aus dem Seitenrande des
platt bimförmigen Kopfes aus, beides Wachsthums-Unregelmässigkeiten, die die Anschauung von der
normalen Stockbildung nicht trüben können. Freie Stolonenenden sind nicht sicher erkannt worden.
In den meisten Fällen erscheinen die Stolo-Enden abgerissen. In zwei Fällen beobachtete ich sein-
kleine keulenförmige Stöcke, die scheinbar einfach gestielt waren und vielleicht als Stolo-Enden
bezeichnet werden müssen, da sie keine Spur einer Verwachsung aus zwei Schenkeln zeigen.
Folgende Dimensionen der Köpfe sind zu notiren: Der grösste Spindel-Kopf ist etwa
150 mm lang und im Maximum 20 mm dick; der grösste platt bimförmige Kopf ist 65 mm lang
(diese Länge ist der halben Länge der Spindel-Köpfe homolog zu erachten), im Maximum 35 mm
breit und etwa 15 mm dick; der sich an diesen Kopf anschliessende, anfangs scheinbar einfache
Stolo gabelt sich nach Verlauf einer Strecke von 35 mm Länge, doch tritt die Doppelnatur des
Stolo schon etwas früher hervor.
Die Aussenfläche der Köpfe ist mässig dicht und ziemlich gleichmässig mit Personen
besetzt. Dieselben ragen meist gar nicht über die Obei-fläche der Köpfe hervor; manchmal jedoch
erheben sich kleine, die einzelnen Körperöffnungen umgebende Ringwälle über die Oberfläche.
Meist sind diese Ringwälle durch unregelmässige Furchen in einen Kranz flacher Papillen zertheilt.
Die reifen Personen zeichnen sich durch eine Verdickung der äussersten Schicht ihres Cellulosemantels
aus; ihre beiden Körperöffnungen erscheinen daher von einem helleren, gelblichen, ovalen
Hof umgeben, der sich von den bläulich grauen Zwischen-Partien der Cellulosemantel-Oberfläche
deutlich abhebt. Die unreifen Personen sind äusserlieh nur an den punktförmigen,, auf etwas
dunkleren Flecken stehenden Körperöffnungen zu erkennen. Die ovalen, gelben Aussenhöfe der
reifen Personen haben einen grössten Durchmesser von durchschnittlich 4 mm. Die Körperöffnungen
sind meist deutlich kreuzförmig. Die Körperöffnungen der reifen Personen stehen ungefähr
1,3 bis 1,5 mm von einander entfernt. -
Bei den kleineren Personen-Gruppen an den Stolonen treten die einzelnen Personen stärker,
zum Theil sehr, stark, hervor.
Die Färbung der konservirten Thiere ist ziemlich hell. Die Stolonen sind bräunlich gelb.
Die Grundfärbung der Stöcke ist ein bläuliches Silbergrau. Die Höfe der reifen Personen sind
gelblich weiss, der jungen Personen bläulich grau. Die lebenden Stöcke waren im Allgemeinen
fleischfarben, während die Körperöffnungen als intensiv rothe Punkte hervortraten;
In n e re O rg a n is a tio n : Die äussere, etwa 0,1 mm dicke Schicht ist bei Alkohol-Material
ziemlich fest lederartig, nach Aufquellung des Materials in Wasser weich lederartig. Sie besteht
aus einer dickeren äussersten Schicht, die sich in Pikro-Karmin kaum färbt, von Diatomaceen und
anderen mikroskopischen Parasi ten stark korrodirt erscheint und spärliche Pigmentzellen enthält,
und einer dünneren Innenschicht, die in Pikro-Karmin stark gefärbt wird, grob faserig ist (die
Faserung verläuft parallel der Oberfläche) und spärliche Testa-Zellen aufweist. Dicht unterhalb
dieser Schicht verlaufen feine, einfache, spärlich verästelte Blutgefässe von 0,015—0,025 mm Dicke,
mehr oder weniger genau parallel der Oberfläche; von diesen Blutgefässen entspringen schlank
kolbig angeschwollene, im Maximum 0,05 mm dicke blinde Anhänge. Nach innen geht die grobfaserige
Schicht in eine weichknorpelige Masse über. Diese innere Masse ist unregelmässig faserig,
stellenweise sehr grobfaserig. Sie enthält zahlreiche, sehr kleine Testazellen, deren Körper fast
ganz von dem Kern ausgefüllt wird und in mehrere äusserst feine haarförmige Fortsätze ausgézogen
ist. Blasenzellen sind nicht mit Sicherheit nachgewiesen worden. Die innersten Partien der inneren
Masse werden von zahlreichen dicken Blutgefässen durchzogen; diese Blutgefässe sind 0,1 bis 0,2
mm dick, durch eine dicke mediane Längswand zweigetheilt und zum mindesten nur sehr spärlich
verzweigt; ich konnte an einer Serie von 50 Schnitten keine Verzweigung sicher nachweisen.
Die P e r s o n e n sind kurz oder etwas länglich oval, verhältnissmässig sehr gross, im
Maximum etwa 8 mm lang und 4 mm dick. Sie ragen demnach sehr weit in die innere Masse
des gemeinsamen Cellulosemantels hinein, so weit, dass zwei grosse Personen, falls sie sich genau
gegenüber ständen, aneinander stossen würden. Die Masse des gemeinsamen Cellulosemantels ist
dadurch im Verhältniss zu der bei verwandten Arten, z. B. P. coccínea, stark reducirt.
Der Innenkörper ist mässig dick und besitzt eine lockere, aus feinen Strängen bestehende
Muskulatur. Man kann deutlich zwei sich kreuzende Systeme, Längsmuskeln und Ringmuskeln
unterscheiden, nur an der hinteren Mantelfläche bilden sie ein unregelmässiges Netzwerk. Spärliche,
ziemlich kleine Endoearpen ragen vom Innenkörper in den Peribranchialraum hinein.
Der Mund-Tentakelkranz besteht aus einfachen Tentakeln von sehr verschiedener
Grösse. Stellenweise lassen dieselben eine Ordnung nach 3faeher Grösse erkennen, nach Schema
1 .3 2, 3, 1. Diese Ordnung ist jedoch nur in kurzen Strecken deutlich durchgeführt; sie wird
gestört einentheils dadurch, dass der Grössenunterschied der Tentakeln erster und zweiter Ordnung
sich ausgleicht, andrentheils dadurch, dass die Tentakeln dritter Ordnung ganz schwinden.
Die grössten Tentakeln sind noch ziemlich kurz, etwa 0,4 mm lang und an der Basis 0,1 mm
dick; sie erreichen, in der Richtung gegen die Oeffnung hin an die Körperwand angelegt, bei
weitem nicht das Centrum des Tentakelkreises. Die kleinsten Tentakeln sind an der Basis
ungefähr 0,025 mm dick und durchschnittlich 0,05 mm lang. Ihre Länge kann bis zum gänzlichen
Schwinden abnehmen; die kleinsten sind warzenförmig, weniger lang als breit. Rechnet
man die kleinsten warzenförmigen Erhebungen, die ersten Anlagen von Tentakeln, mit, so betragt
die Anzahl etwa 48; zählt man nur die wirklich tentakelförmigen Bildungen, jene, die länger als
breit sind, so beträgt die Zahl nur etwa 32; eine genaue Entscheidung darüber, was man als
Tentakel anzusehen hat, lässt sich nicht treffen.
P. piäonis besitzt auch einen kloakalen Tentakelkranz. Die Kloakal-Tentakeln sind
scihlank faden#pnig, ungefähr gleich gross, etwa 0,16.mm lang und 0,p08.mm dick.
Der Dorsal tuberkel ist quer elliptisch und trägt ¡einen meist etwas schräg gestellten
und schwach geschweiften Schlitz. Er hat fast die Form einer CypraearSeU\e. Der Kiemensack
ist bei den ausgewachsenen Personen sehr regelmässig gebildet. Er ist glatt und zeigt keine
Spur von Faltenbildung. Er trägt jederseits 8 stark ausgeprägte Längsgefässe. Die Längsgefässe**'
sind nicht gleich weit von einander entfernt ; „die Zwischenräume zwischen ihnen nehmen von
oben nach unten zu; stark verbreitert aber sind die Zwischenräume zwischen dem Endostyl bezw.
der Dorsalfalte und den . zunächst gelegenen Längsgefässen jederseits. Nach Maassgabe der Zahl
der Kiemenspalten zwischen je zwei Längsgefässen verhalten sich die Breiten der Zwischenräume