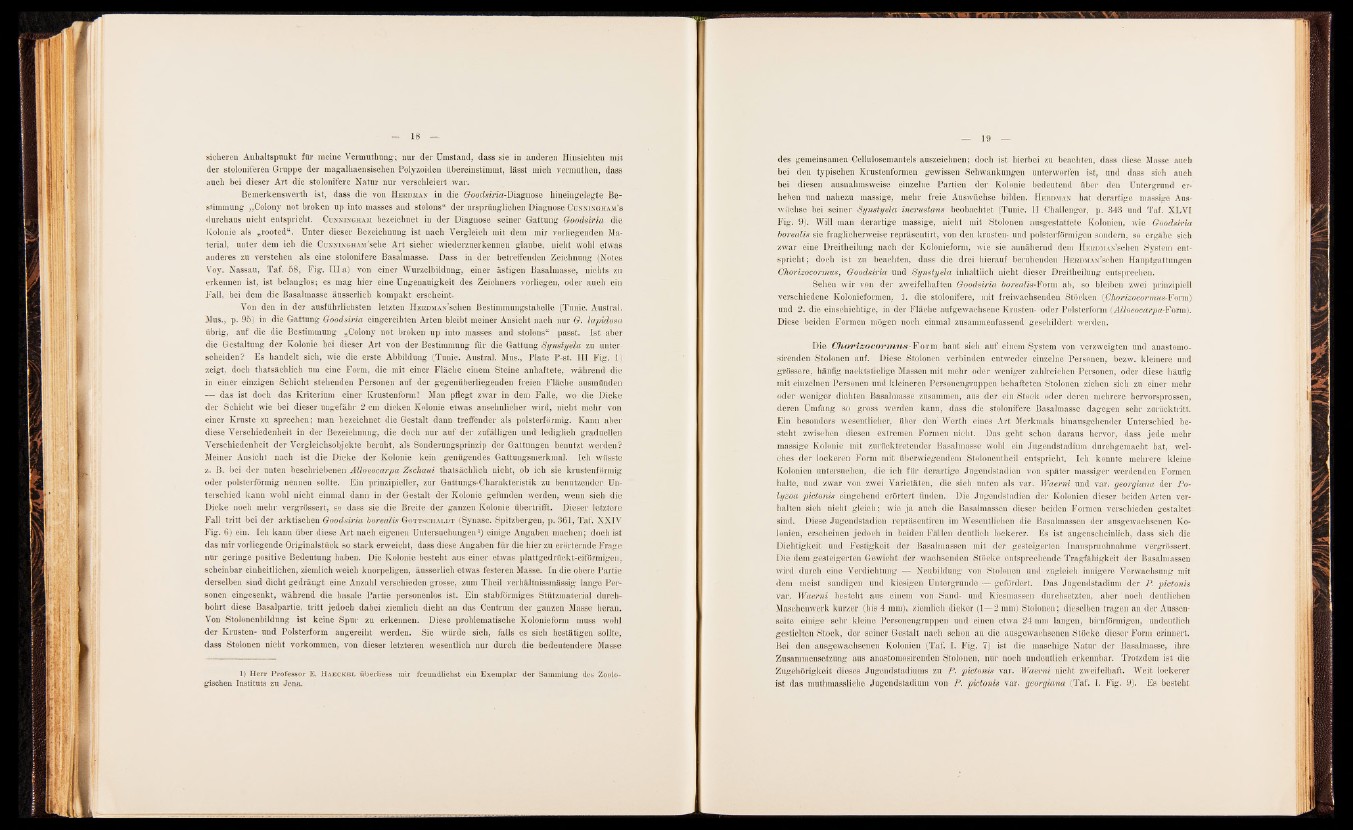
sicheren Anhaltspunkt für meine Vermuthung; nur der Umstand, dass sie in anderen Hinsichten mit
der stoloniferen Gruppe der magalhaensischen Polyzoiden übereinstimmt, lässt mich vermuthen, dass
auch bei dieser Art die stolonifere Natur nur verschleiert war.
Bemerkenswerth ist, dass die von Herdman in die Goodsiria-Diagnose hineingelegte Bestimmung
„Colony not broken up into masses and stoions“ der ursprünglichen Diagnose Cunningham’s
durchaus nicht entspricht. Cunningham bezeichnet in der Diagnose seiner Gattung Goodsiria die
Kolonie als „rooted“. Unter dieser Bezeichnung ist nach Vergleich mit dem mir vorliegenden Material,
unter dem ich die CuNNiNGHAM’sche Art sicher wiederzuerkennen glaube, nicht wohl etwas
anderes zu verstehen als eine stolonifere Basalmasse. Dass in der betreffenden Zeichnung (Notes
Voy. Nassau, Taf. 58, Fig. III a) von einer Wurzelbildung, einer ästigen Basalmasse, nichts zu
erkennen ist, ist belanglos; es mag hier eine Ungenauigkeit des Zeichners vorliegen, oder auch ein
Fall, bei dem die Basalmasse äusserlicb kompakt erscheint.
Von den in der ausführlichsten letzten HERDMAN’schen Bestimmüngstabelle (Tunic. Austral.
Mus., p. 95) in die Gattung Goodsiria eingereihten Arten bleibt meiner Ansicht nach nur G. lapidosa
übrig, auf die die Bestimmung „Colony not broken up into masses and stoions“ passt. Ist aber
die Gestaltung der Kolonie bei dieser Art von der Bestimmung für die Gattung Synstyela zu unterscheiden?
Es handelt sich, wie die erste Abbildung (Tunic. Anstral. Mus., Plate P-st. III Fig. 1)
zeigt, doch thatsächlich um eine Form, die mit einer Fläche einem Steine anhaftete, während die
in einer einzigen Schicht stehenden Personen auf der gegenüberliegenden freien Fläche ausmünden
— das ist doch das Kriterium einer Krustenform! Man pflegt zwar in dem Falle, wo die Dicke
der Schicht wie bei dieser ungefähr 2 cm dicken Kolonie etwas ansehnlicher wird, nicht mehr von
einer Kruste zu sprechen; man bezeichnet die Gestalt dann treffender als polsterförmig. Kann aber
diese Verschiedenheit in der Bezeichnung, die doch nur auf der zufälligen und lediglich graduellen
Verschiedenheit der Vergleichsobjekte beruht, als Sonderungsprinzip der Gattungen benutzt werden?
Meiner Ansicht nach ist die Dicke der Kolonie kein genügendes Gattungsmerkmal. Ich wüsste
z. B. bei der unten beschriebenen Alloeocarpa Zschaui thatsächlich nicht, ob ich sie krustenförmig
oder polsterförmig nennen sollte. Ein prinzipieller, zur Gattungs-Charakteristik zu benutzender Unterschied
kann wohl nicht einmal dann in der Gestalt der Kolonie gefunden werden, wenn sich die
Dicke noch mehr vergrössert, so dass sie die Breite der ganzen Kolonie übertrifft. Dieser letztere
Fall tritt bei der arktischen Goodsiria borealis Gottschaldt (Synasc. Spitzbergen, p. 361, Taf. XXIV
Fig. 6) ein. Ich kann über diese Art nach eigenen Untersuchungen1) einige Angaben machen; doch ist
das mir vorliegende Originalstück so stark erweicht, dass diese Angaben für die hier zu erörternde Frage
nur geringe positive Bedeutung haben. Die Kolonie besteht aus einer etwas plattgedriiekt-eiförmigen,
scheinbar einheitlichen, ziemlich weich knorpeligen, äusserlich etwas festeren Masse. In die obere Partie
derselben sind dicht gedrängt eine Anzahl verschieden grosse, zum Theil verhältnissmässig lange Personen
eingesenkt, während die basale Partie personenlos ist. Ein stabförmiges Stützmaterial durchbohrt
diese Basalpartie, tritt jedoch dabei ziemlich dicht an das Centrum der ganzen Masse heran.
Von Stolonenbildung ist keine Spur zu erkennen. Diese problematische Kolonieform muss wohl
der Krusten- und Polsterform angereiht werden. Sie würde sich, falls es sich bestätigen sollte,
dass Stolonen nicht Vorkommen, von dieser letzteren wesentlich nur durch die bedeutendere Masse
1) Herr Professor E. Haeckel überliess mir freundlichst ein Exemplar der Sammlung des Zoolog
isch en Instituts zu Jena.
des gemeinsamen Cellulosemantels auszeichnen; doch ist hierbei zu beachten, dass diese Masse auch
bei den typischen Krustenformen gewissen Schwankungen unterworfen ist, und dass sich auch
bei diesen ausnahmsweise einzelne Partien der Kolonie bedeutend über den Untergrund erbeben
und nahezu massige, mehr freie Auswüchse bilden. Herdman hat derartige massige Auswüchse
bei seiner Synstyela incrustans beobachtet (Tunic. II Challenger, p. 343 und Taf. XLVI
Fig. 9). Will man derartige massige, nicht mit Stolonen ausgestattete Kolonien, wie Goodsiria
borealis sie fraglicherweise repräsentirt, von den krusten- und polsterförmigen sondern, so ergäbe sich
zwar eine Dreitheilung nach der Kolonieförm, wie sie annähernd dem HERDMAN’schen System entspricht;
doch ist zu beachten, dass die drei hierauf beruhenden HERDMAN’schen Hauptgattungen
Chorizocormus, Goodsiria und Synstyela inhaltlich nicht dieser Dreitheilung entsprechen.
Sehen wir von der zweifelhaften Goodsiria borealis-Form ab, so bleiben zwei prinzipiell
verschiedene Kolonieformen. 1. die stolonifere, mit freiwachsenden Stöcken {Chorizocormus-Form)
und 2. die einschichtige, in der Fläche aufgewachsene Krusten- oder Polsterform {Alloeocarpa-Form).
Diese beiden Formen mögen noch einmal zusammenfassend geschildert werden.
Die C h o rizo co rm u s -Form baut sieh auf einem System von verzweigten und anastomo-
sirenden Stolonen auf. Diese Stolonen verbinden entweder einzelne Personen, bezw. kleinere und
grössere, häufig nacktstielige Massen mit mehr oder weniger zahlreichen Personen, oder diese häufig
mit einzelnen Personen und kleineren Personengruppen behafteten Stolonen ziehen sich zu einer mehr
oder weniger dichten Basalmasse zusammen, aus der ein Stock oder deren mehrere hervorsprossen,
deren Umfang so gross werden kann, dass die stolonifere Basalmasse dagegen sehr zurücktritt.
Ein besonders wesentlicher, über den Werth eines Art Merkmals hinausgehender Unterschied besteht
zwischen diesen extremen Formen nicht. Das geht schon daraus hervor, dass jede mehr
massige Kolonie mit zurücktretender Basalmasse wohl ein Jngendstadium durchgemacht hat, welches
der lockeren Form mit überwiegendem Stolonentheil entspricht. Ich konnte mehrere kleine
Kolonien untersuchen; • die ich für derartige Jugendstadien von später massiger werdenden Formen
halte, und zwar von zwei Varietäten, die sich unten als var. Waerni und var. georgiana der Polyzoa
pictonis eingehend erörtert finden. Die Jugendstadien der Kolonien dieser beiden Arten verhalten
sich nicht gleich; wie ja auch die Basalmassen dieser beiden Formen verschieden gestaltet,
sind. Diese Jugendstadien repräsentiren im Wesentlichen die Basalmassen der ausgewachsenen Kolonien,
erscheinen jedoch in beiden Fällen deutlieh lockerer. Es ist augenscheinlich, dass sich die
Dichtigkeit und Festigkeit der Basalmassen mit der gesteigerten Inanspruchnahme vergrössert.
Die dem gesteigerten Gewicht der wachsenden Stöcke entsprechende Tragfähigkeit der Basalmassen
wird durch eine Verdichtung — Neubildung von Stolonen und zugleich innigere Verwachsung mit
dem meist sandigen und kiesigen Untergründe — gefördert. Das Jugendstadium der P. pictonis
var. Waerni besteht aus einem von Sand- und Kiesmassen durchsetzten, aber ‘noch deutlichen
Maschenwerk kurzer (bis 4 mm), ziemlich dicker (1—2 mm) Stolonen; dieselben tragen an der Aussen-
seite einige sehr kleine Personengruppen und einen etwa 24mm langen, bimförmigen, undeutlich
gestielten Stock, der seiner Gestalt nach schon an die ausgewachsenen Stöcke dieser Form erinnert.
Bei den ausgewachsenen Kolonien (Taf. I. Fig. 7) ist die maschige Natur der Basalmasse, ihre
Zusammensetzung aus anastomosirenden Stolonen, nur noch undeutlich erkennbar. Trotzdem ist die
Zugehörigkeit dieses Jugendstadiums zu P. pictonis var. Waerni nicht zweifelhaft. Weit lockerer
ist das muthmassliclie Jugendstadium von P. pictonis var. georgiana (Taf. I. Fig. 9). Es besteht