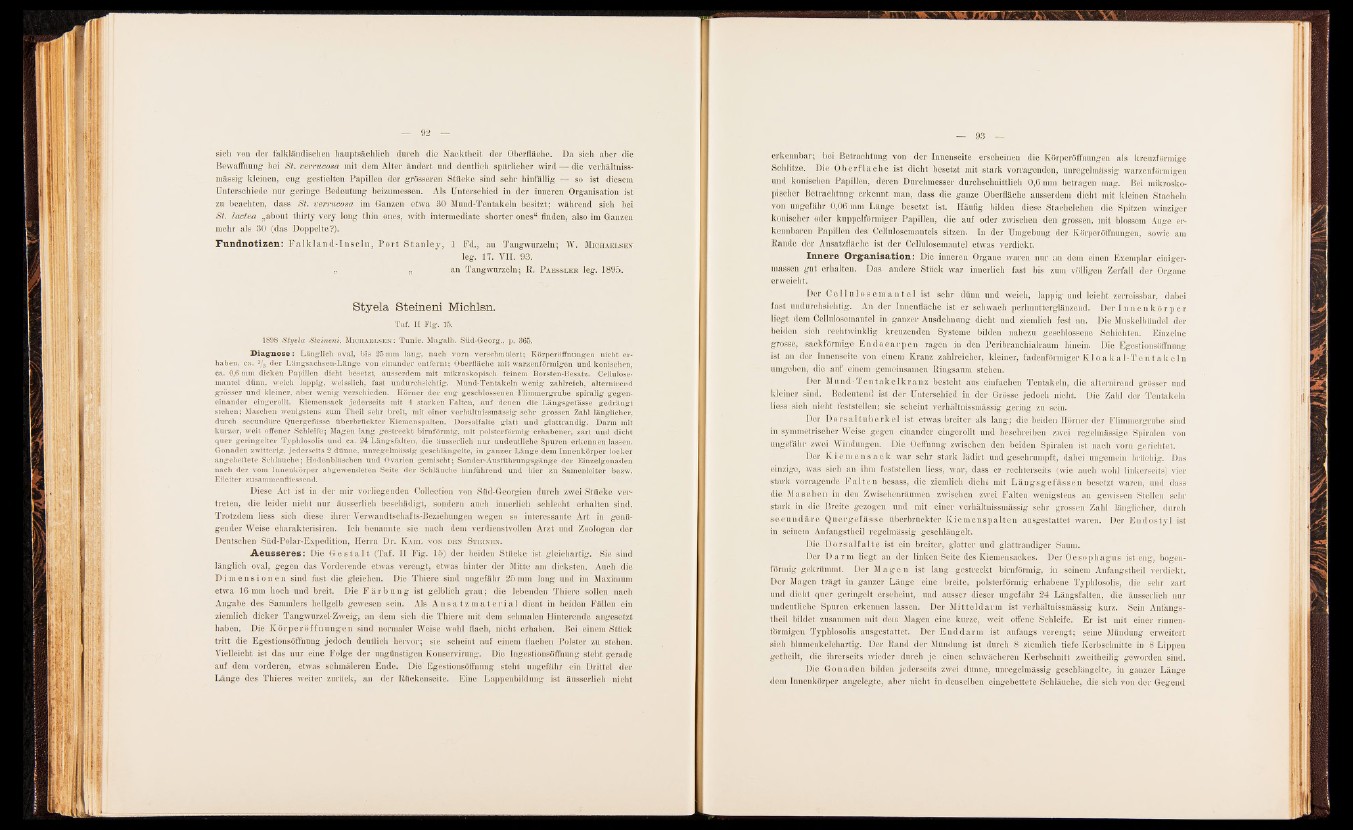
sich von der falkländischen hauptsächlich durch die Nacktheit der Oberfläche. Da sich aber die
Bewaffnung bei St. verrucosa mit dem Alter ändert und deutlich spärlicher wird — die verhältniss-
mässig kleinen, eng gestielten Papillen der grösseren Stücke sind sehr hinfällig — so ist diesem
Unterschiede nur geringe Bedeutung beizumessen. Als Unterschied in der inneren Organisation ist
zu beachten, dass St. verrucosa im Ganzen etwa 30 Mund-Tentakeln besitzt; während sich bei
St. lactea „about thirty very long thin ones, with intermediate shorter ones“ finden, also im Ganzen
mehr als 30 (das Doppelte?).
Fundnotizen: Fal kl and- Ins el n, Port Stanley, 1 . Fd., an Tangwurzeln; W. Mich a elsen
leg. 17. VII. 93.
■ l ' y „ an Tang wurzeln; R. Paessler leg. 1895.
S ty e la Ste in en i Michlsn.
Taf. II F ig . 15.
1898 S ty e la S te in en i, M i c h a e l s e n : Tunic. Magalh. Süd-Georg., p. 365.
Diagnose : L äng lich oval, bis 25 mm lang, nach vorn verschmälert; Körperöffnungen nicht erhaben,
ca. y 3 der L äng sa chsen-L än g e von einander entfernt; Oberfläche mit warzenförmigen und konischen,
ca. 0,6 mm d icken Papillen dicht b esetzt, ausserdem mit mikroskopisch feinem Borsten-Besatz. Cellulosemantel
dünn, weich lappig, weisslich, fast undurchsichtig. Mund-Tentakeln w en ig zahlreich, alternirend
grösse r und kleiner, aber w en ig v erschieden. Hörner d er en g g eschlo ssen en Flimmergrube spiralig g e g e n einander
eingerollt. Kiemensack jede rseits mit 4 starken Falten, a u f denen d ie L ä n g sg e fä sse g ed rän g t
stehen; Maschen wenigstens zum The il sehr breit, mit einer verhältnissmässig sehr g ro ssen Zahl länglicher,
durch secun d are Quergefässe überbrückter Kiemenspalten. Dorsa lfa lte g la tt u nd gla ttrand ig . Darm mit
kurzer, w e it offener Schleife; Magen la n g g e str e ck t bim fö rm ig , mit polsterförmig erhabener, zart und dicht
quer g e r in g e lte r Typhlosolis u nd ca. 24 L äng sfa lten , die äusserlich nur undeutliche Spuren erkennen lassen.
Gonaden zwitterig, jede rseits 2 dünne, u n r eg e lm ä ssig g eschlän gelte , in gan z e r L ä n g e dem Innenkörper locker
an g eh eftete Schläuche; Hodenbläsehen und Ovarien gem ischt; S onder -Ausführungsgänge der Einze lgonaden
nach der vom Innenkörper ab g ew end eten S e ite der Schläuche hinführend und hier zu S amenleiter bezw.
Eileiter zusammenfliessend.
Diese Art ist in der mir vorliegenden Collection von Süd-Georgien durch zwei Stücke vertreten,
die leider nicht nur äusserlich beschädigt,. sondern auch innerlich schlecht erhalten sind.
Trotzdem liess sich diese ihrer Verwandtschafts-Beziehungen wegen so interessante Art in genügender
Weise eharakterisiren. Ich benannte sie nach dem verdienstvollen Arzt und Zoologen der
Deutschen Stid-Polar-Expedition, Herrn Dr. Karl von den Steinen.
Aeusseres: Die Ge s t a l t (Taf. II Fig. 15) der beiden Stücke ist gleichartig. Sie sind
länglich oval, gegen das Vorderende etwas verengt, etwas hinter der Mitte am dicksten. Auch die
Dime n s i o n e n sind fast die gleichen. Die Thiere sind ungefähr 25mm lang und im Maximum
etwa 16mm hoch und breit. Die F ä r b u n g ist gelblich grau; die lebenden Thiere sollen nach
Angabe des Sammlers hellgelb gewesen sein. Als An s a t zma t e r i a l dient in beiden Fällen ein
ziemlich dicker Tangwurzel-Zweig, an dem sich die Thiere mit dem schmalen Hinterende angesetzt
haben. Die Körper Öffnungen sind normaler Weise wohl flach, nicht erhaben. Bei einem Stück
tritt die Egestionsöffhung jedoch deutlich hervor; sie scheint auf einem flachen Polster zu stehen.
Vielleicht ist das nur eine Folge der ungünstigen Konservirung. Die Ingestionsöffnung steht gerade
auf dem vorderen, etwas schmäleren Ende. Die' Egestionsöffhung steht ungefähr ein Drittel der
Länge des Thieres weiter zurück, an der Rückenseite. Eine Lappenbildung ist äusserlich nicht
erkennbar; bei Betrachtung von der Innenseite erscheinen die Körperöffnungen als kreuzförmige
Schlitze. Die Oberfläche ist dicht besetzt mit stark vorragenden, unregelmässig warzenförmigen
und konischen Papillen, deren Durchmesser durchschnittlich 0,6 mm betragen mag. Bei mikroskopischer
Betrachtung erkennt man, dass die ganze Oberfläche ausserdem dicht mit kleinen Stacheln
von ungefähr 0,06 mm Länge besetzt ist. Häufig bilden diese Staehelchen die Spitzen winziger
konischer oder kuppelförmiger Papillen, die auf oder zwischen den grossen, mit blossem Auge erkennbaren
Papillen desi Cellulosemantels sitzen. In der Umgebung der Körperöffnungen, sowie am
Rande der Ansatzfläche ist der Cellulosemantel etwas verdickt.
Innere Orga.nisa.tion: Die inneren Organe waren nur an dem einen Exemplar einiger-
massen gut erhalten. Das andere Stück war innerlich fast bis zum völligen Zerfall der Organe
erweicht.
Der Ce l l u l o s ema n t e l ist sehr dünn und weich, lappig und leicht zerreissbar, dabei
fast undurchsichtig. An der Innenfläche ist er schwach perlmutterglänzend. Der I n n e n k ö r p e r
liegt dem Cellulosemantel in ganzer Ausdehnung dicht und ziemlich fest an. Die Muskelbündel der
beiden sich rechtwinklig kreuzenden Systeme bilden nahezu geschlossene Schichten. Einzelne
grosse, sackförmige Endocarpen ragen in den Peribranchialraum hinein. Die Egestionsöffhung
ist an der Innenseite von einem Kranz zahlreicher, kleiner, fadenförmiger Kl o a k a l -Te n t a k e l n
umgeben, die auf einem gemeinsamen Ringsaum stehen.
Der Mund-Tentakelkranz besteht aus einfachen Tentakeln, die alternirend grösser und
kleiner sind. Bedeutend ist der Unterschied in der Grösse jedoch nicht. Die Zahl der Tentakeln
liess sich nicht feststellen; sie scheint verhältnissmässig gering zu sein.
Der Dorsal tuberkel ist etwas breiter als lang; die beiden Hörner der Flimmergrube sind
in symmetrischer Weise gegen einander eingerollt und beschreiben zwei regelmässige Spiralen von
ungefähr zwei Windungen. Die Oeffnung zwischen den beiden Spiralen ist nach vorn gerichtet.
Der K i e m e n s a c k war sehr stark lädirt und geschrumpft, dabei ungemein brüchig. Das
einzige, was sich an ihm feststellen liess, war, dass er rechterseits (wie auch wohl linkerseits) vier
stark vorragende Fal ten besass, die ziemlich dicht mit Längsgefässen besetzt waren, und dass
die Maschen in den Zwischenräumen zwischen zwei Falten wenigstens an gewissen Stellen sehr
stark in die Breite gezogen und mit einer verhältnissmässig sehr grossen Zahl länglicher, durch
secundäre Quergefässe überbrückter Kiemenspalten ausgestattet waren. Der Endostyl ist
in seinem Anfangstheil regelmässig geschlängelt.
Die Dorsal falte ist ein breiter, glatter und glattrandiger Saum.
Der Darm liegt an der linken Seite des Kiemensackes. Der Oesophagus ist eng, bogenförmig
gekrümmt. Der Magen ist lang gestreckt bimförmig, in seinem Anfangstheil verdickt.
Der Magen trägt in ganzer Länge eine breite, polsterförmig erhabene Typhlosolis, die sehr zart
und dicht quer geringelt erscheint, und ausser dieser ungefähr 24 Längsfalten, die äusserlich nur
undeutliche Spuren erkennen lassen. Der Mitteldarm ist verhältnissmässig kurz. Sein Anfangstheil
bildet zusammen mit dem Magen eine kurze, weit offene Schleife. Er ist mit einer rinnenförmigen
Typhlosolis ausgestattet. Der Enddarm ist anfangs verengt; seine Mündung erweitert
sich blumenkelchartig. Der Rand der Mündung ist durch 8 ziemlich tiefe Kerbschnitte in 8 Lippen
getheilt, die ihrerseits wieder durch je einen schwächeren Kerbschnitt zweitheilig geworden sind.
Die Gonaden bilden jederseits zwei dünne, unregelmässig geschlängelte, in ganzer Länge
dem Innenkörper angelegte, aber nicht in denselben eingebettete Schläuche, die sich von der Gegend