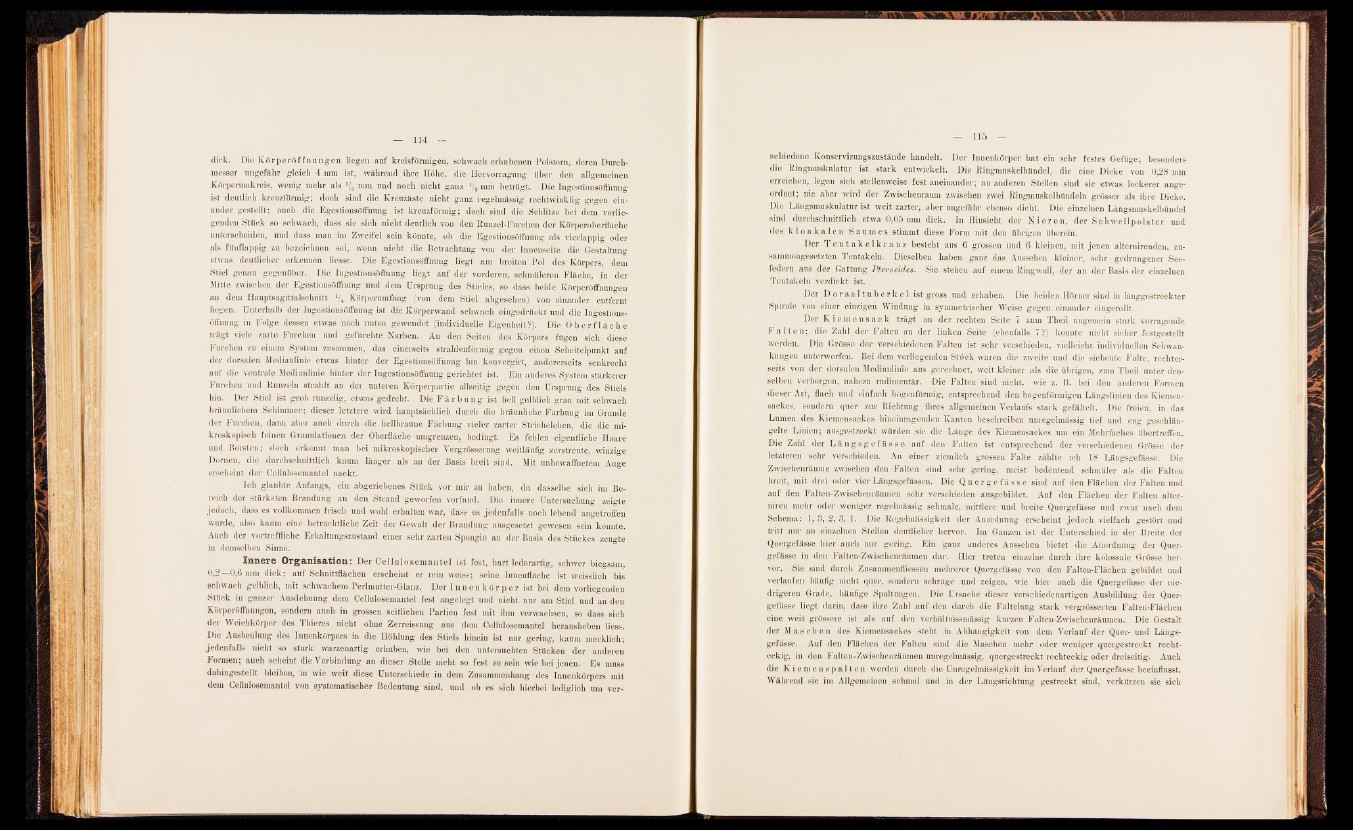
dick. Die Körpevöffnungen liegen auf kreisförmigen, schwach erhabenen Polstern, deren Durct
messer ungefähr gleich 4 mm ist, während ihre Höhe, die Herrorragung über den allgemeinen
Körperumkreis, wenig mehr als Vs mm und noch nicht ganz Vs mm beträgt. Die Ingestionsöffnung
ist deutlich kreuzförmig; doeh sind die Kreuzäste nicht ganz regelmässig'rechtwinklig gegen einander
gestellt;ï&ueh die Egestionsöffnung ist kreuzförmig; doch sind die Schlitze bei dem.’vorliegenden
Stück so schwach, dass sie sich nicht deutlich von den Runzel-Furchen der Körperoberfläehe
unterscheiden, und dass man im Zweifel sein könnte, ob die Egestionsöffnung als vierlappig oder
als fünflappig zu bezeichnen sei, wenn nicht die Betrachtung von der Innenseite die Gestaltung
etwas deutlicher erkennen liesse: Die Egestionsöffnung liegt am breiten Pol des Körpers dem
Stiel genau gegenüber. Die Ingestionsöffnung liegt auf der vorderen, schmäleren Fläche, in der
Mitte zwischen der Egestionsöffnung und dem Ursprung des Stieles, .so dass beide Körperöffnungen
an dem Hauptsagittalschnitt V., Körperumfang (von dem Stiel abgesehen) von einander) entfernt
liegen. Unterhalb der Ingestionsöffnung ist die Körperwand schwach eingedrückt und die Ingestionsöffnung
in Folge dessen etwas nach unten gewendet (individuelle Eigenheit?), Die 0 b e r f l ä eh e
tiägt viele zarte Furchen und gefurchte Narben. An den-Seiten des Körpers fügen Sieh diese
Furchen zu einend System zusammen, das einerseits strahlenförmig gegen einen ächeiteMnkt: auf
der dorsalen Medianlinie etwas hinter der Egestionsöffnung hin lconvergirt, andererseits senkrecht
auf die ventrale Medianlinie hinter der Ingestionsöffnung gerichtet ist. Ein anderes System stärkerer
Furchen und Runzeln strahlt an der unteren Körperpartie allseitig gegen den Ursprung des Stiels
hin. Der Stiel ist grob runzelig, etwas gedreht. Die F ä r b u n g ist hell gelblich grau mit schwach
bräunlichem Schimmer; dieser letztere wird hauptsächlich durch die bräunliche Fäjbung im Grunde
der Furchen, dann aber auch durch die hellbraune Färbung vieler zarter StrieheMren, die die mikroskopisch
feinen Granulationen der Oberfläche umgrenzen, bedingt. Es fehlen eigentliche Haare
und Borsten; doch erkennt man bei mikroskopischer Vergrösserung weitläufig zerstreute, winzige
Domen, die durchschnittlich kaum länger als an der Basis breit sind. Mit unbewaffnetem Auge
erscheint der Cellulosemantel nackt.
Ich glaubte Anfangs, ein abgeriebenes Stück vor mir zu haben, da dasselbe sich im Bereich
der stärksten Brandung an den Strand geworfen vorfand. Die innere Untersuchung zeigte
jedoch, dass es vollkommen frisch und wohl erhalten war, dass es jedenfalls noch' lebend angetroffen
wurde, also kaum eine beträchtliche Zeit der Gewalt der Brandung ausgesetzt gewesen sein konnte.
Auch der vortreffliche Erhaltungszustand einer sehr zarten Spongie an der Basis des Stückes zeugte
in demselben Sinne.
Innere Org^cinisätion: Der Cellulosemantel ist fest, .hart lederartig, schwer biegsam,
0,2 — 0,6 mm dick; auf Schnittflächen erscheint er rein weiss; seine Innenfläche ist weisslich bis
schwach gelblich, mit schwachem Perlmutter-Glanz. Der I n n e n k ö r p e r ist bei dem vorliegenden
Stück in ganzer Ausdehnung dem Cellulosemantel fest angelegt und nicht nur am Stiel und an den
Körperöffnungen, sondern auch in grossen seitlichen Partien fest mit ihm verwachsen, so dass sich
der Weichkörper des Thieres nicht ohne Zerreissung aus dem Cellulosemantel herausheben liess.
Die Ausbeulung des Innenkörpers in die Höhlung des Stiels hinein ist nur gering, kaum merklich;
jedenfalls nicht so stark warzenartig erhaben, wie bei den untersuchten Stücken der anderen
Formen; auch seheint die Verbindung an dieser Stelle nicht so fest zu sein wie bei jenen. Es muss
dahingestellt bleiben, in wie weit diese Unterschiede in dem Zusammenhang des Innenkörpers mit
dem Cellulosemantel von systematischer Bedeutung sind, und ob es sich hierbei lediglich um verschiedene
Konservirungszustände handelt. Der Innenkörper hat ein sehr festes Gefüge; besonders
die Ringmuskulatur ist stark entwickelt. Die Ringmuskelbündel, die eine Dicke von 0,28 mm
erreichen, legen sich stellenweise fest aneinander; an anderen Stellen sind sie etwas lockerer angeordnet;
nie aber wird der Zwischenraum zwischen zwei Ringmuskelbündeln grösser als ihre Dicke.
Die Längsmuskulatur ist weit zarter, aber ungefähr ebenso dicht. Die einzelnen Längsmuskelbündel
sind durchschnittlich etwa 0,05 mm dick. In Hinsicht der Nier e n , der Schwel lpolster und
des k l o a k a l e n Saume s stimmt diese Form mit den übrigen überein.
Der T e n t a k e l k r a n z besteht aus 6 grossen und 6 kleinen, mit jenen alternirenden, zusammengesetzten
Tentakeln. Dieselben haben ganz das Aussehen kleiner, sehr gedrungener Seefedern
aus der Gattung Pteroeides. Sie stehen auf einem Ringwall, der an der Basis der einzelnen
Tentakeln verdickt ist.
Der Do r s a l t u b e r k e l ist gross und erhaben. Die beiden Hörner sind in langgestreckter
Spirale von einer einzigen Windung in symmetrischer Weise gegen einander eingerollt.
Der ICiemensaek trägt an der rechten Seite 7 zum Theil ungemein stark vorragende
F a l t e n ; die Zahl der Falten an der linken Seite (ebenfalls 7?) konnte nicht sicher festgestellt
werden. Die Grösse der verschiedenen Falten ist sehr verschieden, vielleicht individuellen Schwankungen
unterworfen. Bei dem vorliegenden Stück waren die zweite und die siebente Falte, rechter-
seits von der dorsalen Medianlinie aus gerechnet, weit kleiner als die übrigen, zum Theil unter denselben
verborgen, nahezu rudimentär. Die Falten sind nicht, wie z. B. bei den anderen Formen
dieser Art, flach und einfach bogenförmig, entsprechend den bogenförmigen Längslinien des Kiemensackes,
sondern quer zur Richtung ihres allgemeinen Verlaufs stark gefältelt. Die freien, in das
Lumen des Kiemensackes hineinragenden Kanten beschreiben unregelmässig tief und eng geschlängelte
Linien; ausgestreckt würden sie die Länge des Kiemensackes um ein Mehrfaches übertreffen.
Die Zahl der L ä n g s g e f ä s s e auf den Falten ist entsprechend der verschiedenen Grösse der
letzteren sehr verschieden. An einer ziemlich grossen Falte zählte ich 18 Längsgefässe. Die
Zwischenräume zwischen den Falten sind sehr gering, meist bedeutend schmäler als die Falten
breit, mit drei oder vier Längsgefässen. Die Quer g e f ä s s e sind auf den Flächen der Falten und
auf den Falten-Zwischenräumen sehr verschieden ausgebildet. Auf den Flächen der Falten alter-
niren mehr oder weniger regelmässig schmale, mittlere und breite Quergefässe und zwar nach dem
Schema: 1, 3, 2, 3, 1. Die Regelmässigkeit der Anordnung erscheint jedoch vielfach gestört und
tritt nur an einzelnen Stellen deutlicher hervor. Im Ganzen ist der Unterschied in der Breite der
Quergefässe hier auch nur gering. Ein ganz anderes Aussehen bietet die Anordnung der Quergefässe
in den Falten-Zwischenräumen dar. Hier treten einzelne durch ihre kolossale Grösse hervor.
Sie sind durch Zusammenfliessen mehrerer Quergefässe von den Falten-Flächen gebildet und
verlaufen häufig nicht quer, sondern schräge und zeigen, wie hier auch die Quergefässe der niedrigeren
Grade, häufige Spaltungen. Die Ursache dieser verschiedenartigen Ausbildung der Quergefässe
liegt darin, dass ihre Zahl auf den durch die Fältelung stark vergrösserten Falten-Flächen
eine weit grössere ist als auf den verhältnissmässig kurzen Falten-Zwischenräumen. Die Gestalt
der Ma s c h en des Kiemensackes steht in Abhängigkeit von dem Verlauf der Quer- und Längsgefässe.
Auf den Flächen der Falten sind die Maschen mehr oder weniger quergestreckt rechteckig,
in den Falten-Zwischenräumen unregelmässig, quergestreckt rechteckig oder dreiseitig. Auch
die Ki eme n s p a l t e n werden durch die Unregelmässigkeit im Verlauf der Quergefässe beeinflusst.
Während sie im Allgemeinen schmal und in der Längsrichtung gestreckt sind, verkürzen sie sich