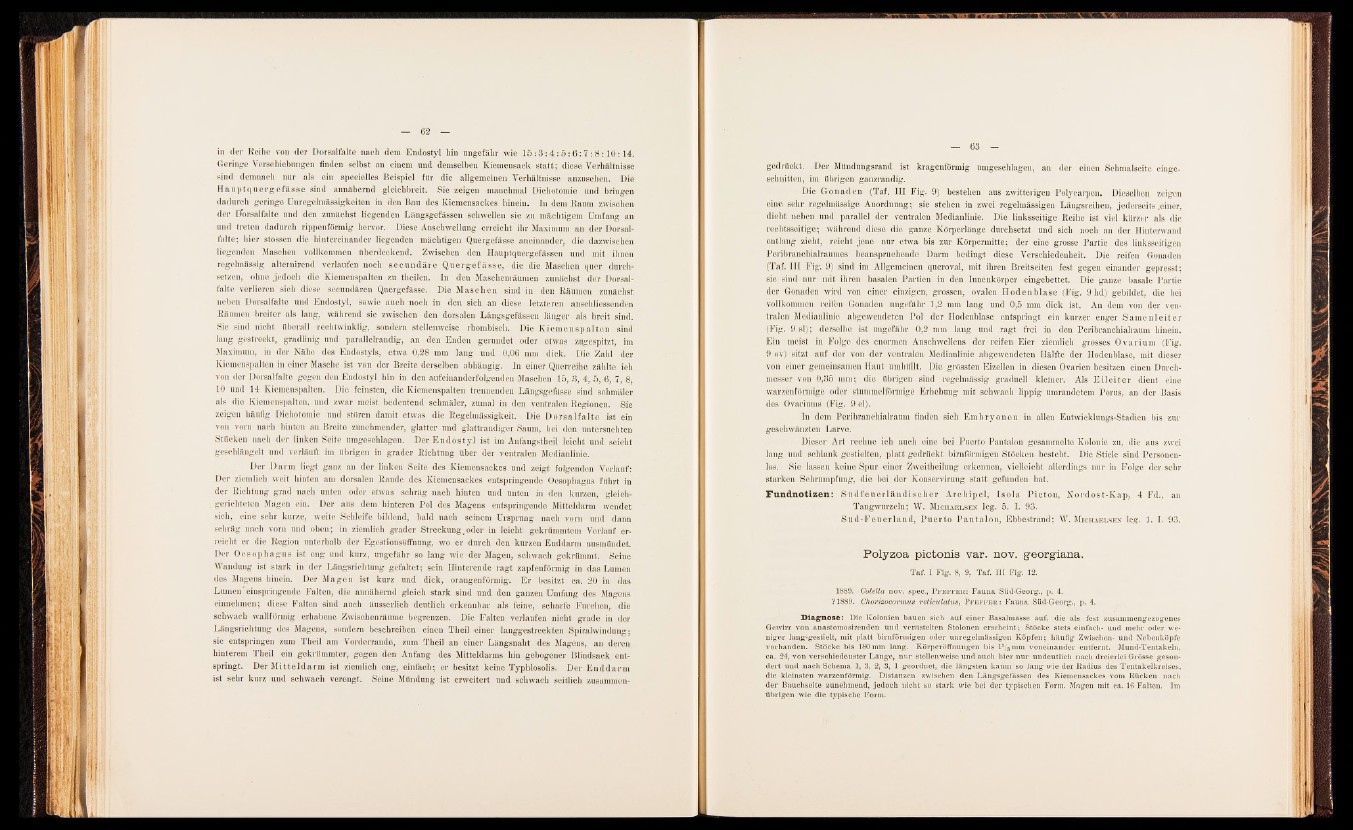
in der Reihe von der Dorsalfalte nach dem Endostyl hin ungefähr wie 15: 3: 4: 5: 6: 7: 8: 10: 14 .
Geringe Verschiebungen finden selbst an einem und demselben Kiemensack statt; diese Verhältnisse
sind demnach nur als ein specielles Beispiel für die allgemeinen Verhältnisse anzusehen. Die
Hauptquer ge fässe sind annähernd gleichbreit. Sie zeigen manchmal Dichotomie und bringen
dadurch geringe Unregelmässigkeiten in den Bau des Kiemensackes hinein. In] dem Raum zwischen
der Dorsalfalte und den zunächst liegenden Längsgefässen schwellen sie zu mächtigem Umfang an
und treten dadurch rippenförmig hervor. Diese Anschwellung erreicht ihr Maximum an der Dorsalfalte;
hier stossen die hintereinander liegenden mächtigen Quergefässe aneinander, die dazwischen
liegenden Maschen vollkommen überdeckend. Zwischen den Hauptquergefässen und mit ihnen
regelmässig alternirend verlaufen noch secundäre Quergefässe, die die Maschen quer durchsetzen,
ohne jedoch die Kiemenspalten zu theilen. In den Maschenräuraen zunächst der Dorsalfalte
verlieren sich diese secundären Quergefässe. Die Maschen sind in den Räumen zunächst
neben Dorsalfalte und Endostyl, sowie auch noch in den sich an diese letzteren anschliessenden
Räumen breiter als lang, während sie zwischen den dorsalen Längsgefässen länger als breit sind.
Sie sind nicht überall rechtwinklig, sondern stellenweise rhombisch. Die Kiemenspalten sind
lang gestreckt, gradlinig und parallelrandig, an den Enden gerundet oder etwas zugespitzt, im
Maximum, in der Nähe des Endostyls, etwa 0,28 mm lang und 0,06 mm dick. Die Zahl der
Kiemenspalten in einer Masche ist von der Breite derselben abhängig. In einer Querreihe zählte ich
von der Dorsalfalte gegen den Endostyl hin in den aufeinanderfolgenden Maschen 15, 3, 4, 5, 6, 7, 8
10 und 14 Kiemenspalten. Die feinsten, die Kiemenspalten trennenden Längsgeiasse sind schmäler
als die Kiemenspalten, und zwar meist bedeutend schmäler, zumal in den ventralen Regionen. Sie
zeigen häufig Dichotomie und stören damit etwas die Regelmässigkeit. Die Dorsalfalte ist ein
von vorn nach hinten an Breite zunehmender, glatter und glattrandiger Saum, bei den untersuchten
Stücken nach der linken Seite umgeschlagen. Der Endostyl ist im Anfangstheil leicht und seicht
geschlängelt und verläuft im übrigen in grader Richtung über der ventralen Medianlinie.
Der Darm liegt ganz an der linken Seite des Kiemensackes und zeigt folgenden Verlauf:
Der ziemlich weit hinten am dorsalen Rande des Kiemensackes entspringende Oesophagus führt in
der Richtung grad nach unten oder etwas schräg nach hinten und unten in den kurzen, gleichgerichteten
Magen ein. Der aus dem hinteren Pol des Magens entspringende Mitteldarm wendet
sich, eine sehr kurze, weite Schleife bildend, bald nach seinem Ursprung nach vorn und dann
schräg nach vorn und oben; in ziemlich grader Streckung#oder in leicht gekrümmtem Verlauf erreicht
er die Region unterhalb der Egestionsöffnung, wo er durch den kurzen Enddarm ausmündet.
Der Oesophagus ist eng und kurz, ungefähr so lang wie der Magen, schwach gekrümmt. Seine
Wandung ist stark in der Längsrichtung gefaltet; sein Hinterende ragt zapfenförmig in das Lumen
des Magens hinein. Der Magen ist kurz und dick, orangenförmig. Er besitzt ca. 20 in das
Lumen'einspringende Falten, die annähernd gleich stark sind und den ganzen Umfang des Magens
einnehmen; diese Falten sind auch äusserlich deutlich erkennbar als feine, scharfe Furchen, die
schwach wallförmig erhabene Zwischenräume begrenzen. Die Falten verlaufen nicht grade in der
Längsrichtung des Magens, sondern beschreiben einen Theil einer langgestreckten Spiralwindung;
sie entspringen zum Theil am Vorderrande, zum Theil an einer Längsnaht des Magens, an deren,
hinterem Theil ein gekrümmter, gegen den Anfang des Mitteldarms hin gebogener Blindsack entspringt.
Der Mitteldarm ist ziemlich eng, einfach; er besitzt keine Typhlosolis. Der Enddarm
ist sehr kurz und schwach verengt. Seine Mündung ist erweitert und schwach seitlich zusammengedrückt.
Der Mündungsrand ist kragenförmig umgeschlagen, an der einen. Schmalseite eingeschnitten,
im übrigen ganzrandig.
Die Gonaden (Taf. III Fig. 9) bestehen aus zwitterigen Polycarpen. Dieselben zeigen
eine sehr regelmässige Anordnung; sie stehen in zwei regelmässigen Längsreihen; jederseits .einer,
dicht neben und parallel der ventralen Medianlinie. Die linksseitige Reihe ist viel kürzer als die
rechtsseitige; während diese die ganze Körperlänge durchsetzt und sich noch an der Hinterwand
entlang zieht, reicht jene nur etwa bis zur Körpermitte; der eine grosse Partie des linksseitigen
Peribranchialraumes beanspruchende Darm bedingt diese Verschiedenheit. Die reifen Gonaden
(Taf. III Fig. 9) sind im Allgemeinen queroval, mit ihren Breitseiten fest gegen einander gepresst;
sie sind nur mit ihren basalen Partien in den Innenkörper eingebettet. Die ganze basale Partie
der Gonaden wird von einer einzigen, grossen, ovalen Hoden blase (Fig. 9 hd) gebildet, die bei
vollkommen reifen Gonaden ungefähr 1,2 mm lang und 0,5 mm dick ist. An dem von der ventralen
Medianlinie abgewendeten Pol der Hodenblase entspringt ein kurzer enger Samenlei ter
(Fig. 9 sl):;: derselbe ist ungefähr 0,2 mm lang und ragt frei in den Peribranchialraum hinein.
Ein meist in Folge des enormen Anschwellens der reifen Eier ziemlich grosses Ovarium (Fig.
9 ov) sitzt auf der von der ventralen Medianlinie abgewendeten Hälfte der Hodenblase, mit dieser
von einer gemeinsamen Haut umhüllt. Die grössten Eizellen in diesen Ovarien besitzen einen Durchmesser
von 0,35 mm; die übrigen sind regelmässig graduell kleiner. Als Eileiter dient eine
warzenförmige oder stummelförmige Erhebung mit schwach lippig umrandetem Porus, an der Basis
des Ovariums (Fig. 9 el).
In dem Peribranchialraum finden sich Embryonen in allen Entwicklungs-Stadien bis zur
geschwänzten Larve.
Dieser Art rechne ich auch eine bei Puerto Pantalon gesammelte Kolonie zu, die aus zwei
lang und schlank gestielten, platt gedrückt bimförmigen Stöcken besteht. Die Stiele sind Personen-
los. Sie lassen keine Spur einer Zweitheilung erkennen, vielleicht allerdings nur in Folge der sehr
starken Schrumpfung, die bei der Konservirung statt gefunden hat.
F u n d n o tiz e n : Südfeuerl ändi scher Archipel, Isola Picton, Nordost-Kap, 4 Fd., an
Tangwurzeln; W. Michaelsen leg. 5. I. 93.
Süd-Feuerland, Puerto Pantalon, Ebbestrand; W. Michaelsen leg. 1. I. 93.
Polyzoa pictonis var. nov. georgiana.
Taf. I F ig . 8, 9, Taf. III F ig . 12.
1889. Colella nov. spec., P f e f f e r : Fau na Süd-Georg., p. 4.
?1889. Chorizocormus reticu la tu s, P f e f f e r : Fauna Süd-Georg., p. 4.
Diagnose: D ie Kolonien bauen sich a u f ein er Basalmasse auf, die als fe st zu sammen gezogene s
Gewirr von anastoraosirenden und verästelten Stolonen e r sch e in t; Stöcke ste ts einfach- und mehr oder wen
ig e r lang^gestielt, mit platt bimförmigen oder unr egelmässigen Köpfen; häufig Zwischen- und Nebenköpfe
vorhanden. S tö ck e bis 180 mm lang. Körperöffnungen bis l s/8mm voneinander entfernt. Mund-Tentakeln,
ca. 24, von v erschiedenster Läng e , mir stellenweise und auch hier nur undeutlich nach dreierlei Grösse g e so n d
ert und nach Schema 1, 3, 2, 3, 1 geordnet, die läng sten kaum so la n g w ie der Radius des Tentakelkreises,
d ie k leinsten warzenförmig. Distanzen zwischen den L äng sg e fä ssen des Kiemensackes vom Rücken nach
der Bauchseite zunehmend, jedo ch nicht so stark wie bei der typischen Form. Magen mit ca. 16 Falten. Im
übr igen w ie die typische Form.