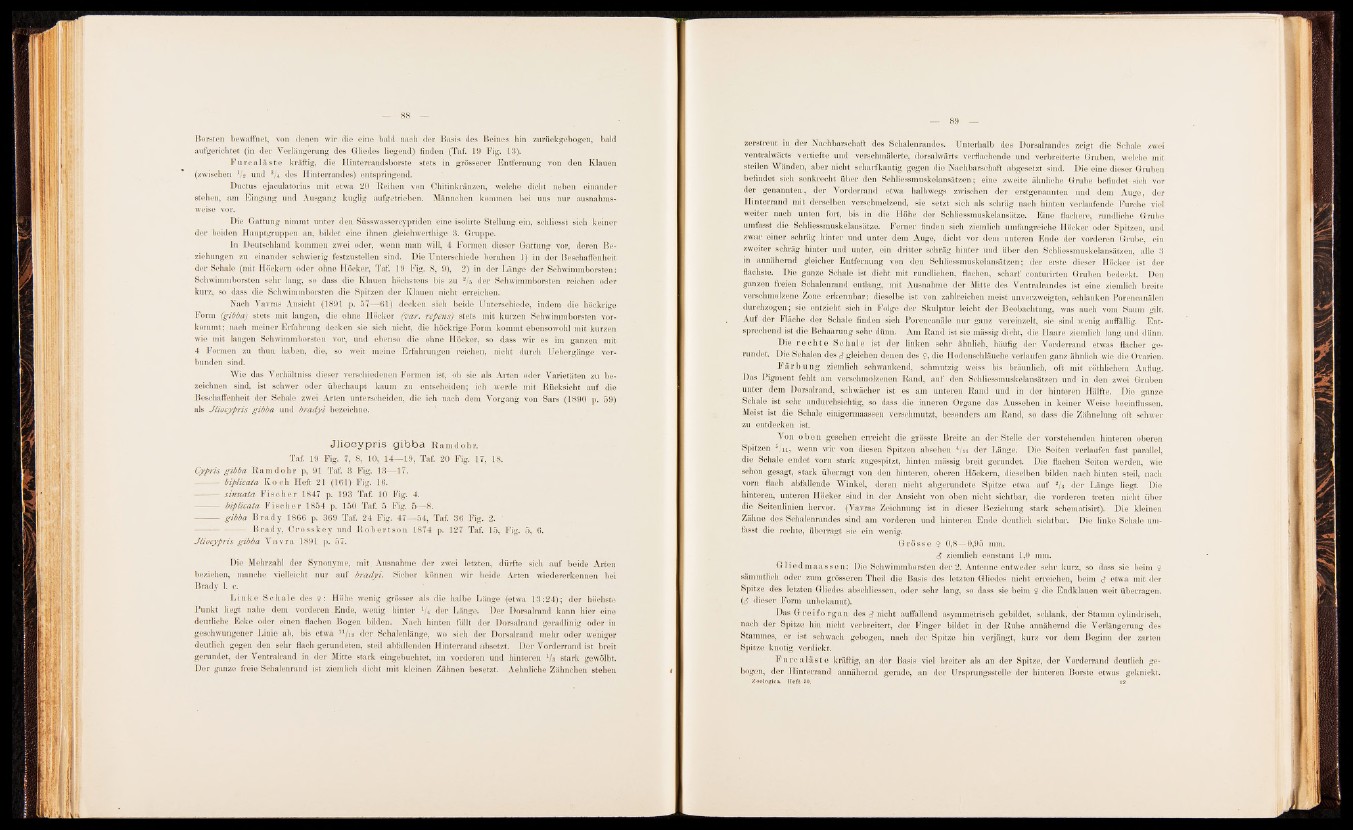
Borsten bewaffnet, von denen wir die eine bald nach dei* Basis des Beines hin zurückgebogen, bald
aufgerichtet (in der Verlängerung des Gliedes liegend) finden (Taf. 19 Fig. 13).
F u rc a lä s te kräftig, die Hinterrandsborste stets in grösserer Entfernung von den Klauen
(zwischen */2 und SU des Hinterrandes) entspringend.
Ductus ejaculatorius mit etwa 20 Reihen von Chitinkränzen, welche dicht neben einander
stehen, am Eingang und Ausgang kuglig aufgetrieben. Männchen kommen bei uns nur ausnahmsweise
vor. Die Gattung nimmt unter den Süsswassercypriden eine isolirte Stellung ein, schliesst sich keiner
der beiden Hauptgruppen an, bildet eine ihnen gleichwertige 3. Gruppe.
In Deutschland kommen zwei oder, wenn man will, 4 Formen dieser Gattung vor, deren Beziehungen
zu einander schwierig festzustellen sind. Die Unterschiede beruhen 1) in der Beschaffenheit
der Schale (mit Höckern oder ohne Höcker, Taf. 19 Fig. 8, 9), 2) in der Länge der Schwimmborsten:
Schwimmborsten sehr lang, so dass die Klauen höchstens bis zu gjg der Schwimmborsten reichen oder
kurz, so dass die Schwimmborsten die Spitzen der Klauen nicht erreichen.
Nach Vavras Ansicht (1891 p. 57—61) decken sich beide Unterschiede, indem die höckrige
Form (gibba) stets mit langen, die ohne Höcker (var. repens) stets mit kurzen Schwimm borsten vorkommt;
nach meiner Erfahrung decken sie sich nicht, die höckrige Form kommt ebensowohl mit kurzen
wie mit langen Schwimmborsten vor, und ebenso die ohne Höcker, so dass wir es im ganzen mit
4 Formen zu thun haben, die, so weit meine Erfahrungen reichen, nicht durch Uebergänge verbunden
sind.
Wie das Verhältniss dieser verschiedenen Formen ist, ob sie als Arten oder Varietäten zu bezeichnen
sind, ist schwer oder überhaupt kaum zu entscheiden; ich werde mit Rücksicht auf die
Beschaffenheit der Schale zwei Arten unterscheiden, die ich nach dem Vorgang von Sars (1890 p. 59)
als Jliocypris gibba und bradyi bezeichne.
J lio c y p ris g ib b a Ramdohr.
Taf. 19 Fig. 7, 8, 10, 14—19, Taf. 20 Fig. 17, 18.
Cypris gibba Ramdohr p. 91 Taf. 3 Fig. 13—17.
— biplicata Koch Heft 21 (161) Fig. 16.
— sinuata F isch e r 1847 p. 193 Taf. 10 Fig. 4.
— biplicata Fisch e r 1854 p. 150 Taf. 5 Fig. .5—8.
— gibba B rady 1866 p. 369 Taf. 24 Fig. 47—54, Taf. 36 Fig. 2. '
— Brady, Crosskey und R o b e rtso n 1874 p. 127 Taf. 15, Fig. 5, 6.
Jliocypris gibba Vavra 1891 p. 57.
Die Mehrzahl der Synonyme, mit. Ausnahme der zwei letzten, dürfte sich auf beide Arten
beziehen, manche vielleicht nur auf bradyi. Sicher können wir beide Arten wiedererkennen bei
Brady 1. c.
Linke Schale des 9 : Höhe wenig grösser als die halbe Länge (etwa 13:24); der höchste
Punkt liegt nahe dem vorderen .Ende, wenig hinter V* der Länge. Der Dorsalrand kann hier eine
deutliche Ecke oder einen flachen Bogen bilden. Nach hinten fallt der Dorsalrand geradlinig oder in
geschwungener Linie ab, bis etwa 11/i2 der Schalenlänge, wo sich der Dorsalrand mehr oder weniger
deutlich gegen den sehr flach gerundeten, steil abfallenden Hinterrand absetzt. Der Vorderrand ist breit
gerundet, der Ventralrand in der Mitte stark eingebuchtet, im vorderen Und hinteren 1/s stark gewölbt.
Der ganze freie Schalenrand ist ziemlich dicht mit kleinen Zähnen besetzt. Aehnliche Zähnchen stehen
zerstreut in der Nachbarschaft des Schalenrandes. Unterhalb des Dorsalrandes zeigt die Schale zwei
ventralwärts vertiefte und verschmälerte, dorsalwärts verflachende und verbreiterte Gruben, welche mit
steilen Wänden, aber nicht scharfkantig gegen die Nachbarschaft abgesetzt sind. Die eine dieser Gruben
befindet sich senkrecht über den Schliessmuskelansätzen; eine zweite ähnliche Grube befindet sich vor
der genannten, der Vorderrand etwa halbwegs zwischen der erstgenannten und dem Auge, der
Hinterrand mit derselben verschmelzend, sie setzt sich als schräg nach hinten verlaufende Furche viel
weiter nach unten fort, bis in die Höhe der Schliessmuskelansätze. Eine flachere, rundliche Grube
umfasst die Schliessmuskelansätze. Ferner finden sich ziemlich umfangreiche Höcker oder Spitzen, und
zwar einer schräg hinter und unter dem Auge, dicht vor dem unteren Ende der vorderen Grube, ein
zweiter schräg hinter und unter, ein dritter schräg hinter und über den Schliessmuskelansätzen, alle 3
in annähernd gleicher Entfernung von den Schliessmuskelansätzen; der erste dieser Höcker ist der
flachste. Die ganze Schale ist dicht mit rundlichen, flachen, scharf conturirten Gruben bedeckt. Den
ganzen freien Schalenrand entlang, mit Ausnahme der Mitte des Ventralrandes ist eine ziemlich breite
verschmolzene Zone erkennbar; dieselbe ist von zahlreichen meist unverzweigten, schlanken Porencanälen
durchzogen; sie entzieht sich in Folge der Skulptur leicht der Beobachtung, was auch vom Saum gilt.
Auf der Fläche der Schale finden sich Porencanäle nur ganz vereinzelt, sie sind wenig auffällig. Entsprechend
ist die Behaarung sehr dünn. Am Rand ist sie mässig dicht, die Haare ziemlich lang und dünn.
Die re c h te Schale ist der linken sehr ähnlich, häufig der Vorderrand etwas flacher gerundet.
Die Schalen des 3 gleichen denen des $, die Hodenschläuche verlaufen ganz ähnlich wie die Ovarien.
F ä rb u n g ziemlich schwankend, schmutzig weiss bis bräunlich, oft mit röthlichem Anflug.
Das Pigment fehlt am verschmolzenen Rand, auf den Schliessmuskelansätzen und in den zwei Gruben
unter dem Dorsalrand, schwächer ist es am unteren Rand und in der hinteren Hälfte. Die ganze
Schale ist sehr undurchsichtig, so dass die inneren Organe das Aussehen in keiner Weise beeinflussen.
Meist ist die Schale einigermaassen verschmutzt, besonders am Rand, so dass die Zähnelung oft schwer
zu entdecken ist.
Von oben gesehen erreicht die grösste Breite an der Stelle der vorstehenden hinteren oberen
Spitzen 5/n, wenn wir von diesen Spitzen absehen 4/u der Länge. Die Seiten verlaufen fast parallel,
die Schale endet vorn stark zugespitzt, hinten mässig breit gerundet. Die flachen Seiten werden, wie
schon gesagt, stark überragt von den hinteren, oberen Höckern, dieselben bilden nach hinten steil, nach
vorn flach abfallende Winkel, deren nicht abgerundete Spitze etwa auf 2/s der Länge liegt. Die
hinteren, unteren Höcker sind in der Ansicht von oben nicht sichtbar, die vorderen treten nicht über
die Seitenlinien hervor. (Vavras Zeichnung ist in dieser Beziehung stark schematisirt). Die kleinen
Zähne des Schalenrandes sind am vorderen und hinteren Ende deutlich sichtbar. Die linke Schale umfasst
die rechte, überragt sie ein wenig.G
rösse 9 0,8—0,95 mm.
3 ziemlich constant 1,0 mm.
Gliedmaassen: Die Schwimmborsten der 2. Antenne entweder sehr kurz, so dass sie beim $
sämmtlich oder zum grösseren Theil die Basis des letzten Gliedes nicht erreichen, beim 3 etwa mit der
Spitze des letzten Gliedes abschliessen, oder sehr lang, so dass sie beim 9 die Endklauen weit überragen,
(d dieser Form unbekannt).
Das G re ifo rg an des 3 nicht auffallend asymmetrisch gebildet, schlank, der Stamm cylindrisch,
nach der Spitze hin nicht verbreitert, der Finger bildet in der Ruhe annähernd die Verlängerung des
Stammes, er ist schwach gebogen, nach der Spitze hin verjüngt, kurz vor dem Beginn der zarten
Spitze knotig verdickt.
F u rc a lä s te kräftig, an der Basis viel breiter als an der Spitze, der Vorderrand deutlich gebogen,
der Hinterrand annähernd gerade, an der Ursprungsstelle der hinteren Borste etwas geknickt.
Zoologica. H e ft 30. 12