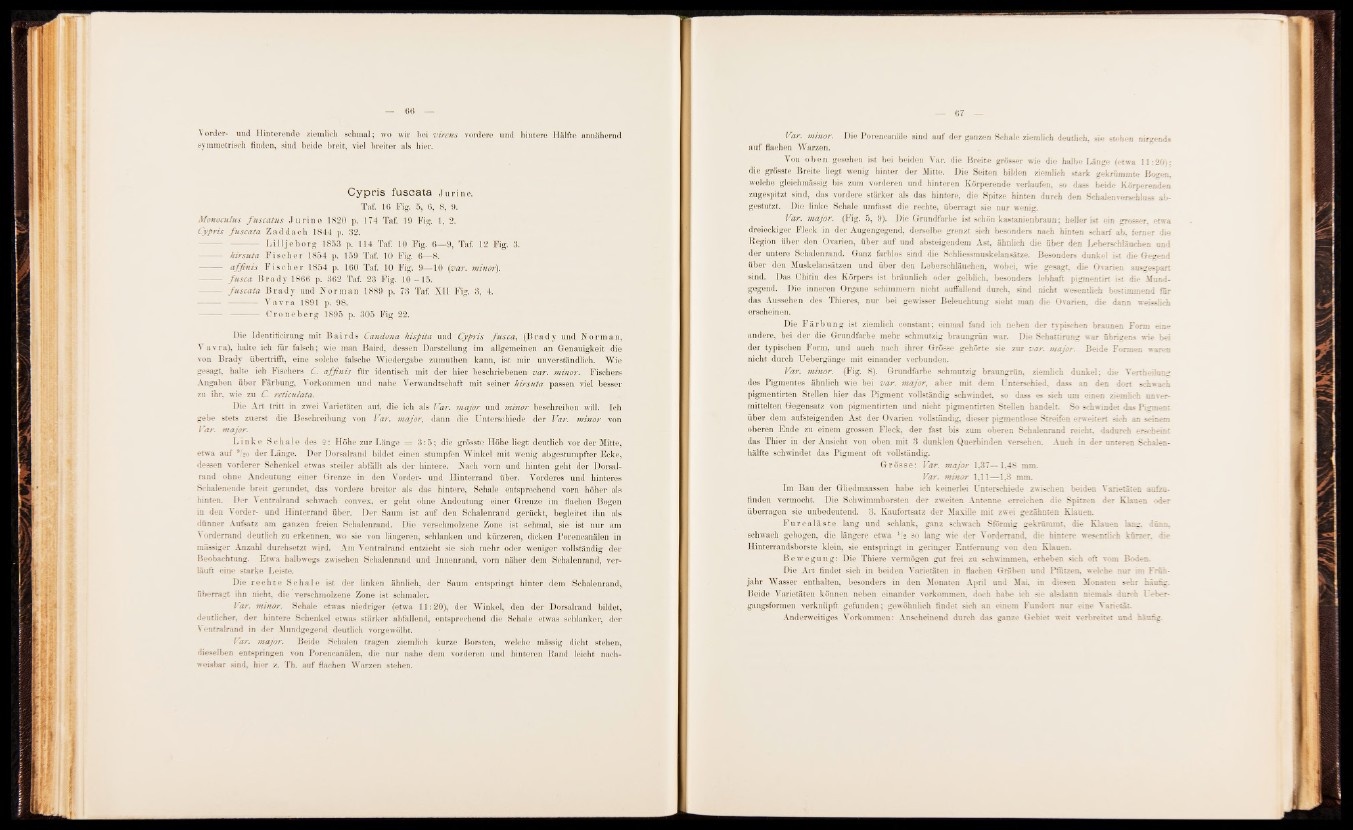
^ order- und Hinterende ziemlich schmal; wo wir hei virens vordere und hintere Hälfte annähernd
symmetrisch finden, sind beide breit, viel breiter als hier.
C y p ris fu s c a ta J u r i ne.
Taf. 16 Fig. 5, 6, 8, 9.
Monomlus fuscatus J u r i ne 1820 p. 174 Taf. 19 Fig. 1, 2.
Cypris fuscata Zaddach 1844 p. 32.
— L illje b o rg 1853 p. 114 Taf. 10 Fig. 6—9, Taf. 12 Fig. 3.
— hirsuta F isch e r 1854 p. 159 Taf. 10 Fig. 6—8.
— affinis F is c h e r 1854 p. 160 Taf. 10 Fig. 9—10 (var. minor).
— fusca B rady 1866 p. 362 Taf. 23 Fig. 10 — 15.
— fuscata Brady und Norman 1889 p. 73 Taf. XII Fig. 3, 4.
— Y a v ra 1891 p. 98.
-- C ro n eb e rg 1895 p. 305 Fig 22.
Die Identificirung mit B a ird s Candona hispita und Cypris fusca, (Brady und Norman,
\ avra), halte ich für falsch; wie man Baird, dessen Darstellung im allgemeinen an Genauigkeit die
von Brady übertrifft, eine solche falsche Wiedergabe zumuthen kann, ist mir unverständlich. Wie
gesagt, halte ich Fischers C. affinis für identisch mit der hier beschriebenen var. minor. Fischers
Angaben über Färbung, Yorkommen und nahe Yerwandtschaft mit seiner hirsuta passen viel besser
zu ihr, wie zu C. reticulata.
Die Art tritt in zwei Yarietäten auf, die ich als Var. major und minor beschreiben will. Ich
gebe stets zuerst die Beschreibung von Var. major, dann die Unterschiede der Var. minor von
Var. major.
L in k e S chale des 2: Höhe zur Länge = 3:5; die grösste Höhe liegt deutlich vor der Mitte,
etwa auf 9/20 der Länge. Der Dorsalrand bildet einen stumpfen Winkel mit wenig abgestumpfter Ecke,
dessen vorderer Schenkel etwas steiler abfällt als der hintere. Nach vorn und hinten geht der Dorsalrand
ohne Andeutung einer Grenze in den Yorder- und Hinterrand über. Vorderes und hinteres
Schalenende breit gerundet, das vordere breiter als das hintere, Schale entsprechend vorn höher als
hinten. Der Ventralrand schwach convex, er geht ohne Andeutung einer Grenze im flachen Bogen
in den Yorder- und Hinterrand über. Der Saum ist auf den Schalenrand gerückt, begleitet ihn als
dünner Aufsatz am ganzen freien Schalenrand. Die verschmolzene Zone ist schmal, sie ist nur am
Yorderrand deutlich zu erkennen, wo sie von längeren, schlanken und kürzeren, dicken Porencanälen in
massiger Anzahl durchsetzt wird. Am Yentralrand entzieht sie sich mehr oder weniger vollständig der
Beobachtung. Etwa halbwegs zwischen Schalenrand und Innenrand, vorn näher dem Schalenrand, verläuft
eine starke Leiste.
Die rechte S ch a le ist der linken ähnlich, der Saum entspringt hinter dem Schalenrand,
überragt ihn nicht, die verschmolzene Zone ist schmaler.
Var. minor. Schale etwas niedriger (etwa 11:20), der Winkel, den der Dorsalrand bildet,
deutlicher, der hintere Schenkel etwas stärker abfallend, entsprechend die Schale etwas schlanker, der
Yentralrand in der Mundgegend deutlich vorgewölbt.
Var. major. Beide Schalen tragen ziemlich kurze Borsten, welche mässig dicht stehen,
dieselben entspringen von Porencanälen, die nur nahe dem vorderen und hinteren Rand leicht nachweisbar
sind, hier z. Th. auf flachen Warzen stehen.
Var. minor. Die Porencanäle sind auf der ganzen Schale ziemlich deutlich, sie stehen nirgends
auf flachen Warzen.
Von oben gesehen ist bei beiden Var. die Breite grösser wie die halbe Lange (etwa 11:20)'
die grösste Breite liegt wenig hinter der Mitte. Die Seiten bilden ziemlich stark gekrümmte Boxern
welche gleichmässig bis zum vorderen und hinteren Körperende verlaufen, so dass beide Körperenden
zugespitzt sind, das vordere stärker als das hintere, die Spitze hinten durch den Schalenverechluss abgestutzt.
Die linke Schale umfasst die rechte, überragt sie nur wenig.
Var. major. (Fig. 5, 9). Die Grundfarbe ist schön kastanienbraun; heller ist ein grösser, etwa
dreieckiger Fleck in der Augengegend, derselbe grenzt sich besonders nach hinten scharf ab, ferner die
Region über den Ovarien, über auf und absteigendem Ast, ähnlich die über den Leberschläuchen und
der untere Schalenrand. Ganz farblos sind die Schliessmuskelansätze. Besonders dunkel ist die Gegend
über den Muskelansätzen und über den Leberschläuchen, wobei, wie «resact, die Ovarien aus^espart
sind. Das Chitin des Körpers ist bräunlich oder gelblich, besonders lebhaft pigmentirt ist die Mundgegend.
Die inneren Organe schimmern nicht auffallend durch, sind nicht wesentlich bestimmend für
das Aussehen des Thieres, nur bei gewisser Beleuchtung sieht man die Ovarien, die dann weiasiieh
erscheinen.
Die F ä rb u n g ist ziemlich constant; einmal fand ich neben der typischen braunen Form eine
andere, bei der die Grundfarbe mehr schmutzig braungrün war. Die Schattirung war übrigens wie bei
der typischen Form, und auch nach ihrer Grösse gehörte sie zur var. major. Beide Formen waren
nicht durch Uebergänge mit einander verbunden.
Var. minor. (Fig. 8). Grundfarbe schmutzig braungrün, ziemlich dunkel: die Yertheilung
des Pigmentes ähnlich wie bei var. major, aber mit dem Unterschied, dass an den dort schwach
pigmentirten Stellen hier das Pigment vollständig schwindet, so dass es sich um einen ziemlich unvermittelten
Gegensatz von pigmentirten und nicht pigmentirten Stellen handelt So schwindet das Pigment
über dem aufsteigenden Ast der Ovarien vollständig, dieser pigmentlose Streifen erweitert sich an seinen
oberen Ende zu einem grossen Fleck, der fast bis zum oberen Schalenrand reicht, dadurch ersc-hemt
das Thier in der Ansicht von oben, mit 3 dunklen Querbinden versehen. Auch in der unteren Sdbalen-
hälfte schwindet das Pigment oft vollständig.
Grösse: Var. major 1,37—1,48 mm.
Var. minor 1,11—1,3 mm.
Im Bau der Gliedmaassen habe ich keinerlei Unterschiede zwischen beiden Varietäten aufzufinden
vermocht. Die Schwimmborsten der zweiten Antenne erreichen die Spitzen der Klanen oder
überragen sie unbedeutend. 3. Kaufortsatz der Maxille mit zwei gezähnten Klauen.
F u rc a lä s te lang und schlank, ganz schwach Sförmig gekrümmt, die Klauen lang. dünn,
schwach gebogen, die längere etwa so lang wie der Yorderrand. die hintere wesentlich kürzer, die
Hinterrandsborste klein, sie entspringt in geringer Entfernung von den Klauen.
Bewegung: Die Thiere vermögen gut frei zu schwimmen, erheben sich oft vom Boden.
Die Art findet sich in beiden Yarietäten in flachen Gräben und Pfützen, welche nur im Frühjahr
Wasser enthalten, besonders in den Monaten April und Mai, in diesen Monaten sehr häufig.
Beide Varietäten können neben einander Vorkommen, doch habe ich sie alsdann niemals durch Ueber-
gangsformen verknüpft gefunden: gewöhnlich findet sich an einem Fundort nur eine Varietät.
Anderweitiges Yorkommen: Anscheinend durch das ganze Gebiet weit verbreitet und häufig.