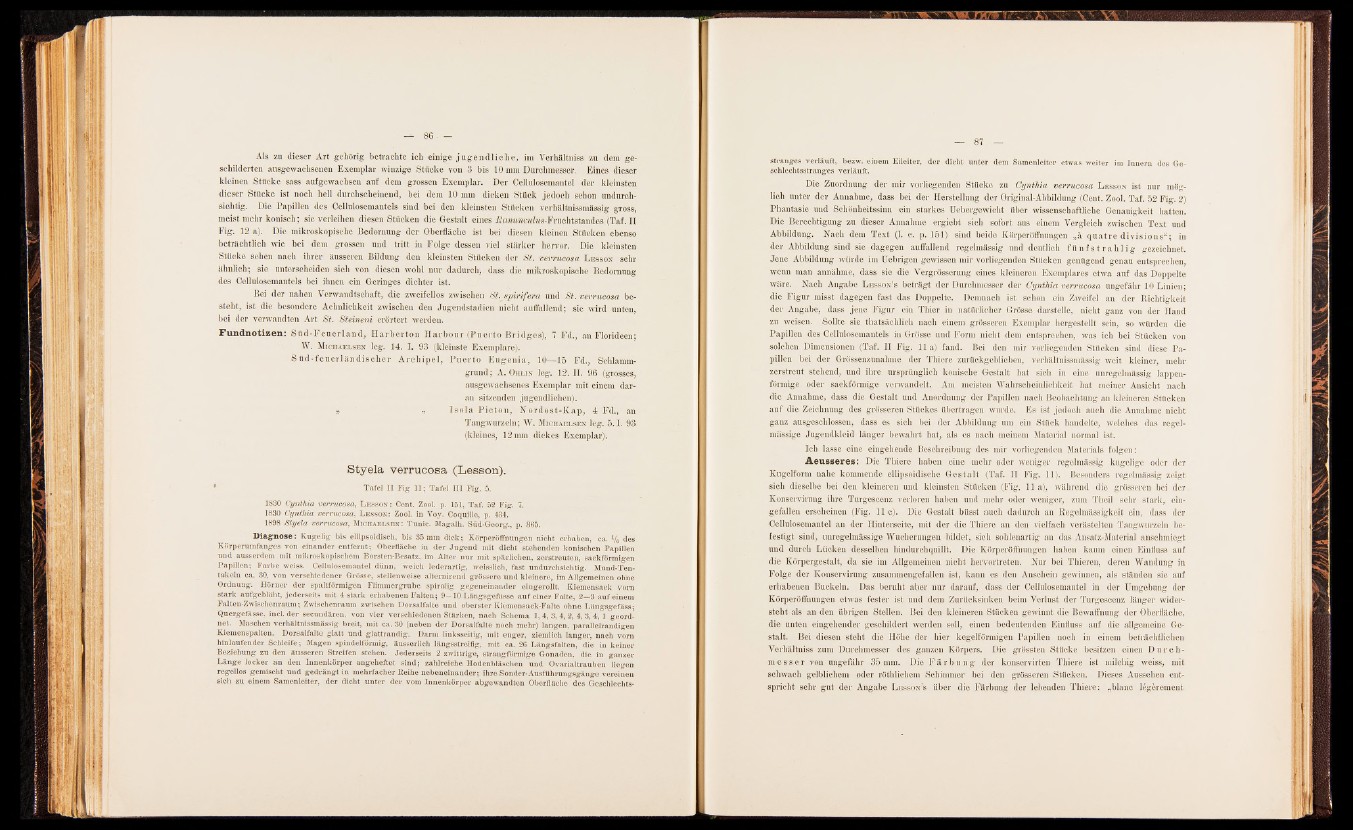
Als zu dieser Art gehörig betrachte ich einige j ugendl iche, im Verhältniss zu dem geschilderten
ausgewachsenen Exemplar winzige Stücke von 3 bis 10 mm Durchmesser. Eines dieser
kleinen Stücke sass aufgewachsen auf dem grossen Exemplar. Der Cellulosemantel der kleinsten
dieser Stücke ist noch hell durchscheinend, bei dem 10 mm dicken Stück jedoch schon undurchsichtig.
Die Papillen des Cellulosemantels sind bei den kleinsten Stücken verhältnissmässig gross,
meist mehr konisch; sie verleihen diesen Stücken die Gestalt eines i?awwwcwZws-Fruchtstandes (Taf. II
Fig. 12 a). Die mikroskopische Bedornung der Oberfläche ist bei diesen kleinen Stücken ebenso
beträchtlich wie bei dem grossen und tritt in Folge dessen viel stärker hervor. Die kleinsten
Stücke sehen nach ihrer äusseren Bildung den kleinsten Stücken der St. verrucosa L esson sehr
ähnlich; sie unterscheiden sieh von diesen wohl nur dadurch, dass die mikroskopische Bedornung
des Cellulosemantels bei ihnen ein Geringes dichter ist.
Bei der nahen Verwandtschaft, die zweifellos zwischen St.jpirifera und St. verrucosa besteht,
ist die besondere Aehnlichkeit zwischen den Jugendstadien nicht auffallend; sie wird unten
bei der verwandten Art St. Steineni erörtert werden.
Fundnotizen: Süd-Feuerland, Harberton Harbour (Puerto Bridges), 7 Fd., an Florideen;
W . Mic h a e l s e n leg. 1 4 . I . 9 3 (kleinste Exemplare).
Süd-feuerländischer Archipel, Puerto Eugenia, 10—15 Fd., Schlammgrund;
A. Oh l in leg. 1 2 .1 1 . 9 6 (grosses,
ausgewachsenes Exemplar mit einem daran
sitzenden jugendlichen).
n » Isola Picton, Nordost-Kap, 4 Fd., an
Tangwurzeln; W . Mic h a e l s e n leg. 5 . 1. 9 3
(kleines, 12 mm dickes Exemplar).
S ty e la v e rru c o s a (Lesson).
T a fel II F ig 11; T a fel III F ig . 5.
1830 C yn th ia v e rru c o sa , Lesson: Cent. Zool. p. 151, Taf. 52 F ig . 7.
1830 C yn th ia ve rru c o sa , Lesson: Zool. in Voy. Coquille, p. 434.
1898 S ty e la v e rru c o sa , Michaelsen: Tunic. Magalh. Süd-Georg., p. 365.
Diagnose: Kugelig1 bis ellipsoidisch, bis 35 mm dick; Körperöffnungen nicht erhaben, ca. */$ d es
K örperumfanges von einander entfernt; Oberfläche in der Ju g en d mit dicht stehenden konisch en Papillen
und ausserdem mit mikroskopischem Borsten-Besatz, im Alte r nur mit spärlichen, zerstreuten, sackförmigen
P apillen; Farb e weiss. Cellulosemantel dünn, weich lederartig, weisslich, fast undurchsichtig. Mund-Tentakeln
ca. 30, v on ver sch iedene r Grösse, ste llenwe ise alternirend g rö sse re u nd kle ine re, im A llgeme inen ohne
Ordnung. Hörner der spaltförmigen FJimraergrube spiralig g eg en e in a n d e r eingerollt. Kiemensack vorn
stark aufgebläht, jede rseits mit 4 stark erhabenen Falten; 9 - 1 0 L ä n g sg e fä sse a u f einer Falte, 2—3 a u f einem
Falten-Zwischenraum; Zwischenraum zwischen Dorsalfalte u nd oberster Kiemensack-Falte ohne Längsge fäss*
Q ue rge fässe, incl. der secundären. von v ie r ver schiedenen Stärken, nach Schema 1, 4, 3, 4, 2, 4, 3, 4, 1 g eo rd net.
Maschen verhältnissmässig breit, mit ca. 30 (neben der Dor salfalte noch mehr) lang en, parallelrandigen
Kiemenspalten. Dor salfalte gla tt u nd glattrandig. Darm linksseitig, mit en g er , ziemlich langer, nach vorn
hinlaufender S ch le ife; Magen spindelförmig, äusserlich längsstreifig, mit ca. 26 L ängsfalten , d ie in keine r
Beziehu ng zu den äusseren S treifen stehen. Jeder seits 2 zwittrige, strangförmige Gonaden, die in gan zer
L ä n g e lock er an den Innenkörper a n g eh eftet sind; zahlreiche Hodenbläschen u nd Ovarialtrauben liegen
reg e llo s gemischt u nd g ed r ä n g t in mehrfacher Reihe nebeneinander; ihre S onder -Ausführungsgänge vereinen
sich zu einem Samenleiter, der dicht unter d er vom Innenkörper abgewandten Oberfläche des Geschlechts-
Stranges verläuft, bezw. einem Eileiter, der dicht u nter dem Samenleiter etwas we iter im Innern des G e schlechtsstranges
verläuft.
Die Zuordnung- der mir vorliegenden Stücke zu Cynthia verrucosa L esson ist nur möglich
unter der Annahme, dass bei der Herstellung der Original-Abbildung (Cent. Zool. Taf. 52 Fig. 2)
Phantasie und Schönheitssinn ein starkes Uebergewicht über wissenschaftliche Genauigkeit hatten.
Die Berechtigung zu dieser Annahme ergiebt sieh sofort aus einem Vergleich zwischen Text und
Abbildung. Nach dem Text (1. c. p. 151) sind beide Körperöffnungen „à quatre divisions“; in
der Abbildung sind sie dagegen auffallend regelmässig und deutlich f ü n f s t r a h l i g gezeichnet.
Jene Abbildung würde im Uebrigen gewissen mir vorliegenden Stücken genügend genau entsprechen,
wenn man annähme, dass sie die Vergrösserung eines kleineren Exemplaires etwa auf das Doppelte
wäre. Nach Angabe L esson’s beträgt der Durchmesser der Cynthia verrucosa ungefähr 10 Linien;
die Figur misst dagegen fast das Doppelte. Demnach ist schon ein Zweifel an der Richtigkeit
der Angabe, dass jene Figur ein Thier in natürlicher Grösse darstelle, nicht ganz von der Hand
zu weisen. Sollte sie thatsächlich nach einem grösseren Exemplar hergestellt sein, so würden die
Papillen des Cellulosemantels in Grösse und Form nicht dem entsprechen, was ich bei Stücken von
solchen Dimensionen (Taf. II Fig. 11a) fand. Bei den mir vorliegenden Stücken sind diese Papillen
bei der Grössenzunahme der Thiere zurückgeblieben, verhältnissmässig weit kleiner, mehr
zerstreut stehend, und ihre ursprünglich konische Gestalt hat sich in eine unregelmässig lappenförmige
oder sackförmige verwandelt. Am meisten Wahrscheinlichkeit hat meiner Ansicht nach
die Annahme, dass die Gestalt und Anordnung der Papillen nach Beobachtung an kleineren Stücken
auf die Zeichnung des grösseren Stückes übertragen wurde. Es ist jedoch auch die Annahme nicht
ganz ausgeschlossen, dass es sich bei der Abbildung um ein Stück handelte, welches das regelmässige
Jugendkleid länger bewahrt hat, als es nach meinem Material normal ist.
Ich lasse eine eingehende Beschreibung des mir vorliegenden Materials folgen:
Aeusseres: Die Thiere haben eine mehr oder weniger regelmässig kugelige oder der
Kugelform nahe kommende ellipsoidische Gestalt (Taf. II Fig. 11). Besonders regelmässig zeigt
sich dieselbe bei den kleineren und kleinsten Stücken (Fig. 11 a), während die grösseren bei der.
Konservirung ihre Turgescenz verloren haben und mehr oder weniger, zum Theil sehr stark, eingefallen
erscheinen (Fig. 11 c). Die Gestalt biisst auch dadurch an Regelmässigkeit ein, dass der
Cellulosemantel an der Hinterseite, mit der die Thiere an den vielfach verästelten Tangwurzeln befestigt
sind, unregelmässige Wucherungen bildet, sieh sohlenartig an das Ansatz-Material anschmiegt
und durch Lücken desselben hindurchquillt. Die Körperöffnungen haben kaum einen Einfluss auf
die Körpergestalt, da sie im Allgemeinen nicht hervortreten. Nur bei Thieren, deren Wandung in
Folge der Konservirung zusammengefallen ist, kann es den Anschein gewinnen, als ständen sie auf
erhabenen Buckeln. Das beruht aber nur darauf, dass der Cellulosemantel in der Umgebung der
Körperöffnungen etwas fester ist und dem Zurücksinken beim Verlust der Turgescenz länger widersteht
als an den übrigen Stellen. Bei den kleineren Stücken gewinnt die Bewaffnung der Oberfläche,
die unten eingehender geschildert werden soll, einen bedeutenden Einfluss auf die allgemeine Gestalt.
Bei diesen steht die Höhe der hier kegelförmigen Papillen noch in einem beträchtlichen
Verhältniss zum Durchmesser des ganzen Körpers. Die grössten Stücke besitzen einen Du r c h me
s s e r von ungefähr 35 mm. Die F ä r b u n g der konservirten Thiere ist milchig weiss, mit
schwach gelblichem oder röthlichem Schimmer bei den grösseren Stücken. Dieses Aussehen entspricht
sehr gut der Angabe L esson’s über die Färbung der lebenden Thiere: „blanc légèrement