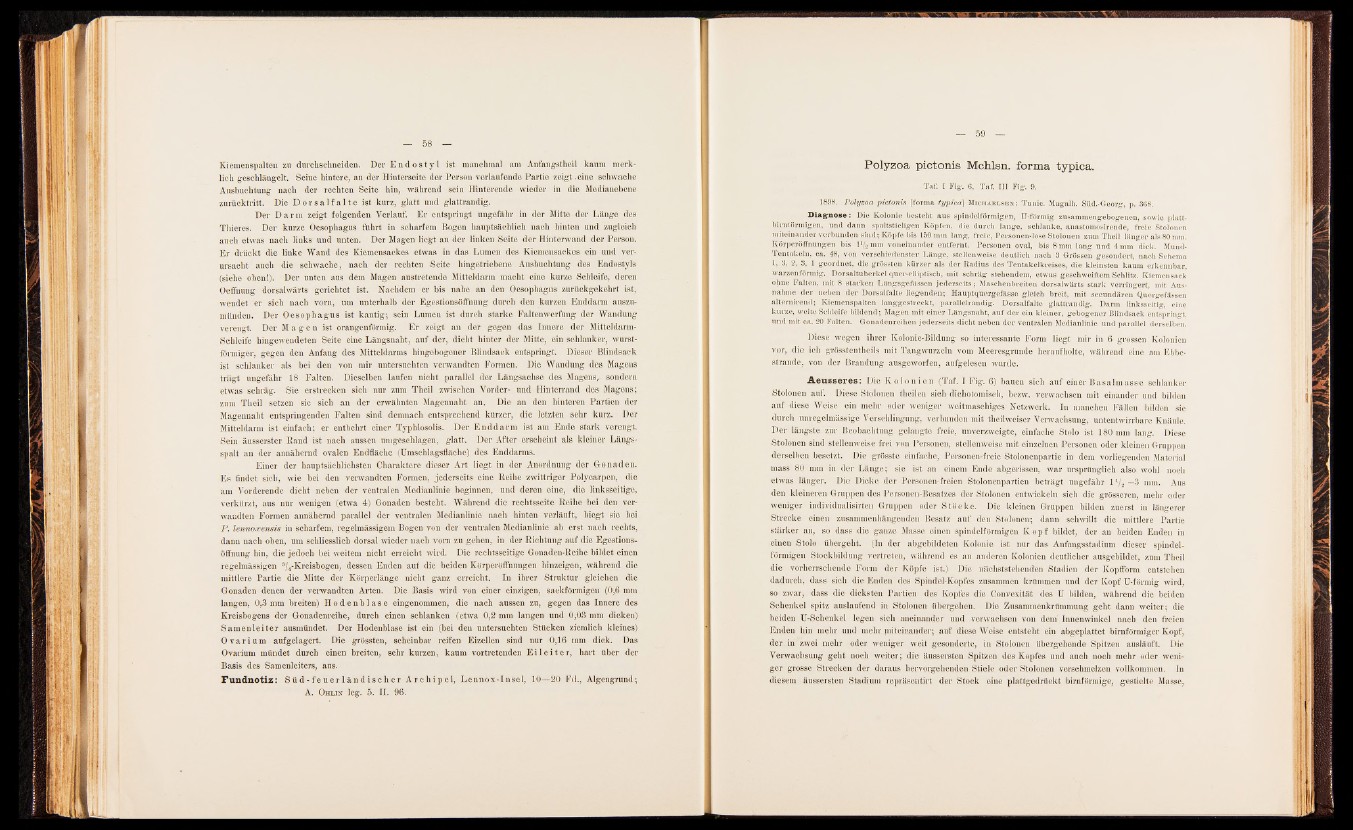
Kiemenspalten zu durchschneiden. Der Endost y ' l ist manchmal am Anfangstheil kaum merklich
geschlängelt. Seine hintere, an der Hinterseite der Person verlaufende Partie zeigt.eine schwache
Ausbuchtung nach der rechten Seite hin, während sein Hinterende wieder in die Medianebene
zurücktritt. Die D o r s a l f a l t e ist kurz, glatt und glattrandig.
Der Darm zeigt folgenden Verlauf. Er entspringt ungefähr in der Mitte der Länge des
Thieres. Der kurze Oesophagus führt in scharfem Bogen hauptsächlich nach hinten und zugleich
auch etwas nach links und unten. Der Magen lieget an der linken Seite der Hinterwand der Person.
Er drückt die linke Wand des Kiemensaekes etwas in das Lumen des Kiemensackes ein und verursacht
auch die schwache, nach der rechten Seite hingetriebene Ausbuchtung des Endostyls
(siehe oben!). Der unten aus dem Magen austretende Mitteldarm macht eine kurze Schleife, deren
Oeffnung dorsalwärts gerichtet ist. Nachdem er bis nahe an den Oesophagus zurückgekehrt ist,
wendet er sich nach vorn, um unterhalb der Egestionsöffnung durch den kurzen Enddarm auszu-
miinden. Der Oesophagus ist kantig; sein Lumen ist durch starke Faltenwerfung der Wandung
verengt. Der Ma g e n ist orangenförmig. Er zeigt an der gegen das Innere der Mitteldarm-
Schleife hingewendeten Seite eine Längsnaht, auf der, dicht hinter der Mitte, ein schlanker, wurstförmiger,
gegen den Anfang des Mitteldarms hingebogener Blindsack entspringt. Dieser Blindsack
ist schlanker als bei den von mir untersuchten verwandten Formen. Die Wandung des Magens
trägt ungefähr 18 Falten. Dieselben laufen nicht parallel der Längsachse des Magens, sondern
etwas schräg. Sie erstrecken sich nur zum Theil zwischen Vorder- und Hinterrand des Magens;
zum Theil setzen sie sich an der erwähnten Mägennaht an. Die an den hinteren Partien der
Magennaht entspringenden Falten sind demnach entsprechend kürzer, die letzten sehr kurz. Der
Mitteldarm ist einfach; er entbehrt einer Typhlosolis. Der Enddarm ist am Ende stark verengt.
Sein äusserster Rand ist nach aussen umgeschlagen, glatt. Der After erscheint als kleiner Längsspalt
an der annähernd ovalen Endfläche (Umschlagsfläche) des Enddarms.
Einer der hauptsächlichsten Charaktere dieser Art liegt in der Anordnung der Gonaden.
Es findet sich, wie bei den verwandten Formen, jederseits eine Reihe zwittriger Polycarpen, die
am Vorderende dicht neben der ventralen Medianlinie beginnen, und deren eine, die linksseitige,
verkürzt, aus nur wenigen (etwa 4) Gonaden besteht. Während die rechtsseite Reihe bei den verwandten
Formen annähernd parallel der ventralen Medianlinie nach hinten verläuft, biegt sie bei
P. lennoxensis in scharfem, regelmässigem Bogen von der ventralen Medianlinie ab erst nach rechts,
dann nach oben, um schliesslich dorsal wieder nach vorn zu gehen, in der Richtung auf die Egestionsöffnung
hin, die jedoch bei weitem nicht erreicht wird. Die rechtsseitige Gonaden-Reihe bildet einen
regelmässigen 3/4-Kreisbogen, dessen Enden auf die beiden Körperöffnungen hinzeigen, während die
mittlere Partie die Mitte der Körperlänge nicht ganz erreicht. In ihrer Struktur gleichen die
Gonaden denen der verwandten Arten. Die. Basis wird von einer einzigen, sackförmigen (0,6 mm
langen, 0,3 mm breiten) Ho d e n b l a s e eingenommen, die nach aussen zu, gegen das Innere des
Kreisbogens der Gonadenreihe, durch einen schlanken (etwa 0,2 mm langen und 0,03 mm dicken)
Samenleiter ausmündet. Der Hodenblase ist ein (bei den untersuchten Stücken ziemlich kleines)
Ovarium aufgelagert. Die grössten, scheinbar reifen Eizellen sind nur 0,16 mm dick. Das
Ovarium mündet durch einen breiten, sehr kurzen, kaum vortretenden Ei l e i t e r , hart über der
Basis des Samenleiters, aus.
F u n d n o tiz : S ü d - f e u e r l ä n d i s c h e r A r c h i p e l , Lennox-Insel, 10—20 Fd., Algengrund;
A. Oh l in leg. 5 . II. 9 6 .
Polyzoa pictonis Mchlsn. forma typica.
Taf. I F ig . 6, Taf. III Fig. 9.
1898. P o ly zo a p ic to n is [forma t y p i c a j Micmaelsen : Tunic. Magalh. Süd.-Georg, p. 368.
Diagnose: Die Kolonie besteht aus spindelförmigen, U-förmig zusammengebogenen, sow ie platt-
birnlörmigen, und dann spaltstieligen Köpfen, die durch lang e , schlanke, anastomosirende, freie Stolonen
miteinander verbunden sind; Köpfe bis 150 nun lang , freie, Personen-lose Stolonen zum Theil läng e r als 8 0mm.
Körperöffnungen bis l ^ mm voneinander entfernt. Personen oval, bis 8 mm la n g und 4 mm dick. Mund-
Tentakeln, ca. 48, von v erschiedenster L än g e , ste llenw e ise deutlich nach 3 Grössen gesondert, nach Schema
1, 3, 2, 3, 1 g eordnet, die grössten kürzer als der Radius des Tentakelkreises, die kleinsten kaum erkennbar,
warzenförmig. Dorsaltuberkel quer-elliptisch, mit schräg stehendem, etwas geschweiftem Schlitz. Kiemensack
ohne Falten, mit 8 starken L äng sg e fä ssen je d e r s e its ; Maschenbreiten dorsalwärts stark verringert, mit Ausnahme
der n eben der Dorsalfalte lieg en d en ; Hauptquergefässe gleich breit, mit secundären Quergefässen
alternirend; Kiemenspalten lang g e str e ck t, parallelrandig. Dorsalfalte glattrandig. Darm lin k sse itig , eine
kurze, we ite Schleife bildend; Magen mit einer Längsnaht, a u f der ein kleiner, g eb o g en e r Blindsack e n tsp rin g t,
und mit Ca.‘|t ) Falten. G o n a d e n re ih e n je d e r s e it s dicht neben der ventralen Medianlinie und parallel derselben.
Diese wegen ihrer Kolonie-Bildung so interessante Form liegt mir in 6 grossen Kolonien
vor, die ich grösstentheils mit Tangwurzeln vom Meeresgründe heraufhölte, während eine am Ebbestrande,
von der Brandung ausgeworfen, aufgelesen wurde.
A eu s se re s : Die Kol o n i en (Taf. I Fig. 6) bauen sich auf einer Basalmasse schlanker
Stolonen auf. Diese Stolonen theilen sich dichotomisch, bezw. verwachsen mit einander und bilden
auf diese Weise ein mehr oder weniger weitmaschiges Netzwerk. In manchen Fällen bilden sie
durch unregelmässige Verschlingung, verbunden mit theilweiser Verwachsung, untentwirrbare Knäule.
Der längste zur Beobachtung gelaugte freie, unverzweigte, einfache Stolo ist 180 mm lang. Diese
Stolonen sind stellenweise frei von Personen, stellenweise mit einzelnen Personen oder kleinen Gruppen
derselben besetzt. Die grösste einfache, Personen-freie Stolonenpartie in dem vorliegenden Material
mass 80 mm in der Länge; sie ist an einem Ende abgerissen, war ursprünglich also wohl noch
etwas länger. Die Dicke der Personen-freien Stolohenpartien beträgt ungefähr 11/2 —3 mm. Aus
den kleineren Gruppen des Personen-Besatzes der Stolonen entwickeln sich die grösseren, mehr oder
weniger individualisirten Gruppen oder Stöcke. Die kleinen Gruppen bilden zuerst in längerer
Strecke einen zusammenhängenden Besatz auf den Stolonen; dann schwillt die mittlere Partie
stärker an, so dass die ganze Masse einen spindelförmigen Kopf bildet, der an beiden Enden in
einen Stolo übergeht. (In der abgebildeten Kolonie ist nur das Anfangsstadium dieser spindelförmigen
Stockbildung vertreten, während es an anderen Kolonien deutlicher ausgebildet, zum Theil
die vorherrschende Form der Köpfe ist.) Die nächststehenden Stadien der Kopfform entstehen
dadurch, dass sich die Enden des Spindel-Kopfes zusammen krümmen und der Kopf U-förmig wird,
so zwar, dass die dicksten Partien des Kopfes die Convexität des U bilden, während die beiden
Schenkel spitz auslaufend in Stolonen übergehen. Die Zusammenkrümmung geht dann weiter; die
beiden U-Schenkel legen sich aneinander und verwachsen von dem' Innenwinkel nacb den freien
Enden hin mehr und mehr pliteinander; auf diese Weise entsteht ein abgeplattet bimförmiger Kopf,
der in zwei mehr oder weniger weit gesonderte, in Stolonen übergehende Spitzen ausläuft. Die
Verwachsung geht noch weiter; die äussersten Spitzen des Kopfes und auch noch mehr oder weniger
grosse Strecken der daraus hervorgehenden Stiele oder Stolonen verschmelzen vollkommen. In
diesem äussersten Stadium repräsentirt der Stock eine plattgedrückt bimförmige, gestielte Masse,