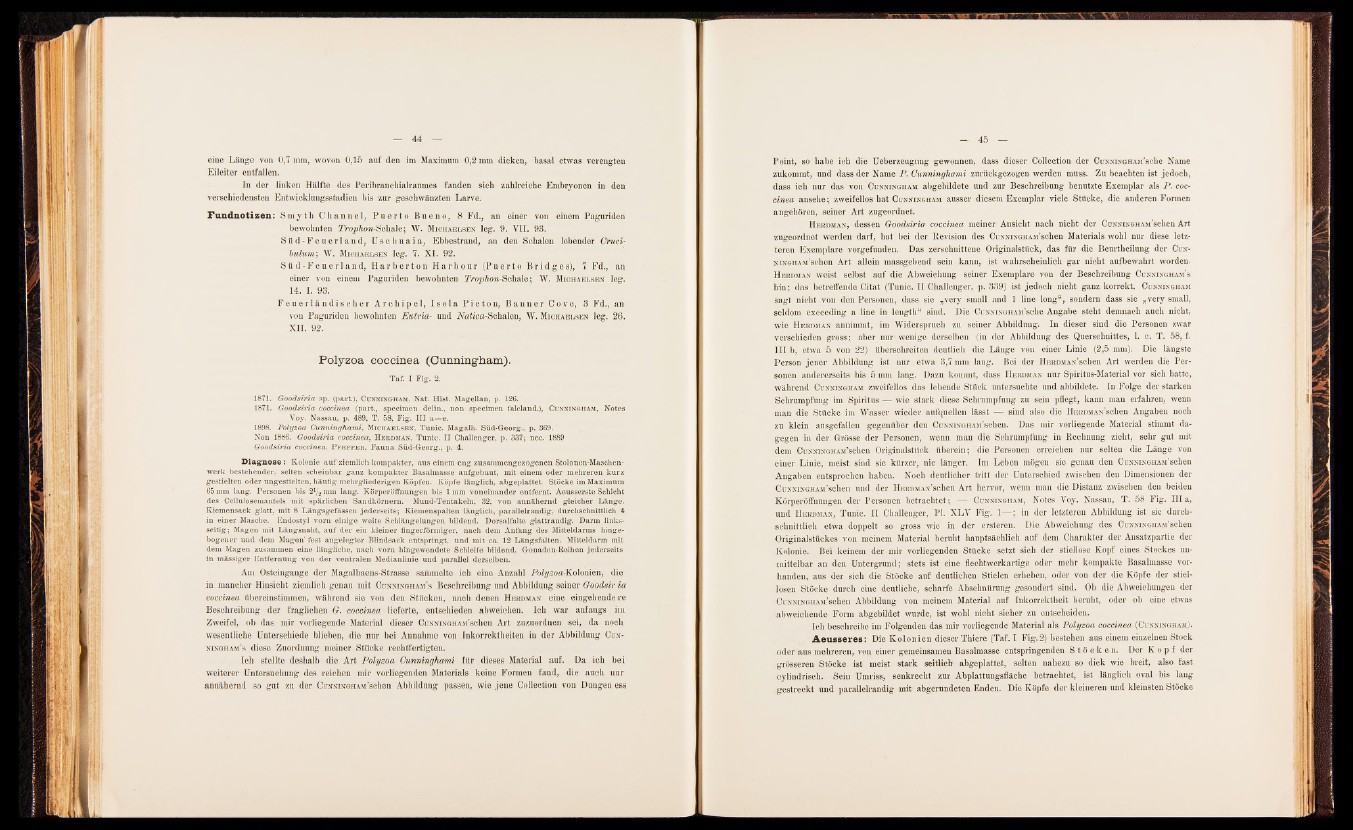
eine Länge von 0,7 mm, wovon 0,15 auf den im Maximum 0,2 mm dicken, basal etwas verengten
Eileiter entfallen.
In der linken Hälfte des Peribranchialraumes fanden sich zahlreiche Embryonen in den
verschiedensten Entwicklungsstadien bis zur geschwänzten Larve.
Fundnotizen: Smyt h Cha nne l , P u e r t o Bueno , 8 Fd., an einer von einem Paguriden
bewohnten TVqpAora-Schale; W. M i c h a e l s e n leg. 9. VII. 93.
Sü d -F e u e r l a n d , Us c h u a i a , Ebbestrand, an den Schalen lebender Gruci-
bulum; W. Mic h a e l s e n leg. 7 . XI. 9 2 .
S ü d - F e u e r l and, Har bei* to n Ha r b o u r (Pue r t o Br i d g e sj, 7 Fd., an
einer von einem Paguriden bewohnten 2>oj?Äow-Schale; W. Mic h a e l s e n leg.
14. I. 93.
F e u e r l ä n d i s c h e r Ar c h ip e l , I s o l a P i c t o n , Ba n n e r Cove, 3 Fd., an
von Paguriden bewohnten Eutria- und iVaíica-Schalen, W. Mic h a e l s e n leg. 26.
XII. 92.
P o ly zo a co ccínea (Cunningham).
Taf. I F ig . 2.
1871. G o o d s ir ia sp. (part.), C u n n in g h a m , Nat. Hist. Magellan, p. 126.
1871. G o o d s ir ia coccínea (part., specimen delin., n on specimen falcland.), C u n n in g h a m , Notes
Voy. Nassau, p. 489, T. 58, F ig . III a—e.
1898. P o ly zo a Gunn ingh am i, M i c h a e l s e n , Tunic. Magalh. Süd-Georg., p. 369.
Non 1 886. G o o d siria coccínea, H er dm a n , Tunic. II Challenger, p . 3 3 7 ; nec. 1889
G o o d siria coccínea. P f e f f e r , F au na Süd:Georg., p. 4.
Diagnose : Kolonie a u f ziemlich kompakter, aus einem e n g zu sammen gezogenen Stolonen-Maschen-
we rk bestehender, selten scheinbar g a n z kompakter Basalmasse aufgebaut, mit einem oder mehreren kurz
g estie lten oder u ng e stie lten , häufig mehrgliede rigen Köpfen. Köpfe länglich, abgeplattet. S tö ck e im Maximum
65 mm lang. Personen b is 2% mm lang. Körperöffnungen bis 1 mm von einan d er entfernt. A eusser ste S chicht
d e s Cellulosemantels mit spärlichen Sandkörnern. Mund-Téntakeln, 32, v on annähernd gle ich e r Läng e .
K iemensack g la tt, mit 8 L äng sg e fä ssen jede rseits; Kiemenspalten länglich, parallelrandig, durchschnittlich 4
in einer Masche. Endostyl vorn e in ig e we ite S ch län g e lu ng en bildend. Dorsalfalte glattrandig. Darm linkss
e itig ; Magen mit Längsnaht, a u f der ein kle ine r fingerförmiger, n a ch dem A n fan g des Mitteldarms h in g eb
o g en e r und dem Magen’ fe st an g e leg te r Blindsack entspringt, und mit ca. 12 L ängsfalten. Mitteldarm mit
dem Magen zusammen e in e längliche, nach vorn h in g ew en de te S ch ie ile bildend. Gonaden-Reihen jede rseits
in mässiger E ntfernung v on der ven tralen Medianlinie u nd parallel derselben.
Am Osteingange der Magalhaens-Strasse sammelte ich eine Anzahl Polyzoa-KoXom&a, die
in mancher Hinsicht ziemlich genau mit Cu n nin g ham ’s Beschreibung und Abbildung seiner Goodsir ia
coccínea übereinstimmen, während sie von den Stücken, nach denen H e rdman eine eingehende re
Beschreibung der fraglichen G. coccínea lieferte, entschieden abweichen. Ich war anfangs im
Zweifel, ob das mir vorliegende Material dieser CüNNiNGHAM’schen Art zuzuordnen sei, da noch
wesentliche Unterschiede blieben, die nur bei Annahme von Inkorrektheiten in der Abbildung C unnin
g h am’s diese Zuordnung meiner Stücke rechtfertigten.
Ich stellte deshalb die Art Polyzoa Gunninghami für dieses Material auf. Da ich bei
weiterer Untersuchung des reichen mir vorliegenden Materials keine Formen fand, die auch nur
annähernd so gut zu der CunninghAM’schen Abbildung passen, wie jene Collection von Dungen ess
Point, so habe ich die Ueberzeugung gewonnen, dass dieser Collection der Cun nin g hAM’sche Name
zukommt, und dass der Name P. Gunninghami zurückgezogen werden muss. Zu beachten ist jedoch,
dass ich nur das von Cu nningham abgebildete und zur Beschreibung benutzte Exemplar als P. coccínea
ansehe; zweifellos hat C unningham ausser diesem Exemplar viele Stücke, die anderen Formen
angehören, seiner Art zugeordnet.
H erdm a n, dessen Goodsiria coccínea meiner Ansicht nach nicht der C u nninghAM’schen Art
zugeordnet werden darf, h at bei der Revision des CuNNiNGHAM’schen Materials wohl nur diese letzteren
Exemplare vorgefunden. Das zerschnittene Originalstück, das für die Beurtheilung der CuNNiNGHAM’schen
Art allein massgebend sein kann, ist wahrscheinlich g a r nicht aufbewahrt worden.
H e rdman weist selbst au f die Abweichung seiner Exemplare von der Beschreibung Cunningham’s
h in ; das betreffende Citat (Tunic. I I Challenger, p. 339) ist jedoch nicht ganz korrekt. C unningham
sag t nicht von den Personen, dass sie „very small and 1 line long“ , sondern dass sie „very small,
seldom exceeding a line in length“ sind. Die CuNNiNGHAM’sche Angabe steht demnach auch nicht,
wie H erdman annimmt, im Widerspruch zu seiner Abbildung. In dieser sind die Personen zwar
verschieden gross; aber nur wenige derselben (in der Abbildung des Querschnittes, 1. c. T . 58, f.
I I I b, etwa 5 von 22) überschreiten deutlich die Länge von einer Linie (2,5 mm). Die längste
Person jen e r Abbildung ist nur etwa 3,7 mm lang. Bei der HERDMAN’schen Art werden die Personen
andererseits bis 5 mm lang. Dazu kommt, dass H erdman nur Spiritus-Material vor sich hatte,
während C unningham zweifellos das lebende Stück untersuchte und abbildete. In Folge der starken
Schrumpfung im S p iritu sH - wie stark diese Schrumpfung zu sein pflegt, kann man erfahren, wenn
man die Stücke im Wasser wieder aufquellen lässt — sind also die HERDMAN’schen Angaben noch
zu klein ausgefallen gegenüber den CuNNiNGHAM’schen. Das mir vorliegende Material stimmt dagegen
in der Grösse der Personen, wenn man die Schrumpfung in Rechnung zieht, sehr gut mit
dem CuNNiNGHAM’schen Originalstück überein; die Personen erreichen nur selten die Länge von
einer Linie, meist sind sie kürzer, nie länger. Im Leben mögen sie genau den CuNNiNGHAM’schen
Angaben entsprochen haben. Noch deutlicher tritt der Unterschied zwischen den Dimensionen der
CuNNiNGHAM’schen und der HERDMAN’schen Art hervor, wenn man die Distanz zwischen den beiden
Körperöffnungen der Personen betrachte t; — C unningham , Notes Voy. Nassau, T. 58 Fig. I I I a ,
und H erdman, Tunic. II Challenger, PI. XLV Fig. 1— ; in der letzteren Abbildung ist sie durchschnittlich
etwa doppelt so gross wie in der ersteren. Die Abweichung des CuNNiNGHAM’schen
Originalstückes von meinem Material beruht hauptsächlich auf dem Charakter der Ansatzpartie der
Kolonie. Bei keinem der mir vorliegenden Stücke setzt sich der stiellose Kopf eines Stockes unmittelbar
an den Untergrund; stets ist eine flechtwerkartige oder mehr kompakte Basalmasse vorhanden,
aus der sich die Stöcke auf deutlichen Stielen erheben, oder von der die Köpfe der stiellosen
Stöcke durch eine deutliche, scharfe Abschnürung gesondert sind. Ob die Abweichungen der
CuNNiNGHAM’schen Abbildung von meinem Material auf Ihkorrektheit beruht, oder ob eine etwas
abweichende Form abgebildet wurde, ist wohl nicht sicher zu entscheiden.
Ich beschreibe im Folgenden das mir vorliegende Material als Polyzoa coccínea (Cunningham).
Aeusseres: Die Kolonien dieser Thiere (Taf. I Fig. 2) bestehen aus einem einzelnen Stock
oder aus mehreren, von einer gemeinsamen Basalmasse entspringenden S t ö c k e n . Der Ko p f der
grösseren Stöcke ist meist stark seitlich abgeplattet, selten nahezu so dick wie breit, also fast
cylindrisch. SeiD Umriss, senkrecht zur Abplattungsfläche betrachtet, ist länglich oval bis lang
gestreckt und parallelrandig mit abgerundeten Enden. Die Köpfe der kleineren und kleinsten Stöcke