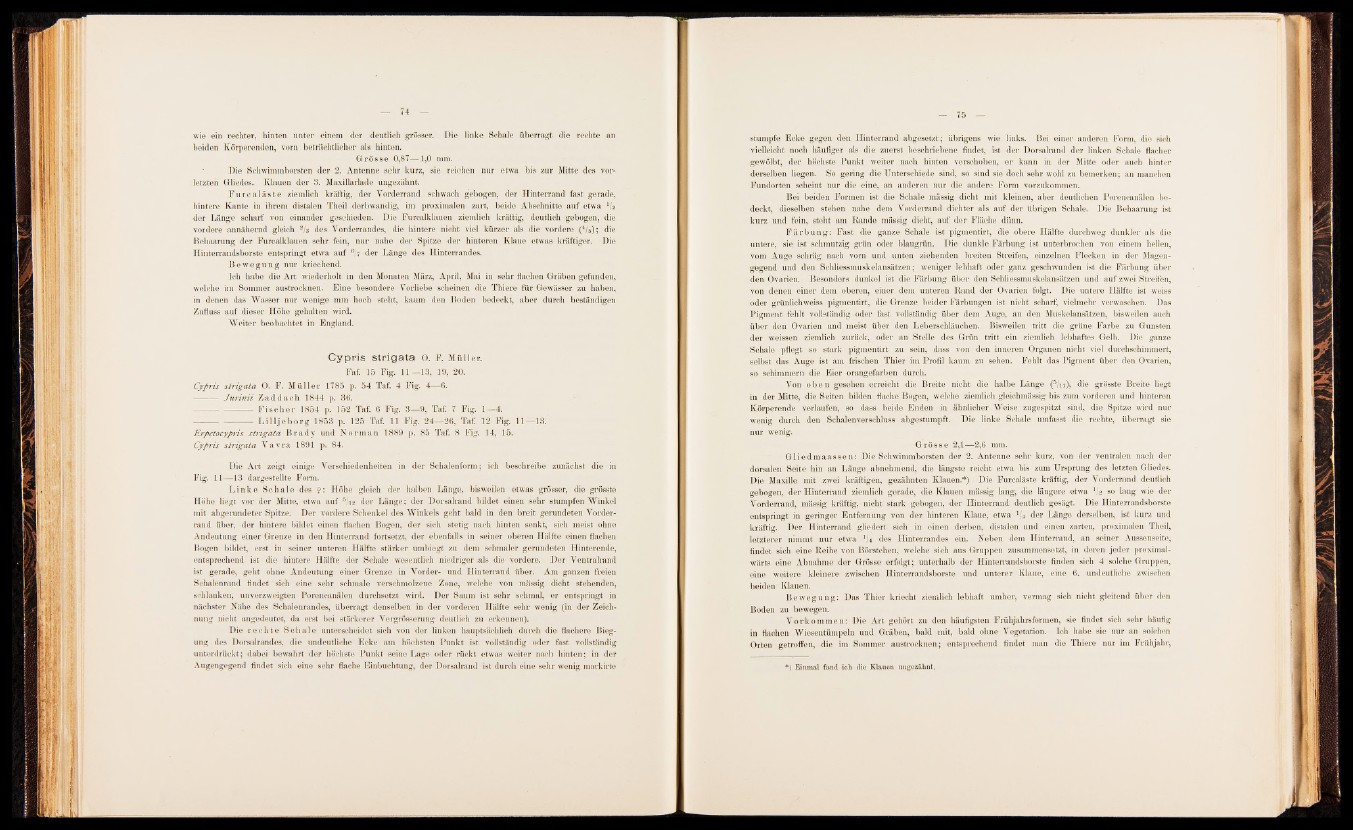
wie ein rechter, hinten unter einem der deutlich grösser. Die linke Schale überragt die rechte an
beiden Körperenden, vorn beträchtlicher als hinten.
Grösse 0,87—1,0 mm.
Die Schwimmborsten der 2. Antenne sehr kurz, sie reichen nur etwa bis zur Mitte des vorletzten
Gliedes. Klauen der 3. Maxillarlade ungezähnt.
F u rc a lä s te ziemlich kräftig, der Yorderrand schwach gebogen, der Hinterrand fast gerade,
hintere Kante in ihrem distalen Theil derbwandig, im proximalen zart, beide Abschnitte auf etwa f/s
der Länge scharf von einander geschieden. Die Furcalklauen ziemlich kräftig, deutlich gebogen, die
vordere annähernd gleich 2/s des Yorderrandes, die hintere nicht viel kürzer als die vordere (4/5); die
Behaarung der Furcalklauen sehr fein, nur nahe der Spitze der hinteren Klaue etwas kräftiger. Die
Hinterrandsborste entspringt etwa auf Gh der Länge des Hinterrandes.
Bewegung nur kriechend.
Ich habe die Art wiederholt in den Monaten März, April, Mai in sehr flachen Gräben gefunden,
welche im Sommer austrocknen. Eine besondere Vorliebe scheinen die Thiere für Gewässer zu haben,
in denen das Wasser nur wenige mm hoch steht, kaum den Boden bedeckt, aber durch beständigen
Zufluss auf dieser Höhe gehalten wird.
Weiter beobachtet in England.
Cypris str-igata 0. F. Müller.
Faf. 15 Fig. liw l3 , 19, 20.
Cypris strigata 0. F. Müller 1785 p. 54 Taf. 4 Fig. 4—6.
Jurinii Z ad dach 1844 p. 36.
F isch e r 1854 p. 152 Taf. 6 Fig. 3—r9, Taf. 7 Fig. 1—4.
L illje b o rg 1853 p. 125 Taf. 11 Fig. 24—26, Taf. 12 Fig. 11—13.
Erpetocypris strigata Brady und Norman 1889 p. 85 Taf. 8 Fig. 14, 15.
Cypris strigata Vavra 1891 p. 84.
Die Art zeigt einige Yerschiedenheiten in der Schalenform; ich beschreibe zunächst die in
Fig. 11—13 dargestellte Form.
L in k e Schale des ?: Höhe gleich der halben Länge, bisweilen etwas grösser, die grösste
Höhe liegt vor der Mitte, etwa auf 5/12 der Länge; der Dorsalrand bildet einen sehr stumpfen Winkel
mit abgerundeter Spitze. Der vordere Schenkel des Winkels geht bald in den breit gerundeten Yorderrand
über, der hintere bildet einen flachen Bogen, der sich stetig nach hinten senkt, sich meist ohne
Andeutung einer Grenze in den Hinterrand fortsetzt, der ebenfalls in seiner oberen Hälfte einen flachen
Bogen bildet, erst in seiner unteren Hälfte stärker umbiegt zu dem schmaler gerundeten Hinterende,
entsprechend ist die hintere Hälfte der Schale wesentlich niedriger .als die vordere. Der Yentralrand
ist gerade, geht ohne Andeutung einer Grenze in Yorder- und Hinterrand über. Am ganzen freien
Schalenrand findet sich eine sehr schmale verschmolzene Zone, welche von mässig dicht stehenden,
schlanken, unverzweigten Porencanälen durchsetzt wird. Der Saum ist sehr schmal, er entspringt in
nächster Nähe des Schalenrandes, überragt denselben in der vorderen Hälfte sehr wenig (in der Zeichnung
nicht angedeutet, da erst bei stärkerer Yergrösserung deutlich zu erkennen).
Die re c h te Schale unterscheidet sich von der linken hauptsächlich durch die flachere Biegung
des Dorsalrandes, die undeutliche Ecke am höchsten Punkt ist vollständig oder fast vollständig
unterdrückt; dabei bewahrt der höchste Punkt seine Lage oder rückt etwas weiter nach hinten; in der
Augengegend findet sich eine sehr flache Einbuchtung, der Dorsalrand ist durch eine sehr wenig markirte
stumpfe Ecke gegen den Hinterrand abgesetzt; übrigens wie links. Bei einer anderen Form, die sich
vielleicht noch häufiger als die zuerst beschriebene findet, ist der Dorsalrand der linken Schale flacher
gewölbt* der höchste Punkt weiter nach hinten verschoben, er kann in der Mitte oder auch hinter
derselben liegen. So gering die Unterschiede sind, so sind sie doch sehr wohl zu bemerken; an manchen
Fundorten scheint nur die eine, an anderen nur die andere Form vorzukommen.
Bei beiden Formen ist die Schale mässig dicht mit kleinen, aber deutlichen Porencanälen bedeckt,
dieselben stehen nahe dem Yorderrand dichter als auf der übrigen Schale. Die Behaarung ist
kurz und fein, steht am Rande mässig dicht, auf der Fläche dünn.
F ä rb u n g : Fast die ganze Schale ist pigmentirt, die obere Hälfte durchweg dunkler als die
untere, sie ist schmutzig grün oder blaugrün. Die dunkle Färbung ist unterbrochen von einem hellen,
vom Auge schräg nach vorn und unten ziehenden breiten Streifen, einzelnen Flecken in der Magengegend
und den Schliessmuskelansätzen; weniger lebhaft oder ganz geschwunden ist die Färbung über
den Ovarien. Besonders dunkel ist die Färbung über den Schliessmuskelansätzen und auf zwei Streifen,
von denen einer dem oberen, einer dem unteren Rand der Ovarien folgt. Die untere Hälfte ist weiss
oder grünlichweiss pigmentirt, die Grenze beider Färbungen ist nicht scharf, vielmehr verwaschen. Das
Pigment fehlt vollständig oder fast vollständig über dem Auge, an den Muskelansätzen, bisweilen auch
über den Ovarien und meist über den Leberschläuchen. Bisweilen tritt die grüne Farbe zu Gunsten
der weissen ziemlich zurück, oder an Stelle des Grün tritt ein ziemlich lebhaftes Gelb. Die ganze
Schale pflegt so stark pigmentirt zu sein, dass von den inneren Organen nicht viel durchschimmert,
selbst das Auge ist am frischen Thier im Profil kaum zu sehen. Fehlt das Pigment über den Ovarien,
so schimmern die Eier orangefarben durch.
Yon oben gesehen erreicht die Breite nicht die halbe Länge (5/n), die grösste Breite liegt
in der Mitte, die Seiten bilden flache Bogen, welche ziemlich gleichmässig bis zum vorderen und hinteren
Körperende verlaufen, so dass beide Enden in ähnlicher Weise zugespitzt sind, die Spitze wird nur
wenig durch den Schalenverschluss abgestumpft. Die linke Schale umfasst die rechte, überragt sie
nur wenig.
Grösse 2,1-—2,6 mm.
Gliedmaassen: Die Schwimmborsten der 2. Antenne sehr kurz, von der ventralen nach der
dorsalen Seite hin an Länge abnehmend, die längste reicht etwa bis zum Ursprung des letzten Gliedes.
Die Maxille mit zwei kräftigen, gezähnten Klauen.*) Die Furcaläste kräftig, der Yorderrand deutlich
gebogen, der Hinterrand ziemlich gerade, die Klauen mässig lang, die längere etwa V2 so lang wie der
Vorderrand, mässig kräftig, nicht stark gebogen, der Hinterrand deutlich gesägt. Die Hinterrandsborste
entspringt in geringer Entfernung von der hinteren Klaue, etwa 1U der Länge derselben, ist kurz und
kräftig. Der Hinterrand gliedert sich in einen derben* distalen und einen zarten, proximalen Theil*
letzterer nimmt nur etwa 1U des Hinterrandes ein. Neben dem Hinterrand, an seiner Aussenseite,
findet sich eine Reihe von Börstchen, welche sich aus Gruppen zusammensetzt, in deren jeder proximalwärts
eine Abnahme der Grösse erfolgt; unterhalb der Hinterrandsborste finden sich 4 solche Gruppen,
eine weitere kleinere zwischen Hinterrandsborste und unterer Klaue, eine 6. undeutliche zwischen
beiden Klauen.
Bewegung: Das Thier kriecht ziemlich lebhaft umher, vermag sich nicht gleitend über den
Boden zu bewegen.
Vorkommen: Die Art gehört zu den häufigsten Frühjahrsformen, sie findet sich sehr häufig
in flachen Wiesentümpeln und Gräben, bald mit, bald ohne Vegetation. Ich habe sie nur an solchen
Orten getroffen, die im Sommer austrocknen; entsprechend findet man die Thiere nur im Frühjahr,
*) Einmal fand ich die Klanen ungezähnt.