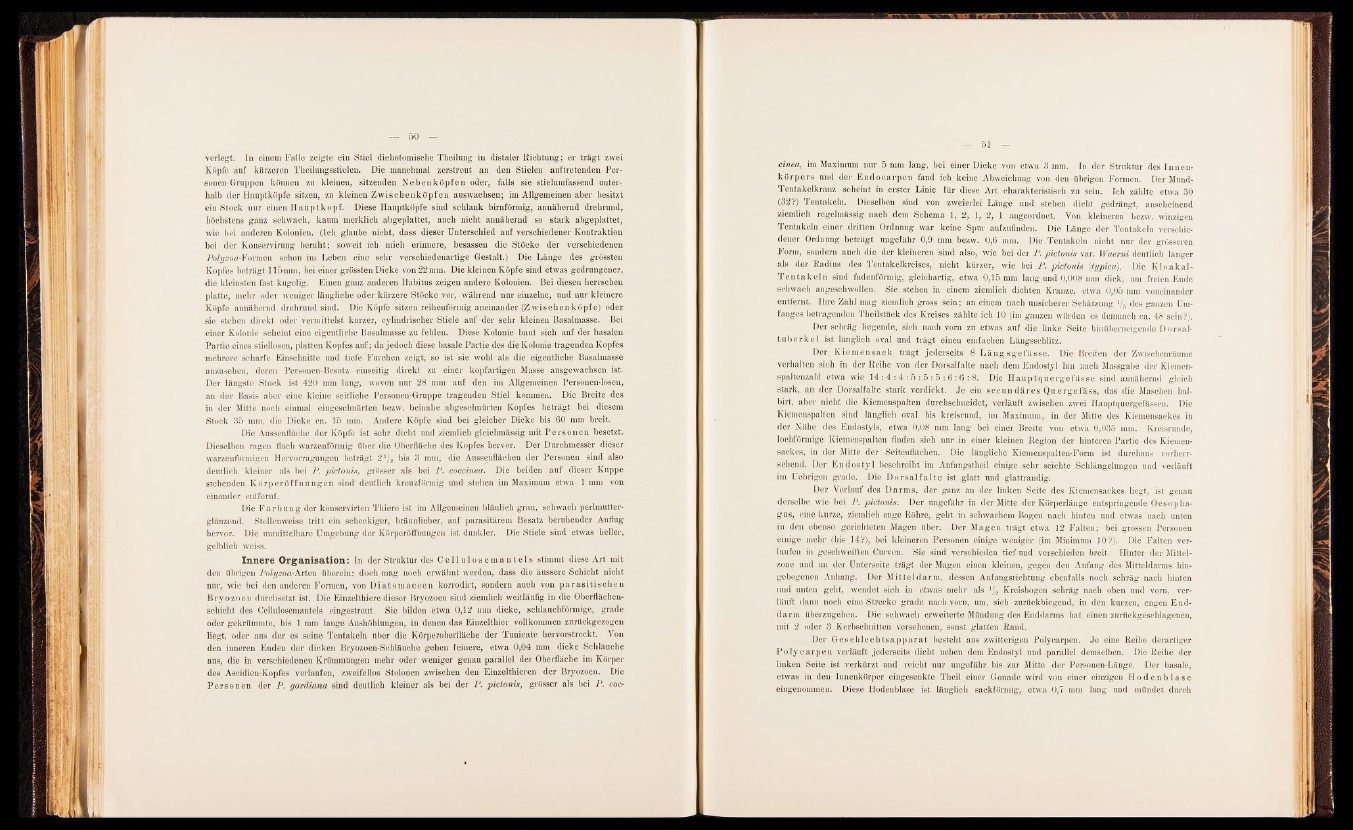
verlegt. In einem Falle zeigte ein Stiel dichotomische Theilung in distaler Richtung; er trägt zwei
Köpfe auf kürzeren Tkeilungsstielen. Die manchmal zerstreut an den Stielen auftretenden Personen
Gruppen können zu kleinen, sitzenden Nebenköpfen oder, falls sie stielumfassend unterhalb
der Hauptköpfe sitzen, zu kleinen Zwischenköpfen auswachsen; im Allgemeinen aber besitzt
ein Stock nur einen Hauptkopf. Diese Hauptköpfe sind schlank bimförmig, annähernd drehrund,
höchstens ganz schwach, kaum merklich abgeplattet, auch nicht annähernd so stark abgeplattet,
wie bei anderen Kolonien. (Ich glaube nicht, dass dieser Unterschied auf verschiedener Kontraktion
bei der Konservirung beruht; soweit ich mich erinnere, besassen die Stöcke der verschiedenen
Polyzoa-Formen schon im Leben eine sehr verschiedenartige Gestalt.) Die Länge des grössten
Kopfes beträgt 115mm, bei einer grössten Dicke von 22mm. Die kleinen Köpfe sind etwas gedrungener,
die kleinsten fast kugelig. Einen ganz anderen Habitus zeigen andere Kolonien. Bei diesen herrschen
platte, mehr oder weniger längliche oder kürzere Stöcke vor, während nur einzelne, und nur kleinere
Köpfe annähernd drehrund sind. Die Köpfe sitzen reihenförmig aneinander (Z wischen köpfe) oder
sie stehen direkt oder vermittelst kurzer, cylindrischer Stiele auf der sehr kleinen Basalmasse. Bei
einer Kolonie scheint eine eigentliche Basalmasse zu fehlen. Diese Kolonie baut sich auf der basalen
Partie eines stiellosen, platten Kopfes auf; da jedoch diese basale Partie des die Kolonie tragenden Kopfes
mehrere scharfe Einschnitte und tiefe Furchen zeigt, so ist sie wohl als die eigentliche Basalmasse
anzusehen, deren Personen-Besatz einseitig direkt zu einer kopfartigen Masse ausgewachsen ist.
Der längste Stock ist 420 mm lang, wovon nur 28 mm auf den im Allgemeinen Personen-losen,
an der Basis aber eine kleine seitliche Personen-Gruppe tragenden Stiel kommen. Die Breite des
in der Mitte noch einmal eingeschnürten bezw. beinahe abgeschnürten Kopfes beträgt bei diesem
Stock 35 mm, die Dicke ca. 15 mm. Andere Köpfe sind bei gleicher Dicke bis 60 mm breit.
Die Aussenfläche der Köpfe ist sehr dicht und ziemlich gleichmässig mit Personen besetzt.
Dieselben ragen flach warzenförmig über die Oberfläche des Kopfes hervor. Der Durchmesser dieser
warzenförmigen Hervorragungen beträgt 2 1/2 bis 3 mm, die Aussenflächen der Personen sind also
deutlich kleiner als bei P. pictonis, grösser als bei P. coccínea. Die beiden auf dieser Kuppe
stehenden Körperöffnungen sind deutlich kreuzförmig uhd stehen im Maximum etwa 1 mm von
einander entfernt.
Die Fä rbung der konservirten Thiere ist im Allgemeinen bläulich grau, schwach perlmutterglänzend.
Stellenweise tritt ein scheckiger, bräunlicher, auf parasitärem Besatz beruhender Anflug
hervor. Die unmittelbare Umgebung der Körperöffnungen ist dunkler. Die Stiele sind etwas heller,
gelblich weiss.
Innere Organisation: In der Struktur des Ce l l u l o s ema n t e l s stimmt diese Art mit
den übrigen Polyzoa-Arten überein; doch mag noch erwähnt werden, dass die äussere Schicht nicht
nur, wie bei den anderen Formen, von Diatomaceen korrodirt, sondern auch von p arasitischen
Bryozoen durchsetzt ist. Die Einzelthiere dieser Bryozoen sind ziemlich weitläufig in die Oberflächen-
schicht des Cellulosemantels eingestreut. Sie bilden etwa 0,12 mm dicke, schlauchförmige, grade
oder gekrümmte, bis 1 mm lange Aushöhlungen, in denen das Einzelthier vollkommen zurückgezogen
liegt, oder aus der es seine Tentakeln über die Körperoberfläche der Tunicate hervorstreckt. Von
den inneren Enden der dicken Bryozoen-Schläucke gehen feinere, etwa 0,04 mm dicke Schläuche
aus, die in verschiedenen Krümmungen mehr oder weniger genau parallel der Oberfläche im Körper
des Ascidien-Kopfes verlaufen, zweifellos Stolonen zwischen den Einzelthieren der Bryozoen. Die
Personen der P. gordiana sind deutlich kleiner als bei der P. pictonis, grösser als bei P. cocr
cinea, im Maximum nur 5 mm lang, bei einer Dicke von etwa 3 mm. In der Struktur des Innenkörpers
und der Endocarpen fand ich keine Abweichung von den übrigen Formen. Der Mund-
Tentakelkranz scheint in erster Linie für diese Art charakteristisch zu sein. Ich zählte etwa 30
(32?) Tentakeln. Dieselben sind von zweierlei Länge und stehen dicht gedrängt, anscheinend
ziemlich regelmässig nach dem Schema 1, 2, 1, 2, 1 angeordnet. Von kleineren bezw. winzigen
Tentakeln einer dritten Ordnung war keine Spur aufzufinden. Die Länge der Tentakeln verschiedener
Ordnung beträgt ungefähr 0,9 mm bezw. 0,6 mm. Die Tentakeln nicht nur der grösseren
Form, sondern auch die der kleineren sind also, wie bei der P. pictonis var. Waerni deutlich länger
als der Radius des Tentakelkreises, nicht kürzer, wie bei P. pictonis {typica). Die Kloakal-
Tentakeln sind fadenförmig, gleichartig, etwa 0,15 mm lang und 0,008 mm dick, am freien Ende
schwach angeschwollen. Sie stehen in einem ziemlich dichten Kranze, etwa 0,05 mm voneinander
entfernt. Ihre Zahl mag ziemlich gross sein; an einem nach unsicherer Schätzung J/5 des ganzen Umfanges
betragenden Theilstück des Kreises zählte ich 10 (im ganzen würden es demnach ca. 48 sein ?).
Der schräg liegende, sich nach vorn zu etwas auf die; linke Seite binüberneigende Dorsalt
uberkel ist länglich oval und trägt einen einfachen Längsschlitz.
Der Kiemensack trägt jederseits 8 L ängsgefässe. Die Breiten der Zwischenräume
verhalten sich in der Reihe von der Dorsalfalte nach dem Endostyl hin nach Massgabe der Kiemenspaltenzahl
etwa wie 1 4 : 4 : 4 : 5 : 5 : 5 : 6 : 6 : 8 . Die Hauptquergefässe sind annähernd gleich
stark, an der Dorsalfalte stark verdickt. Je ein secun däres Qu ergefäss, das die Maschen hal-
birt, aber nicht die Kiemenspalten durchschneidet, verläuft zwischen zwei Hauptquergefässen. Die
Kiemenspalten sind länglich oval bis kreisrund, im Maximum, in der Mitte des Kiemensackes in
der Nähe des Endostyls, etwa 0,08 mm lang bei einer Breite von etwa 0,035 mm. Kreisrunde,
lochförmige Kiemenspalten finden sich nur in einer kleinen Region der hinteren Partie des Kiemensackes,
in der Mitte der Seitenflächen. Die längliche Kiemenspalten-Form ist durchaus vorherrschend.
Der Endostyl beschreibt im Anfangstheil einige sehr seichte Schlängelungen und verläuft
im Uebrigen grade. Die Dorsalfal te ist glatt und glattrandig.
Der Verlauf des Darms, der ganz an der linken Seite des Kiemensackes liegt, ist genau
derselbe wie bei P. pictonis. Der ungefähr in der Mitte der Körperlänge entspringende Oesophagus,
eine kurze, ziemlich enge Röhre, geht in schwachem Bogen nach hinten und etwas nach unten
in den ebenso gerichteten Magen über. Der Magen trägt etwa 12 Falten; bei grössen Personen
einige mehr (bis 14?), bei kleineren Personen einige weniger (im Minimum 10?). Die Falten verlaufen
in geschweiften Curven. Sie sind verschieden tief und verschieden breit. Hinter der Mittelzone
und an der Unterseite trägt der Magen einen kleinen, gegen den Anfang des Mitteldarms hingebogenen
Anhang. Der Mitteldarm, dessen Anfangsrichtung ebenfalls noch schräg nach hinten
und unten geht, wendet sich in etwas mehr als 1/s Kreisbogen schräg nach oben und vorn, verläuft
dann noch eine Strecke grade nach vorn, um, sich zurückbiegend, in den kurzen, engen Enddarm
überzugehen. Die schwach erweiterte Mündung des Enddarms hat einen zurückgeschlagenen,
mit 2 oder 3 Kerbschnitten versehenen, sonst glatten Rand.
Der Geschlechtsapparat besteht aus zwitterigen Polyearpen. Je eine Reihe derartiger
Polycarpen verläuft jederseits dicht neben dem Endostyl und parallel demselben. Die Reihe der
linken Seite ist verkürzt und reicht nur ungefähr bis zur Mitte der Personen-Länge. Der basale,
etwas in den Innenkörper eingesenkte Theil einer Gonade wird von einer einzigen Ho d e n b l a s e
eingenommen. Diese Hodenblase ist läuglich sackförmig, etwa 0,7 mm lang und mündet durch