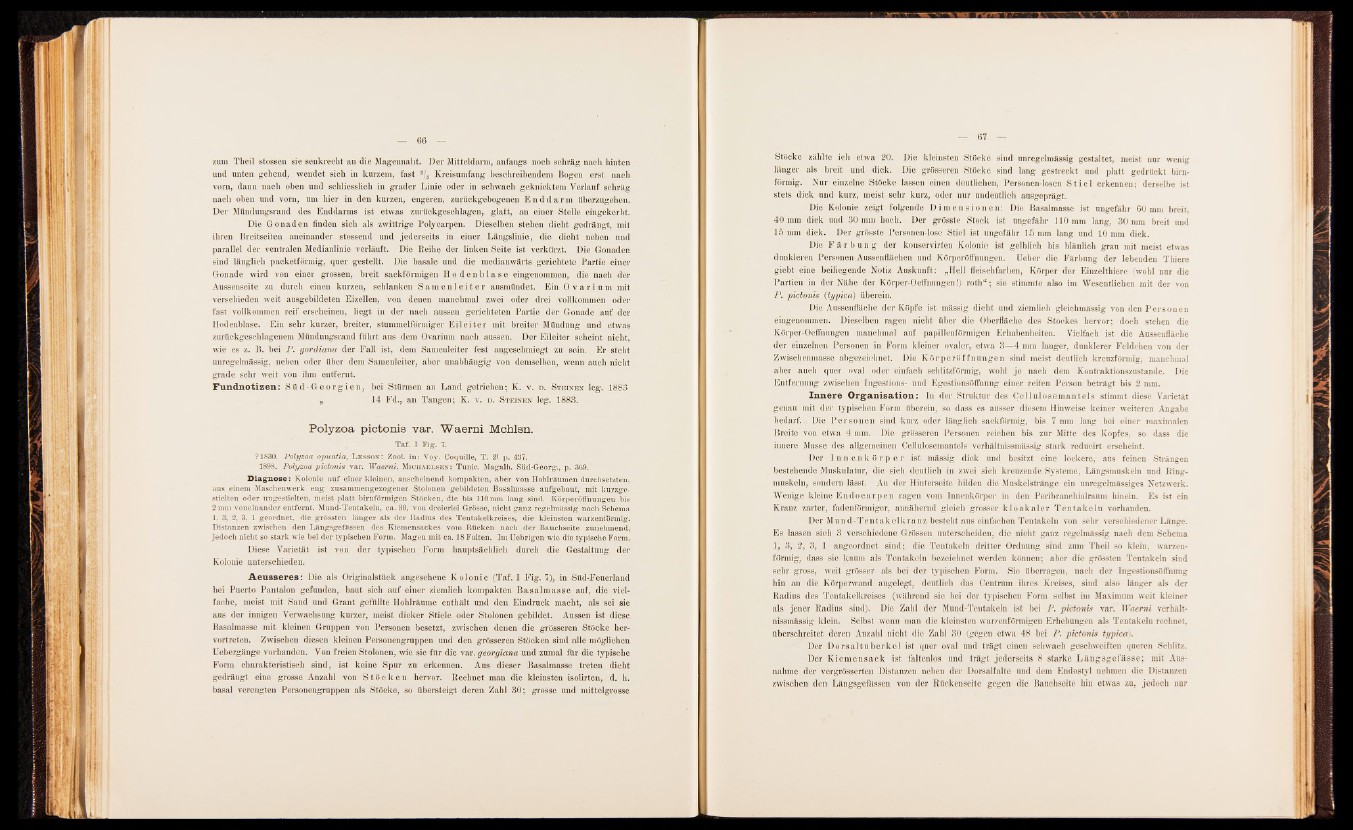
zum Theil stossen sie senkrecht an die Magennaht. Der Mitteldarm, anfangs noch schräg nach hinten
und unten gehend, wendet sich in kurzem, fast 2/s Kreisumfang beschreibendem Bogen erst nach
vorn, dann nach oben und schliesslich in grader Linie oder in schwach geknicktem Verlauf schräg
nach oben und vorn, um hier in den kurzen, engeren, zurückgebogenen E n d d a rm überzugehen.
Der Mündungsrand des Enddarms ist etwas zurückgeschlagen, glatt, an einer Stelle eingekerbt.
Die Gonaden finden sich als zwittrige Polycarpen. Dieselben stehen dicht gedrängt, mit
ihren Breitseiten aneinander stossend und jederseits in einer Längslinie, die dicht neben und
parallel der ventralen Medianlinie verläuft. Die Reihe der linken Seite ist verkürzt. Die Gonaden
sind länglich packetförmig, quer gestellt. Die basale und die medianwärts gerichtete Partie einer
Gonade wird von einer grossen, breit sackförmigen Ho d e n b l a s e eingenommen, die nach der
Aussenseite zu durch einen kurzen, schlanken S ame n l e i t e r ausmündet. Ein 0 v a r i um mit
verschieden weit ausgebildeten Eizellen, von denen manchmal zwei oder drei vollkommen oder
fast vollkommen reif erscheinen, liegt in der nach aussen gerichteten Partie der Gonade auf der
Hodenblase. Ein sehr kurzer, breiter, stummelförmiger Eilei ter mit breiter Mündung und etwas
zurückgeschlagenem Mündungsrand führt aus dem Ovarium nach aussen. Der Eileiter scheint nicht,
wie es z. B. bei P. gordiana der Fall ist, dem Samenleiter fest angesehmiegt zu sein. Er steht
unregelmässig, neben oder über dem Samenleiter, aber unabhängig von demselben, wenn auch nicht
grade sehr weit von ihm entfernt.
F u n d n o tiz e n : Sü d -Ge o rg i e n , bei Stürmen an Land getrieben; K. v . d. S teinen leg. 1883
„ 14 Fd., an Tangen; K. v . d. Steinen leg. 1883.
Polyzoa pictonis var. Waerni Mchlsn.
Taf. I F ig . 7.
? 1830. P o ly zo a o pu ntia , Lesson: Zool. in: Voy. Coquille, T. 21 p. 437.
1898. P o ly zo a p ic to n is var. W a e rn i, Michaelsen: Tunic. Magalh. Süd-Georg., p. 369.
Diagnose: Kolonie a u f ein er k le inen, anscheinend kompakten, aber v on Hohlräumen durchsetzten,
au s einem Maschenwerk en g zusamm en g ezo g ene r Stolonen g eb ilde ten Basalmasse aufgebaut, mit k u r zg e stielten
oder unge stielten , me ist platt bimförmigen Stöcken, die bis 110 mm la n g sind. Körperöffbungen bis
2 mm voneinander entfernt. Mund-Tentakeln, ca. 30, v on dreierlei Grösse, nicht g a n z r e g elmä ssig nach Schema
1, 3, 2, 3, 1 geordnet, d ie grössten läng e r als der Radius des Tentakelkreises, die kle insten .warzenförmig.
Distanzen zwischen den L ä n g sg e fä ssen des Kiemensacke s vom Rücken nach der B auchse ite zunehmend,
jedo ch nicht so stark w ie bei der typischen Form. Magen mit ca. 18 F alten. Im Uebrigen w ie d ie typische Form.
Diese Varietät ist von der typischen Form hauptsächlich durch die Gestaltung der
Kolonie unterschieden.
A eu s se re s : Die als Originalstück angesehene Kolonie (Taf. I Fig. 7), in Süd-Feuerland
bei Puerto Pantalon gefunden, baut sich auf einer ziemlich kompakten Basalmasse auf, die vielfache,
meist mit Sand und Grant gefüllte Hohlräume enthält und den Eindruck macht, als sei sie
aus der innigen Verwachsung kurzer, meist dicker Stiele oder Stolonen gebildet. Aussen ist diese
Basalmasse mit kleinen Gruppen von Personen besetzt, zwischen denen die grösseren Stöcke hervortreten.
Zwischen diesen kleinen Personengruppen und den grösseren Stöcken sind alle möglichen
Uebergänge vorhanden. Von freien Stolonen, wie sie für die var. georgiana und zumal für die typische
Form charakteristisch sind, ist keine Spur zu erkennen. Aus dieser Basalmasse treten dicht
gedrängt eine grosse Anzahl von S t ö c k e n hervor. Rechnet man die kleinsten isolirten, d. h.
basal verengten Personengruppen als Stöcke, so übersteigt deren Zahl 30; grosse und mittelgrosse
Stöcke zählte ich etwa 20. Die kleinsten Stöcke sind unregelmässig gestaltet, meist nur wenig
länger als breit und dick. Die grösseren Stöcke sind lang gestreckt und platt gedrückt bimförmig.
Nur einzelne Stöcke lassen einen deutlichen, Personen-losen St i e l erkennen; derselbe ist
stets dick und kurz, meist sehr kurz, oder nur undeutlich ausgeprägt.
Die Kolonie zeigt folgende Dimensionen : Die Basalmasse ist ungefähr 60mm breit,
40 mm dick und 30 mm hoch. Der grösste Stock ist ungefähr 110 mm lang, 30 mm breit und
15 mm dick. Der grösste Personen-lose Stiel ist ungefähr 15 mm lang und 10 mm dick.
Die F ä r b u n g der konservirten Kolonie ist gelblich bis bläulich grau mit meist etwas
dunkleren Personen Aussenflächen und Körperöffnungen. Ueber die Färbung der lebenden Thiere
giebt eine beiliegende Notiz Auskunft: „Hell fleischfarben, Körper der Einzelthiere (wobl nur die
Partien in der Nähe der Körper-Oeffnungen!) roth“ ; sie stimmte also im Wesentlichen mit der von
P. pictonis (typica) überein.
Die Aussenfläche der Köpfe ist mässig dicht und ziemlich gleichmässig von den Personen
eingenommen. Dieselben ragen nicht über die Oberfläche des Stockes hervor; doch stehen die
Körper-Oeffnungen manchmal auf papillenförmigen Erhabenheiten. Vielfach ist die Aussenfläche
der einzelnen Personen in Form kleiner ovaler, etwa 3—4 mm langer, dunklerer Feldehen von der
Zwischenmasse abgezeichnet. Die Körperöffnungen sind meist deutlich kreuzförmig, manchmal
aber auch quer oval oder einfach schlitzförmig, wohl je nach dem Kontraktionszustande. Die
Entfernung zwischen Ingestions- und Egestionsöffnung einer reifen Person beträgt bis 2 mm.
In n e re O rg a n isa tio n : In der Struktur des Cellulosemantels stimmt diese Varietät
genau mit der typischen Form überein, so dass es ausser diesem Hinweise keiner weiteren Angabe
bedarf. Die Personen sind kurz oder länglich sackförmig, bis 7 mm lang bei einer maximalen
Breite von etwa 4 mm. Die grösseren Personen reichen bis zur Mitte des Kopfes, so dass die
innere Masse des allgemeinen Cellulosemantels verhältnissmässig stark redueirt erscheint.
Der I n n e n k ö r p e r ist mässig dick und besitzt eine lockere, aus feinen Strängen
bestehende Muskulatur, die sich deutlich in zwei sich kreuzende Systeme, Längsmuskeln und Ringmuskeln,
sondern lässt. An der Hinterseite bilden die Muskelstränge ein unregelmässiges Netzwerk.
Wenige kleine Endocarpen ragen vom Innenkörper in den Peribranchialraum hinein. Es ist ein
Kranz zarter, fadenförmiger, annähernd gleich grösser kloakaler Tentakeln vorhanden.
Der Mund-Tentakelkranz besteht aus einfachen Tentakeln von sehr verschiedener Länge.
Es lassen sich 3 verschiedene Grössen unterscheiden, die nicht ganz regelmässig nach dem Schema
1, 3, 2, 3, 1 angeordnet sind; die Tentakeln dritter Ordnung sind zum Theil so klein, warzenförmig,
dass sie kaum als Tentakeln bezeichnet werden können; aber die grössten Tentakeln sind
sehr gross, weit grösser als bei der typischen Form. Sie überragen, nach der Ingestionsöffnung
hin an die Körperwand angelegt, deutlich das Centrum ihres Kreises, sind also länger als der
Radius des Tentakelkreises (während sie bei der typischen Form selbst im Maximum weit kleiner
als jener Radius sind). Die Zahl der Mund-Tentakeln ist bei P. pictonis var. Waerni verhältnissmässig
klein. Selbst wenn man die kleinsten warzenförmigen Erhebungen als Tentakeln rechnet,
überschreitet deren Anzahl nicht die Zahl 30 (gegen etwa 48 bei P. pictonis typica).
Der Dorsal tuberkel ist quer oval und trägt einen schwach geschweiften queren Schlitz.
Der Kiemensack ist faltenlos und trägt jederseits 8 starke Längsgefässe; mit Ausnahme
der vergrösserten Distanzen neben der Dorsalfalte und dem Endostyl nehmen die Distanzen
zwischen den Längsgefässen von der Rückenseite gegen die Bauchseite hin etwas zu, jedoch nur