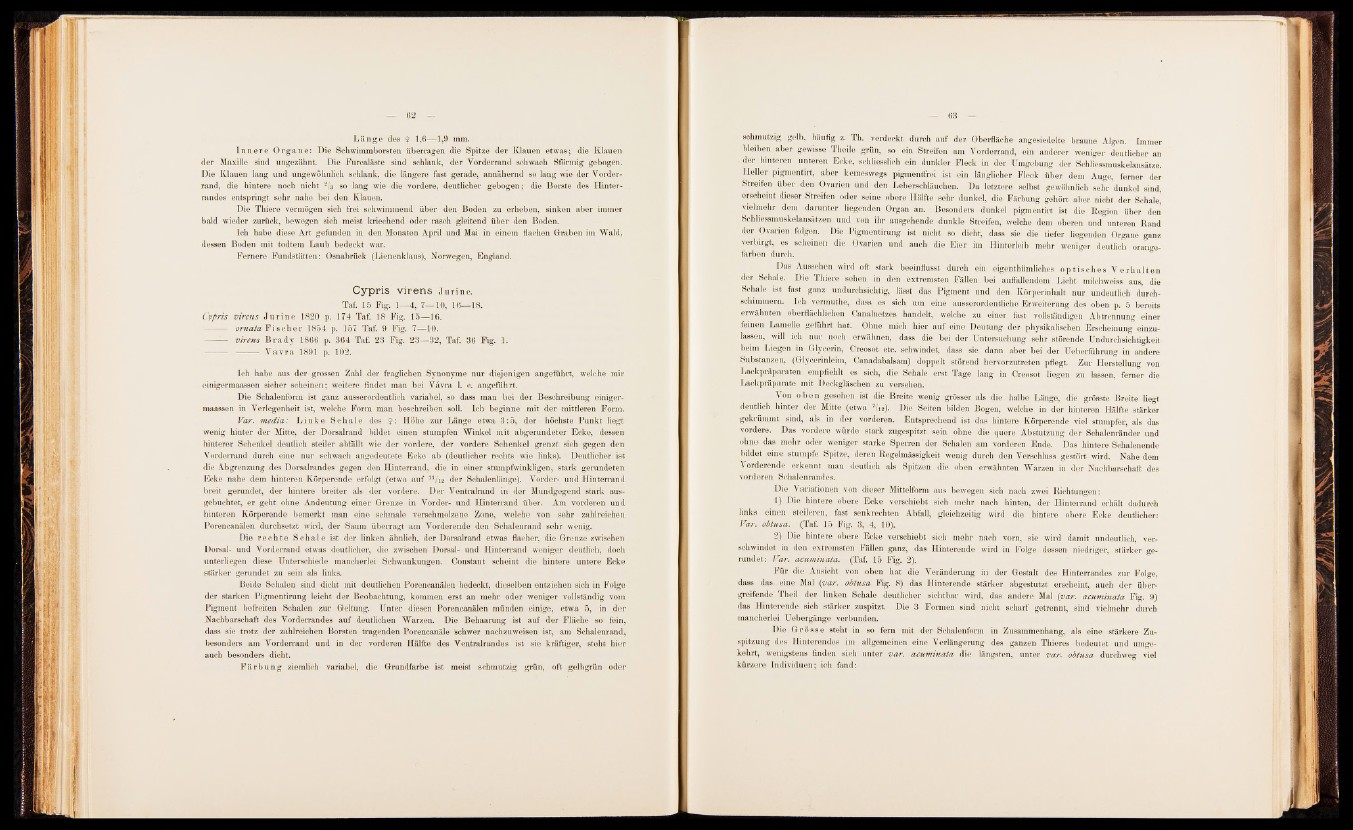
Länge des 9 1,6—1,9 mm.
In n e re Organe: Die Schwimmborsten überragen die Spitze der Klauen etwas; die Klauen
der Maxille sind ungezähnt. Die Furcaläste sind schlank, der Yorderrand schwach Sförmig gebogen.
Die Klauen lang und ungewöhnlich schlank, die längere fast gerade, annähernd so lang wie der Yorderrand,
die hintere noch nicht 2/s so lang wie die vordere, deutlicher gebogen; die Borste des Hinterrandes
entspringt sehr nahe bei den Klauen.
Die Thiere vermögen sich frei schwimmend über den Boden zu erheben, sinken aber immer
bald wieder zurück, bewegen sich meist kriechend oder rasch gleitend über den Boden.
Ich habe diese Art gefunden in den Monaten April und Mai in einem flachen Graben im Wald,
dessen Boden mit todtem Laub bedeckt war.
Fernere Fundstätten: Osnabrück (Lienenklaus), Norwegen, England.
Cypris v ire n s Ju rin e .
Taf. 15 Fig. 1—4, 7—10, 16—18.
Cypris virens Ju rin e 1820 p. 174 Taf. 18 Fig. 15-^—16.
— ornata F isc h e r 1854 p. 157 Taf. 9 Fig. 7—10.
— virens Brady 1866 p. 364 Taf. 28 Fig. 23—32, Taf. 36 Fig. 1.
— ----- Yavra 1891 p. 102.
Ich habe aus der grossen Zahl der fraglichen Synonyme nur diejenigen angeführt, welche mir
einigermaassen sicher scheinen; weitere findet man bei Yavra 1. c. angeführt.
Die Schalenform ist ganz ausserordentlich variabel, so dass man bei der Beschreibung einiger-
maassen in Yerlegenheit ist, welche Form man beschreiben soll. Ich beginne mit der mittleren Form.
Var. media: Linke Schale des $: Höhe zur Länge etwa 3:5, der höchste Punkt liegt
wenig hinter der Mitte, der Dorsalrand bildet einen stumpfen Winkel mit abgerundeter Ecke, dessen
hinterer Schenkel deutlich steiler abfallt wie der vordere, der vordere Schenkel grenzt sich gegen den
Vorderrand durch eine nur schwach angedeutete Ecke ab (deutlicher rechts wie links). Deutlicher ist
die Abgrenzung des Dorsalrandes gegen den Hinterrand, die in einer stumpfwinkligen, stark gerundeten
Ecke nahe dem hinteren Körperende erfolgt (etwa auf 11/ia der Schalenlänge). Vorder- und Hinterrand
breit gerundet, der hintere breiter als der vordere. Der Ventralrand in der Mundgegend stark ausgebuchtet,
er geht ohne Andeutung einer Grenze in Vorder- und Hinterrand über. Am vorderen und
hinteren Körperende bemerkt man eine schmale verschmolzene Zone, welche von sehr zahlreichen
Porencanälen durchsetzt wird, der Saum überragt am Vorderende den Schalenrand sehr wenig.
Die re ch te Schale ist der linken ähnlich, der Dorsalrand etwas flacher, die Grenze zwischen
Dorsal- und Vorderrand etwas deutlicher, die zwischen Dorsal- und Hinterrand weniger deutlich, doch
unterliegen diese Unterschiede mancherlei Schwankungen. Constant scheint die hintere untere Ecke
stärker gerundet zu sein als links.
Beide Schalen sind dicht mit deutlichen Porencanälen bedeckt, dieselben entziehen sich in Folge
der starken Pigmentirung leicht der Beobachtung, kommen erst an mehr oder weniger vollständig vom
Pigment befreiten Schalen zur Geltung. Unter diesen Porencanälen münden einige, etwa 5, in der
Nachbarschaft des Vorderrandes auf deutlichen Warzen. Die Behaarung ist auf der Fläche so fein,
dass sie trotz der zahlreichen Borsten tragenden Porencanäle schwer nachzuweisen ist, am Schalenrand,
besonders am Vorderrand und in der vorderen Hälfte des Ventralrandes ist sie kräftiger, steht hier
auch besonders dicht.
F ä rb u n g ziemlich variabel, die Grundfarbe ist meist schmutzig grün, oft gelbgrün oder
schmutzig gelb, häufig z. Th. verdeckt durch auf der Oberfläche angesiedelte braune Algen. Immer
bleiben aber gewisse Theile grün, so ein Streifen am Vorderrand, ein anderer weniger deutlicher an
der hinteren unteren Ecke, schliesslich ein dunkler Fleck in der Umgebung der Schliessmuskelansätze.
Heller pigmentirt, aber keineswegs pigmentfrei ist ein länglicher Fleck über dem Auge, ferner der
Streifen über den Ovarien und den Leberschläuchen. Da letztere selbst gewöhnlich sehr dunkel sind,
erscheint dieser Streifen oder seine obere Hälfte sehr dunkel, die Färbung gehört aber nicht der Schale,
vielmehr dem darunter liegenden Organ an. Besonders dunkel pigmentirt ist die Region über den
Schliessmuskelansätzen und. von ihr ausgehende dunkle Streifen, welche dem oberen und unteren Rand
der Ovarien folgen. Die Pigmentirung ist nicht so dicht, dass sie die tiefer liegenden Organe ganz
verbirgt, es scheinen die Ovarien und auch die Eier im Hinterleib mehr weniger deutlich orangefarben
durch.
Das Aussehen wird oft stark beeinflusst durch ein eigentümliches optisch e s V e rh a lten
der Schale. Die Thiere sehen in den extremsten Fällen bei auffallendem Licht milchweiss aus, die
Schale ist fast ganz undurchsichtig, lässt das Pigment und den Körperinhalt nur undeutlich durchschimmern.
Ich vermuthe, dass es sich um eine ausserordentliche Erweiterung des oben p. 5 bereits
erwähnten oberflächlichen Canalnetzes handelt, welche zu einer fast vollständigen Abtrennung einer
feinen Lamelle geführt hat. Ohne mich hier auf eine Deutung der physikalischen Erscheinung einzulassen,
will ich nur noch erwähnen, dass die bei der Untersuchung sehr störende Undurchsichtigkeit
beim Liegen in Glycerin, Creosot etc. schwindet, dass sie dann aber bei der Ueberführung in andere
Substanzen, (Glycerinleim, Canadabalsam) doppelt störend hervorzutreten pflegt. Zur Herstellung von
Lackpräparaten empfiehlt es sich, die Schale erst Tage lang in Creosot liegen zu lassen, ferner die
Lackpräparate mit Deckgläschen zu versehen.
Von oben gesehen ist die Breite wenig grösser als die halbe Länge, die grösste Breite liegt
deutlich hinter der Mitte (etwa 7/aa). Die Seiten bilden Bogen, welche in der hinteren Hälfte stärker
gekrümmt sind, als in der vorderen. Entsprechend ist das hintere Körperende viel stumpfer, als das
vordere. Das vordere würde stark zugespitzt sein ohne die quere Abstutzung der Schalenränder und
ohne- das mehr oder weniger starke Sperren der Schalen am vorderen Ende. Das hintere Schalenende
bildet eine stumpfe Spitze, deren Regelmässigkeit wenig durch den Verschluss gestört wird. Nahe dem
Vorderende erkennt man deutlich als Spitzen die oben erwähnten Warzen in der Nachbarschaft des
vorderen Schalenrandes.
Die Variationen von dieser Mittelform aus bewegen sich nach zwei Richtungen:
1) Die hintere obere Ecke verschiebt sich mehr nach hinten, der Hinterrand erhält dadurch
links einen steileren, fast senkrechten Abfall, gleichzeitig wird die hintere obere Ecke deutlicher:
Var. obtusa. (Taf. 15 Fig. 3, 4, 10).
2) Die hintere obere Ecke verschiebt sich mehr nach vorn, sie wird damit undeutlich, verschwindet
in den extremsten Fällen ganz, das Hinterende wird in Folge dessen niedriger, stärker gerundet:
Var. acuminata. (Taf. 15 Fig. 2).
Für die Ansicht von oben hat die Veränderung in der Gestalt, des Hinterrandes zur Folge,
dass das eine Mal (var. obtusa Fig. 8) das Hinterende stärker abgestutzt erscheint, auch der übergreifende
Theil der linken Schale deutlicher sichtbar wird, das andere Mal (var. acuminata Fig. 9)
das Hinterende sich stärker zuspitzt. Die 3 Formen sind nicht scharf getrennt, sind vielmehr durch
mancherlei Uebergänge verbunden.
Die Grösse steht in so fern mit der Schalenform in Zusammenhang, als eine stärkere Zuspitzung
des Hinterendes im allgemeinen eine Verlängerung des ganzen Thieres bedeutet und umgekehrt,
wenigstens finden sich unter var. acuminata die längsten, unter var. obtusa durchweg viel
kürzere Individuen; ich fand: