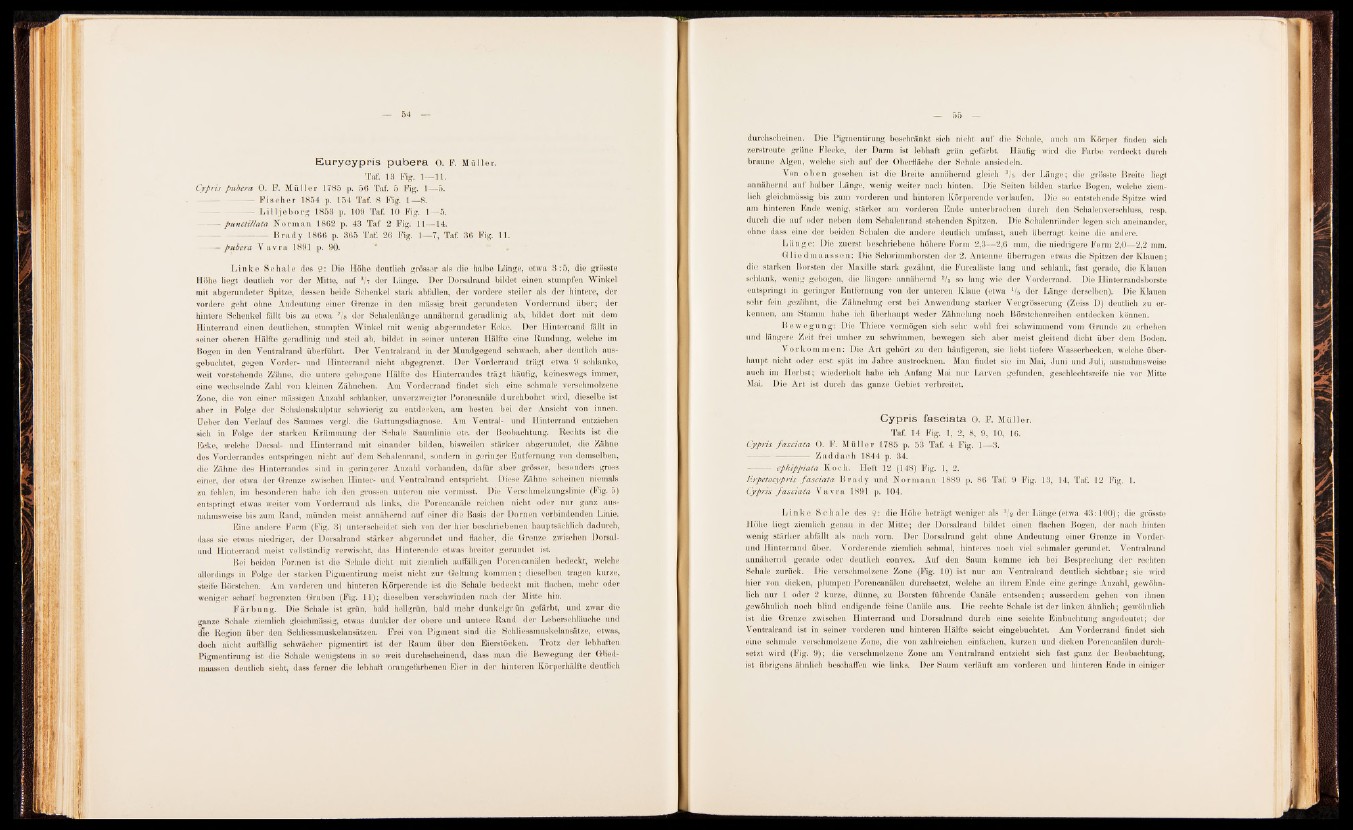
E u p y ey p ris p u b e r a 0. F. Müller.
Taf. 13 Fig. 1—11.
Cypns pubera 0. F. Müller 1785 p. 56 Taf. 5 Fig. 1—5.
— F isch e r 1854 p. 154 Taf. 8 Fig. 1—8.
— L illje b o rg 1853 p. 109 Taf. 10 Fig. 1—5.
— punctillata Norman 1862 p. 43 Taf 2 Fig. 11—14.
— Brady 1866 p. 365 Taf. 26 Fig. 1—7, Taf. 36 Fig. 11.
pubera Y av ra 1891 p. 90.
L in k e Schale des $: Die Höhe deutlich grösser als die halbe Länge, etwa 3:5, die grösste
Höhe liegt deutlich vor der Mitte, auf 8/? der Länge. Der Dorsalrand bildet einen stumpfen Winkel
mit abgerundeter Spitze, dessen beide Schenkel stark abfallen, der vordere steiler als der hintere, der
vordere geht ohne Andeutung einer Grenze in den mässig breit gerundeten Vorderrand über; der
hintere Schenkel fallt bis zu etwa 7/s der Schalenlänge annähernd geradlinig ab, bildet dort mit dem
Hinterrand einen deutlichen, stumpfen Winkel mit wenig abgerundeter Ecke. Der Hinterrand fällt in
seiner oberen Hälfte geradlinig und steil ab, bildet in seiner unteren Hälfte eine Rundung, welche im
Bogen in den Yentralrand überführt. Der Yentralrand in der Mundgegend schwach, aber deutlich ausgebuchtet,
gegen Vorder- und Hinterrand nicht abgegrenzt. Der Yorderrand trägt etwa 9 schlanke,
weit vorstehende Zähne, die untere gebogene Hälfte des Hinterrandes trägt häufig, keineswegs immer,
eine wechselnde Zahl von kleinen Zähnchen. Am Vorderrand findet sich eine schmale verschmolzene
Zone, die von einer mässigen Anzahl schlanker, unverzweigter Porencanäle durchbohrt wird, dieselbe ist
aber in Folge der Schalenskulptur schwierig zu entdecken, am besten bei der Ansicht von innen.
Ueber den Verlauf des Saumes vergl. die Gattungsdiagnose. Am Ventral- und Hinterrand entziehen
sich in Folge der starken Krümmung der Schale Saumlinie etc. der Beobachtung. Rechts ist die
Ecke, welche Dorsal- und Hinterrand mit einander bilden, bisweilen stärker abgerundet, die Zähne
des Vorderrandes entspringen nicht auf dem Schalenrand, sondern in geringer Entfernung von demselben,
die Zähne des Hinterrandes sind in geringerer Anzahl vorhanden, dafür aber grösser, besonders gross
einer, der etwa der Grenze zwischen Hinter- und Ventralrand entspricht. Diese Zähne scheinen niemals
zu fehlen, im besonderen habe ich den grossen unteren nie vermisst. Die Verschmelzungslinie (Fig. 5)
entspringt- etwas weiter vom Yorderrand als links, die Porencanäle reichen nicht oder nur ganz ausnahmsweise
bis zum Rand, münden meist annähernd auf einer die Basis der Dornen verbindenden Linie.
Eine andere Form (Fig. 3) unterscheidet sich von der hier beschriebenen hauptsächlich dadurch,
dass sie etwas niedriger, der Dorsalrand stärker abgerundet und flacher, die Grenze zwischen Dorsal-
und Hinterrand meist vollständig verwischt, das Hinterende etwas breiter gerundet ist.
Bei beiden Formen ist die Schale dicht mit ziemlich auffälligen Porencanälen bedeckt, welche
allerdings in Folge der starken Pigmentirung meist nicht zur Geltung kommen; dieselben tragen kurze,
steife Börstchen. Am vorderen und hinteren Körperende ist die Schale bedeckt mit flachen, mehr oder
weniger scharf begrenzten Gruben (Fig. 11); dieselben verschwinden nach der Mitte hin.
Färbung. Die Schale ist grün, bald hellgrün, bald mehr dunkelgrün gefärbt, und zwar die
ganze Schale ziemlich gleichmässig, etwas dunkler der obere und untere Rand der Leberschläuche und
die Region über den Schliessmuskelansätzen. Frei von Pigment sind die Schliessmuskelansätze, etwas,
doch nicht auffällig schwächer pigmentirt ist der Raum über den Eierstöcken. Trotz der lebhaften
Pigmentirung ist die Schale wenigstens in so weit durchscheinend, dass man die Bewegung der Glied-
maassen deutlich sieht, dass ferner die lebhaft orangefarbenen Eier in der hinteren Körperhälfte deutlich
durchscheinen. Die Pigmentirung beschränkt sich nicht auf die Schale, auch am Körper finden sich
zerstreute grüne Flecke, der Darm ist lebhaft grün gefärbt. Häufig wird die Farbe verdeckt durch
braune Algen, welche sich auf der Oberfläche der Schale ansiedeln.
Von oben gesehen ist die Breite annähernd gleich 8/s der Länge; die grösste Breite liegt
annähernd auf halber Länge, wenig weiter nach hinten. Die Seiten bilden starke Bogen, welche ziemlich
gleichmässig bis zum vorderen und hinteren Körperende verlaufen. Die so entstehende Spitze wird
am hinteren Ende wenig, stärker am vorderen Ende unterbrochen durch den Schalenverschluss, resp.
durch die auf oder neben dem Schalenrand stehenden Spitzen. Die Schalenränder legen sich aneinander,
ohne dass eine der beiden Schalen die andere deutlich umfasst, auch überragt keine die andere.
Länge: Die zuerst beschriebene höhere Form 2,3—2,6 mm, die niedrigere Form 2,0—2,2 mm.
Gliedmaassen: Die Schwimmborsten der 2. Antenne überragen etwas die Spitzen der Klauen;
die starken Borsten der Maxille stark gezähnt, die Furcaläste lang und schlank, fast gerade, die Klauen
schlank, wenig gebogen, die längere annähernd 2I» so lang wie der Yorderrand. Die Iiinterrandsborste
entspringt in geringer Entfernung von der unteren Klaue (etwa Vs der Länge derselben). Die Klauen
sehr fein gezähnt, die Zähnelung erst bei Anwendung starker Yergrösserung (Zeiss D) deutlich zu erkennen,
am Stamm habe ich überhaupt weder Zähnelung noch Börstchenreihen entdecken können.
Bewegung: Die Thiere vermögen sich sehr wohl frei schwimmend vom Grunde zu erheben
und längere Zeit frei umher zu schwimmen, bewegen sich aber meist gleitend dicht über dem Boden.
Vorkommen: Die Art gehört zu den häufigeren, sie liebt tiefere Wasserbecken, welche überhaupt
nicht oder erst spät im Jahre austrocknen. Man findet sie im Mai, Juni und Juli, ausnahmsweise
auch im Herbst; wiederholt habe ich Anfang Mai nur Larven gefunden, geschlechtsreife nie vor Mitte
Mai. Die Art ist durch das ganze Gebiet verbx*eitet.
C y p r i s f a s e i a t a o. F. Müller.
Taf. 14 Fig. 1, 2, 8, 9, 10, 16.
Cypris faseiata 0. F. Müller 1785 p. 53 Taf. 4 Fig. 1—3.
- ----------- Zaddach 1844 p. 34.
— ephippiata Koch. Heft 12 (148) Fig. 1, 2.
Erpetocypris faseiata Brady und Normann 1889 p. 86 Taf. 9 Fig. 13, 14, Taf. 12 Fig. 1.
Cypris faseiata Vavra 1891 p. 104.
L in k e S ch a le des ?: die Höhe beträgt weniger als Va der Länge (etwa 43:100); die grösste
Höhe liegt ziemlich genau in der Mitte; der Dorsalrand bildet einen flachen Bogen, der nach hinten
wenig stärker abfällt als nach vorn. Der Dorsalrand geht ohne Andeutung einer Grenze in Vorder-
und Hinterrand über. Vorderende ziemlich schmal, hinteres noch viel schmaler gerundet. Yentralrand
annähernd gerade oder deutlich convex. Auf den Saum komme ich bei Besprechung der rechten
Schale zurück. Die verschmolzene Zone (Fig. 10) ist nur am Yentralrand deutlich sichtbar; sie wird
hier von dicken, plumpen Porencanälen durchsetzt, welche an ihrem Ende eine geringe Anzahl, gewöhnlich
nur 1 oder 2 kurze, dünne, zu Borsten führende Canäle entsenden; ausserdem gehen von ihnen
gewöhnlich noch blind endigende feine Canäle aus. Die rechte Schale ist der linken ähnlich; gewöhnlich
ist die Grenze zwischen Hinterrand und Dorsalrand durch eine seichte Einbuchtung angedeutet; der
Yentralrand ist in seiner vorderen und hinteren Hälfte seicht eingebuchtet. Am Yorderrand findet sich
eine schmale verschmolzene Zone, die von zahlreichen einfachen, kurzen und dicken Porencanälen durchsetzt
wird (Fig. 9); die verschmolzene Zone am Yentralrand entzieht sich fast ganz der Beobachtung,
ist übrigens ähnlich beschaffen wie links. Der Saum verläuft am vorderen und hinteren Ende in einiger