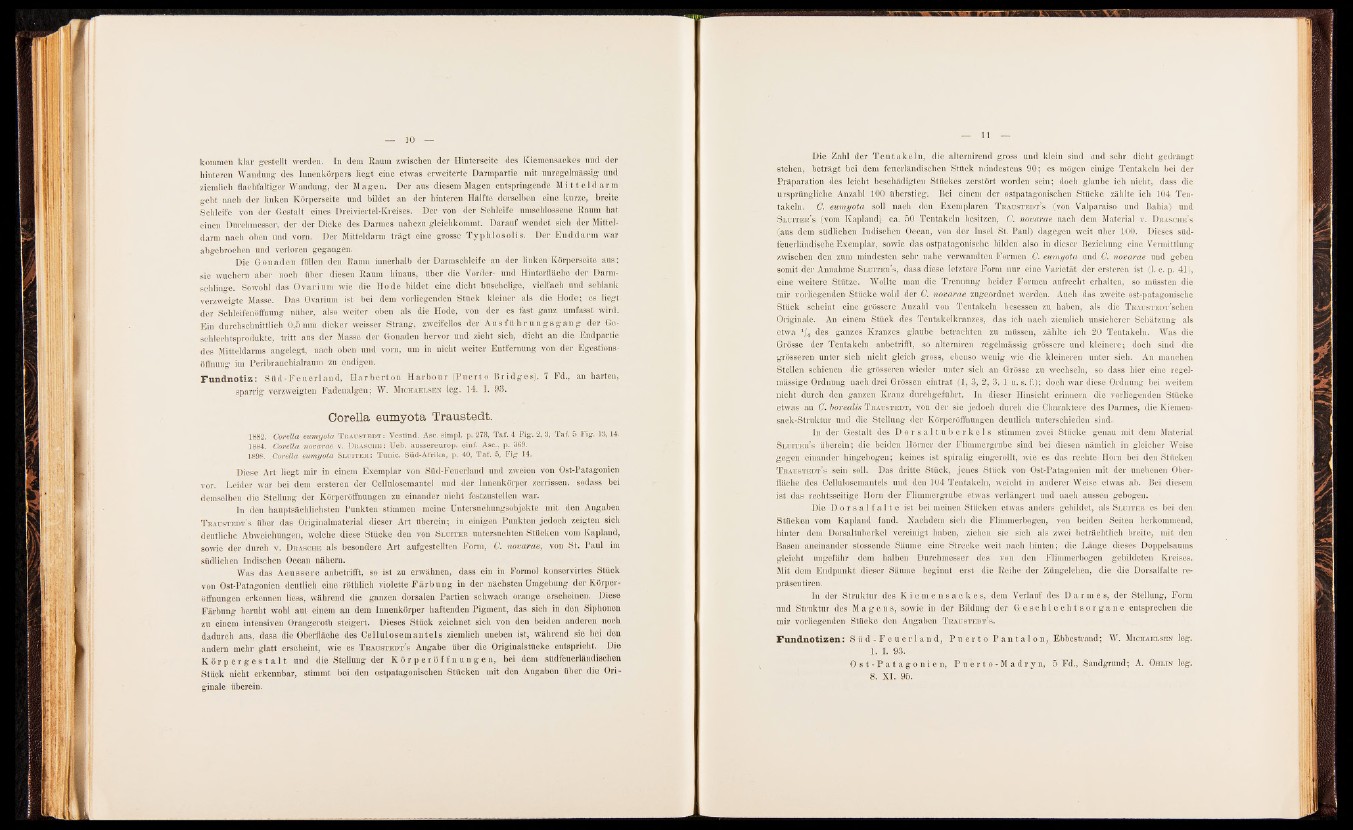
kommen klar gestellt werden. In dem Raum zwischen der Hinterseite des Kiemensackes und der
hinteren Wandung des Innenkörpers liegt eine etwas erweiterte Darmpartie mit unregelmässig und
ziemlich flachfaltiger Wandung, der Magen. Der aus diesem Magen entspringende Mi t l e i d arm
geht nach der linken Körperseite und bildet an der hinteren Hälfte derselben eine kurze, breite
Schleife von der Gestalt eines Dreiviertel-Kreises. Der von der Schleife umschlossene Raum hat
einen Durchmesser, der der Dicke des Darmes nahezugleichkommt. Darauf wendet sich der Mitteldarm
nach oben und vorn. Der Mitteldarm trägt eine grosse Typhlosolis. Der Enddarm war
abgebrochen und verloren gegangen.
Die Gonaden füllen den Raum innerhalb der Darmschleife an der linken Körperseite aus;
sie wuchern aber noch über diesen Raum hinaus, über die Vorder- und Hinterfläche der Darm-
schlino-e. Sowohl das Ovarium wie die Ho de bildet eine dicht btischelige, vielfach und schlank
verzweigte Masse. Das Ovarium ist bei dem vorliegenden Stück kleiner als die Hode; es liegt
der Schleifenöffnung näher, also weiter oben als die Hode, von der es fast ganz umfasst wird.
Ein durchschnittlich 0,5 mm dicker weisser Strang, zweifellos der Ausfü h r u n g s g a n g der Ge-
sehlechtsprodukte, tritt aus der Masse der Gonaden hervor und zieht sich, dicht an die Endpartie
des Mitteldarms angelegt, nach oben und vom, um in nicht weiter Entfernung von der Egestionsöffnung
im Peribranchialraum zu endigen.
Fundnotiz: Süd-Feuerl and, Harbert on Harbour (Puerto Bridges), 7 Fd., an harten,
sparrig verzweigten Fadenalgen; W. Michaelsen leg. 14. I. 93.
Co re lla e um y o ta T ra u s te d t.
1882. CoreUa eum yo ta T r a u s t e d t : Vestind. Asc. simpl. p. 273, Taf. 4 Fig. 2, 3, Taf. 5 F ig . 13,14.
1884. Corella n o va ra e v. Dräsche: Ueb. aussereurop. einf. Asc ., p. 369.
1898. Corella eum yo ta S l u i t e r : Tunic. Süd-Afrika, p. 40, Taf. 5, F ig 14.
Diese Art liegt mir in einem Exemplar von Süd-Feuerland und zweien von Ost-Patagonien
vor. Leider war bei dem ersteren der Cellulosemantel und der Innenkörper zerrissen, sodass bei
demselben die Stellung der Körperöffnungen zu einander nicht festzustellen war.
In den hauptsächlichsten Punkten stimmen meine Untersuehungsobjekte mit den Angaben
T raüstedt’s über das Originalmaterial dieser Art überein; in einigen Punkten jedoch zeigten sich
deutliche Abweichungen, welche diese Stücke den von Sluiter untersuchten Stücken vom Kapland,
sowie der durch v. Dräsche als besondere Art aufgestellten Form, C. novarae, von St. Paul im
südlichen Indischen Ocean nähern.
Was das Aeussere an betrifft, so ist zu erwähnen, dass ein in Formol konservirtes Stück
von Ost-Patagonien deutlich eine röthlicb violette Fär bung in der nächsten Umgebung der Körperöffnungen
erkennen liess, während die ganzen dorsalen Partien schwach orange erscheinen. Diese
Färbung beruht wohl aut- einem an dem Innenkörper haftenden Pigment, das sich in den Siphonen
zu einem intensiven Orangeroth steigert. Dieses Stück zeichnet sich von den beiden anderen noch
dadurch aus, dass die Oberfläche des Cellulosemantels ziemlich uneben ist, während sie bei den
ändern mehr glatt erscheint, wie es T raustedt’s Angabe über die Originalstücke entspricht. Die
K ö r p e r g e s t a l t und die Stellung der K ö r p e r ö f f n u n g e n , bei dem südfeuerländischen
Stück nicht erkennbar, stimmt bei den ostpatagonischen Stücken mit den Angaben über die Originale
überein.
Die Zahl der Tentakeln, die alternirend gross und klein sind und sehr dicht gedrängt
stehen, beträgt bei dem feuerländischen Stück mindestens 90; es mögen einige Tentakeln bei der
Präparation des leicht beschädigten Stückes zerstört worden sein; doch glaube ich nicht, dass die
ursprüngliche Anzahl 100 überstieg. Bei einem der ostpatagonischen Stücke zählte ich 104 Tentakeln.
C. eumyota soll nach den Exemplaren Traustedt’s (von Valparaiso und Bahia) und
Sluiter’s (vom Kapland) ca. 50 Tentakeln besitzen, C. novarae nach dem Material v. Drasche’s
(aus dem südlichen Indischen Ocean, von der Insel St. Paul) dagegen weit über 100. Dieses südfeuerländische
Exemplar, sowie das ostpatagonische bilden also in dieser Beziehung eine Vermittlung
zwischen den zum mindesten sehr nahe verwandten Formen C. eumyota und C. novarae und geben
somit der Annahme Sluiter’s, dass diese letztere Form nur eine Varietät der ersteren ist (1. c. p. 41),
eine weitere Stütze^ Wollte man die Trennung beider Formen aufrecht erhalten, so müssten die
mir vorliegenden Stücke wohl der C. novarae zugeordnet werden. Auch das zweite ost-patagonische
Stück scheint eine grössere Anzahl von Tentakeln besessen zu haben, als die TRAusTEDT’schen
Originale. An einem Stück des Tentakel kranzes, das ich nach ziemlich unsicherer Schätzung als
etwa */4 des ganzes Kranzes glaube betrachten zu müssen, zählte ich 20 Tentakeln. Was die
Grösse der Tentakeln anbetrifft, so alterniren regelmässig grössere und kleinere; doch sind die
grösseren unter sich nicht gleich gross, ebenso wenig wie die kleineren unter sich. An manchen
Stellen schienen die grösseren wieder unter sich an Grösse zu wechseln, so dass hier eine regelmässige
Ordnung nach drei Grössen eintrat (1, 3, 2, 3, 1 u. s. f.) ; doch war diese Ordnung bei weitem
nicht durch den ganzen Kranz durchgeführt. In dieser Hinsicht erinnern die vorliegenden Stücke
etwas an G. borealis T raustedt, von der sie jedoch durch die Charaktere des Darmes, die Kiemensack
Struktur und die Stellung der Körperöffnungen deutlich unterschieden sind.
In der Gestalt des D o r s a 11 u b e r k e 1 s stimmen zwei Stücke genau mit dem Material
Sluiter’s überein; die beiden Hörner der Flimmergrube sind bei diesen nämlich in gleicher Weise
gegen einander hingebogen; keines ist spiralig eingerollt, wie es das rechte Horn bei den Stücken
T raustedt’s sein solh;. Das dritte Stück, jenes Stück von Ost-Patagonien mit der unebenen Oberfläche
des Cellulosemantels und den 104 Tentakeln, weicht in anderer Weise etwas ab. Bei diesem
ist das rechtsseitige Horn der Flimmergrube etwas verlängert und nach aussen gebogen.
Die D o r s a l f a l t e ist bei meinen Stücken etwas anders gebildet, als Sluiter es bei den
Stücken vom Kapland fand. Nachdem sich die Flimmerbogen, von beiden Seiten herkommend,
hinter dem Dorsaltuberkel vereinigt haben, ziehen sie sich als zwei beträchtlich breite, mit den
Basen aneinander stossende Säume eine Strecke weit Dach hinten; die Länge dieses Doppelsaums
gleicht ungefähr dem halben Durchmesser des von den Flimmerbogen gebildeten Kreises.
Mit dem Endpunkt dieser Säume beginnt erst die Reihe der Züngelchen, die die Dorsalfalte re-
präsentiren.
In der Struktur des K i em e n s a c k e s , dem Verlauf des Da rme s , der Stellung, Form
und Struktur des Magens , sowie in der Bildung der G e s c h l e c h t s o r g a n e entsprechen die
mir vorliegenden Stücke den Angaben Traustedt’s.
Fundnotizen: S t t d - F e u e r l a n d , P u e r t o P a n t a l o n , Ebbestrand; W. Michaelsen leg.
1. I. 93.
0 s t - P a t a g o n i e n, P u e r t o -Ma d r y n , 5 Fd., Sandgrund; A. Ohlin leg.
8. XI. 95.