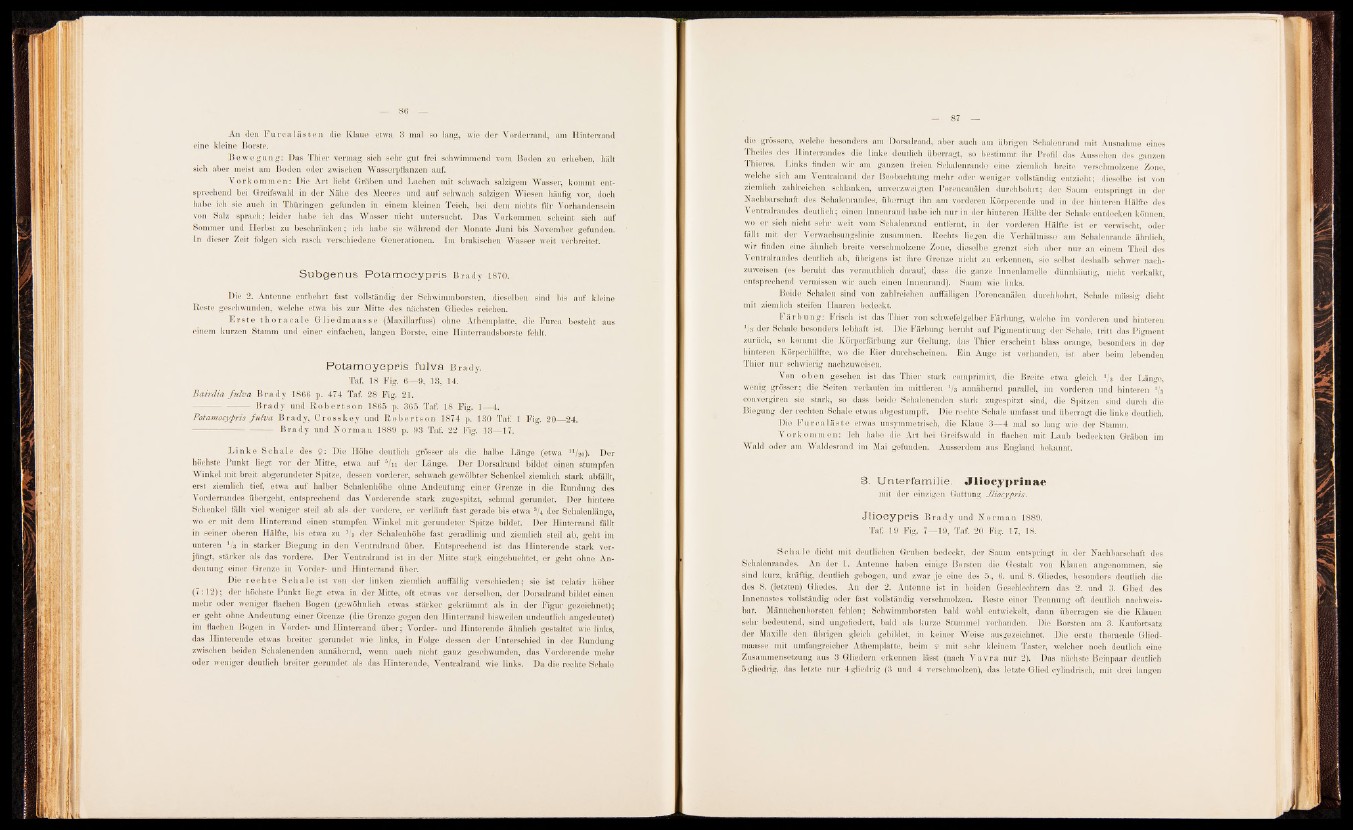
An den F ü re a la s te n die Klaue etwa 3 mal so lang, wie der Vorderrand, am Hinterrand
eine kleine Borste.
Bewegung: Das Thier vermag sich sehr gut frei schwimmend vom Boden zu erheben, hält
sich aber meist am Boden oder zwischen Wasserpflanzen auf.
Vorkommen: Die Art liebt Gräben und Lachen mit schwach salzigem Wasser, kommt entsprechend
bei Greifswald in der Nähe des Meeres und auf schwach salzigen Wiesen häufig vor, doch
habe ich sie auch in Thüringen gefunden in einem kleinen Teich, bei dem nichts für Vorhandensein
von Salz sprach; leider habe ich das Wasser nicht untersucht. Das Vorkommen scheint sich auf
Sommer und Herbst zu beschränken; ich habe sie während der Monate Juni bis November gefunden.
In dieser Zeit folgen sieh rasch verschiedene Generationen. Im brakischen Wasser weit verbreitet.
S u b g e n u s P o tam o c y p ris Brady 1870.
Die 2. Antenne entbehrt fast vollständig der Schwimmborsten, dieselben sind bis auf kleine
Reste geschwunden, welche etwa bis zur Mitte des nächsten Gliedes reichen.
E rs te th o r a c a le Glied maasse (Maxillarfuss) ohne Athemplatte, die Furca besteht aus
einem kurzen Stamm und einer einfachen, langen Borste, eine Hinterrandsborste fehlt.
P o tam o y e p r is fulva Brady.
Taf. 18 Fig. 6—9, 13, 14.
Bairdia fulva Brad y 1866 p. 474 Taf. 28 Fig. 21.
— Brady und R o b e rts o n 1865 p. 365 Taf. 18 Fig. 1—4.
Potamocypris fulva Brady, Crosskey und R o b e rtso n 1874 p. 130 Taf. 1 Fig. 20—24.
— Brady und Norman 1889 p. 93 Taf. 22 Fig. 13—17.
L in k e Schale des ?: Die Höhe deutlich grösser als die halbe Länge (etwa n /2o). Der
höchste Punkt liegt vor der Mitte, etwa auf 5/u der Länge. Der Dorsalrand bildet einen stumpfen
Winkel mit breit abgerundeter Spitze, dessen vorderer, schwach gewölbter Schenkel ziemlich stark abfällt,
erst ziemlich tief, etwa auf halber Schalenhöhe ohne Andeutung einer Grenze in die Rundung des
Vorderrandes übergeht, entsprechend das Vorderende stark zugespitzt, schmal gerundet. Der hintere
Schenkel fällt viel weniger steil ab als- der vordere, er verläuft fast gerade bis etwa 3/4 der Schalenlänge,
wo er mit dem Hinterrand einen stumpfen Winkel mit gerundeter Spitze bildet. Der Hinterrand fallt
in seiner oberen Hälfte, bis etwa zu 1/g der Schalenhöhe fast geradlinig und ziemlich steil ab, geht im
unteren 1/3 in starker Biegung in den Ventralrand über. Entsprechend ist das Hinterende stark verjüngt,
stärker als das vordere. Der Ventralrand ist in der Mitte stark eingebuchtet, er geht ohne Andeutung
einer Grenze in Vorder- und Hinterrand über.
Die re ch te Schale ist von der linken ziemlich auffällig verschieden; sie ist relativ höher
(7:12); der höchste Punkt liegt etwa in der Mitte, oft etwas vor derselben, der Dorsalrand bildet einen
mehr oder weniger flachen Bogen (gewöhnlich etwas stärker gekrümmt als in der Figur gezeichnet);
er geht ohne Andeutung einer Grenze (die Grenze gegen den Hinterrand bisweilen undeutlich angedeutet)
im flachen Bogen in Vorder- und Hinterrand über; Vorder- und Hinterende ähnlich gestaltet wie links,
das Hinterende etwas breiter gerundet wie links, in Folge dessen der Unterschied in der Rundung
zwischen beiden Schalenenden annähernd, wenn auch nicht ganz geschwunden, das Vorderende mehr
oder weniger deutlich breiter gerundet als das Hinterende, Ventralrand wie links. Da die rechte Schale
die grössere, welche besonders am Dorsalrand, aber auch am übrigen Sehalenrand mit Ausnahme eines
Theiles des Hinterrandes die linke deutlich überragt, so bestimmt ihr Profil das Aussehen des ganzen
Thieres. Links finden wir am ganzen freien Schalenrande eine ziemlich breite verschmolzene Zone,
welche sich am Ventralrand der Beobachtung mehr oder weniger vollständig entzieht- dieselbe ist von
ziemlich zahlreichen schlanken, unverzweigten Porencanälen durchbohrt; der Saum entspringt in der
Nachbarschaft des Schalenrandes, überragt ihn am vorderen Körperende und in der hinteren Hälfte des
Ventralrandes deutlich; einen Innenrand habe ich nur in der hinteren Hälfte der Schale entdecken können,
wo er sich nicht sehr weit vom Schalenrand entfernt, in . der vorderen Hälfte ist er verwischt oder
fällt mit der Verwachsungslinie zusammen. Rechts liegen die Verhältnisse am Schalenrande ähnlich,
wir finden eine ähnlich breite verschmolzene Zone, dieselbe grenzt sich aber nur an einem Theil des
Ventralrandes deutlich ab, übrigens ist ihre Grenze nicht zu erkennen, sie selbst deshalb schwer nachzuweisen
(es beruht das vermuthlich darauf, dass die ganze Iiinenlamelle dünnhäutig, nicht verkalkt,
entsprechend vermissen wir auch einen Innenrand);- Saum wie links.
Beide Schalen sind von zahlreichen auffälligen Porencanälen durchbohrt, Schale mässig dicht
mit ziemlich steifen Haaren bedeckt.
F ä rb u n g : Frisch ist das Thier von schwefelgelber Färbung, welche im vorderen und hinteren
»Ja: der Schale besonders lebhaft ist. Die Färbung beruht auf Pigmentirung der Schale, tritt das Pigment
zurück, so kommt dieiKörperfärbung zur Geltung, das Stier erscheint blass orange, besondere in der
hinteren Körperhälfte, wo die Eier durchscheinen. Ein Auge ist vorhanden, ist aber beim lebenden
Thier nur schwierig nachzuweisen.
Von oben gesehen ist das Thier stark comprimirt, die Breite etwa gleich x/3 der Länge,
wenig grösser; die Seiten verlaufen im mittleren 1/3 annähernd parallel, im vorderen und hinteren */3
convergiren sie stark, so dass beide Schalenenden stark zugespitzt sind, die Spitzen sind durch die
Biegung der rechten Schale etwas abgestumpft. Die rechte Schale umfasst und überragt die linke deutlich.
Die F u rc a lä s te etwas unsymmetrisch, die Klaue 3—4 mal so lang wie der Stamm.
Vorkommen: Ich habe die Art bei Greifswald in flachen mit Laub bedeckten Gräben im
Wald oder am Waldesrand im Mai gefunden. Ausserdem aus England bekannt.
3. U n te rfamilie . Jliocyprinae
mit der einzigen Gattung Jliocypris.
J lio e y p ris Brady und Norman 1889.
Tafi 19 Fig. 7-f-19, Taf. 20 Fig. 17, 18.
Schale dicht mit deutlichen Gruben bedeckt, der Saum entspringt in der Nachbarschaft des
Schalenrandes. An der 1. Antenne haben einige Borsten die Gestalt von Klauen angenommen, sie
sind kurz, kräftig, deutlich gebogen, und zwar je eine des 5., 6. und 8. Gliedes, besonders deutlich die
des 8. (letzten) Gliedes. An der 2. Antenne ist in beiden Geschlechtern das 2. und 3. Glied des
Innenastes vollständig oder fast vollständig verschmolzen. Reste einer Trennung oft deutlich nachweisbar.
Männchenborsten fehlen; Schwimmborsten bald wohl entwickelt, dann überragen sie die Klauen
sehr bedeutend, sind ungefiedert, bald als kurze Stummel vorhanden. Die Borsten am 3. Kaufortsatz
der Maxille den übrigen gleich gebildet, in keiner Weise ausgezeichnet. Die erste thoraeale Glied-
maasse mit umfangreicher Athemplatte, beim ? mit sehr kleinem Taster, welcher noch deutlich eine
Zusammensetzung aus 3 Gliedern erkennen lässt (nach Vavra nur 2). Das nächste Beinpaar deutlich
5 gliedrig, das letzte nur 4 gliedrig (3 und 4 verschmolzen), das letzte Glied cylindrisch, mit drei langen