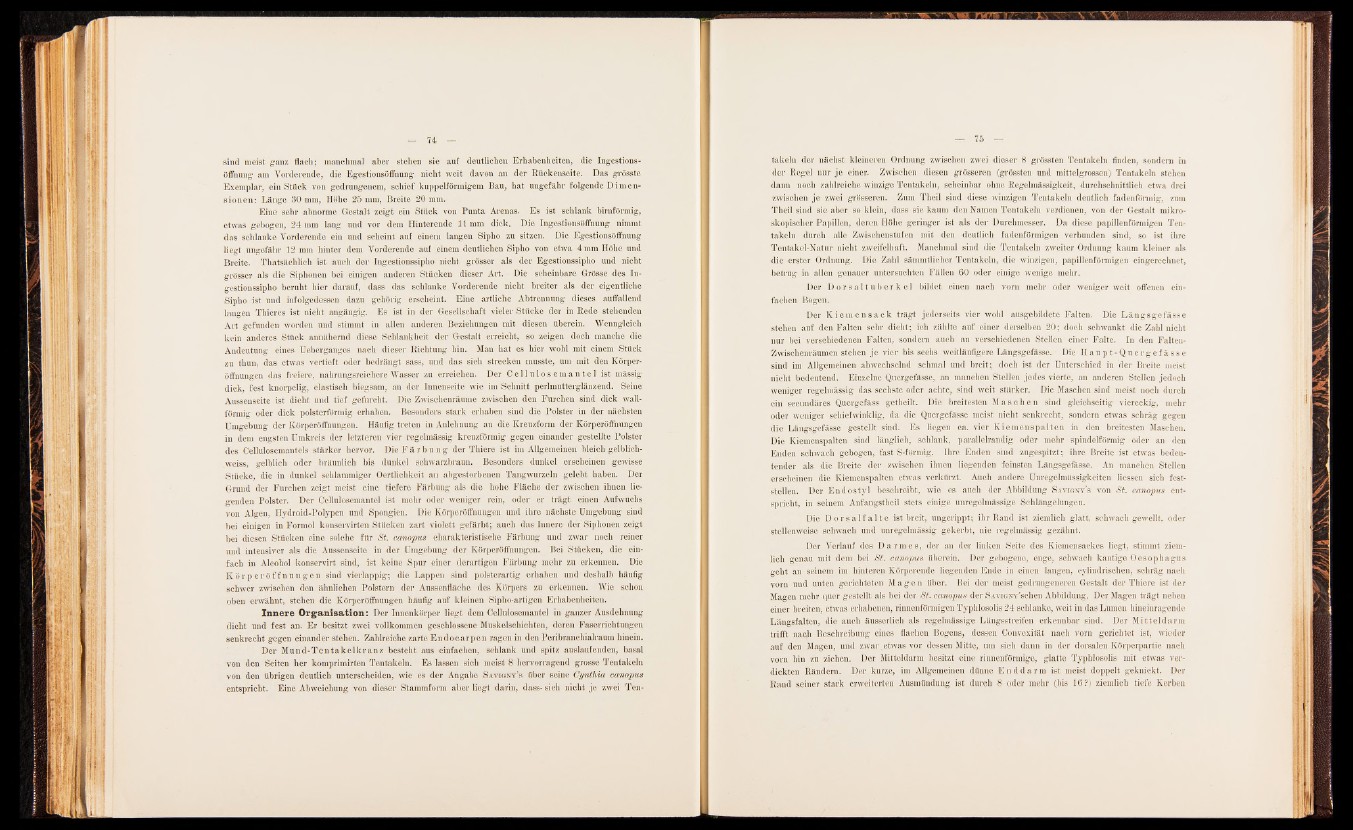
sind meist ganz flach; manchmal aber stehen sie auf deutlichen Erhabenheiten, die Ingestionsöffnung
am Vorderende, die Egestionsöffnung nicht weit davon an der Rückenseite. Das grösste
Exemplar, ein Stück von gedrungenem, schief kuppelförmigem Bau, hat ungefähr folgende Dime n-
sionen: Länge 30 mm, Höhe 25 mm, Breite 20 mm.
Eine sehr abnorme Gestalt zeigt ein Stück von Punta Arenas. Es ist schlank bimförmig,
etwas gebogen, 24 mm lang und vor dem Hinterende 11mm dick. Die Ingestionsöffnung nimmt
das schlanke Vorderende ein und scheint auf einem langen Sipho zu sitzen. Die Egestionsöffnung
liegt ungefähr 12 mm hinter dem Vorderende auf einem deutlichen Sipho von etwa 4 mm Höhe und
Breite. Thatsächlich ist auch der Ingestionssipho nicht grösser als der Egestionssipho und nicht
grösser als die Siphonen bei einigen anderen Stücken dieser Art. Die scheinbare Grösse des Ingestionssipho
beruht hier darauf, dass das schlanke Vorderende nicht breiter als der eigentliche
Sipho ist und infolgedessen dazu gehörig erscheint. Eine artliche Abtrennung dieses auffallend
langen Thieres ist nicht angängig. Es ist in der Gesellschaft vieler Stücke der in Rede stehenden
Art gefunden worden und stimmt in allen anderen Beziehungen mit diesen überein. Wenngleich
kein anderes Stück annähernd diese Schlankheit der Gestalt erreicht, so zeigen doch manche die
Andeutung eines Ueberganges nach dieser Richtung hin. Man hat es hier wohl mit einem Stück
zu thun, das etwas vertieft oder bedrängt sass, und das sich strecken musste, um mit den Körperöffnungen
das freiere, nahrungsreichere Wasser zu erreichen. Der Ce l l u l o s ema n t e l ist mässig
dick fest knorpelig, elastisch biegsam, an der Innenseite wie im Schnitt perlmutterglänzend. Seine
Aussenseite ist dicht und tief gefurcht. Die Zwischenräume zwischen den Furchen sind dick wallförmig
oder dick polsterförmig erhaben. Besonders stark erhaben sind die Polster in der nächsten
Umgebung der Körperöffnungen. Häufig treten in Anlehnung an die Kreuzform der Körperöffnungen
in dem engsten Umkreis der letzteren vier regelmässig kreuzförmig gegen einander gestellte Polster
des Cellulosemantels stärker hervor. Die F ä r b u n g der Thiere ist im Allgemeinen bleich gelblich-
.weiss, gelblich oder bräunlich bis dunkel schwarzbraun. Besonders dunkel erscheinen gewisse
Stücke, die in dunkel schlammiger Oertlichkeit an abgestorbenen Tangwurzeln gelebt haben. Der
Grund der Furchen zeigt meist eine tiefere Färbung als die hohe Fläche der zwischen ihnen liegenden
Polster. Der Cellulosemantel ist mehr oder weniger rein, oder er trägt einen Aufwuchs
von Algen, Hydroid-Polypen und Spongien. Die Körperöffnungen und ihre nächste Umgebung sind
bei einigen in Formol konservirten Stücken zart violett gefärbt; auch das Innere der Siphonen zeigt
bei diesen Stücken eine solche für St. canopus charakteristische Färbung und zwar noch reiner
und intensiver als die Aussenseite in der Umgebung der Körperöffnungen. Bei Stücken, die einfach
in Alcohol konservirt sind, ist keine Spur einer derartigen Färbung mehr zu erkennen. Die
Kö r p e r Öffnungen sind vierlappig; die Lappen sind polsterartig erhaben und deshalb häufig
schwer zwischen den ähnlichen Polstern der Aussenfläche des Körpers zu erkennen. Wie schon
oben erwähnt, stehen die Körperöffnungen häufig auf kleinen Sipho-artigen Erhabenheiten.
In n e re O rg a n isa tio n : Der Innenkörper liegt dem Cellulosemantel in ganzer Ausdehnung-
dicht und fest an. Er besitzt zwei vollkommen geschlossene Muskelschichten, deren Faserrichtungen
senkrecht gegen einander stehen. Zahlreiche zarte Endocarpen ragen in den Peribranchialraum hinein.
Der Mund-Tentakelkranz besteht aus einfachen, schlank und spitz auslaufenden, basal
von den Seiten her komprimirten Tentakeln. Es lassen sich meist 8 hervorragend grosse Tentakeln
von den übrigen deutlich unterscheiden, wie es der Angabe S avigny’s über seine CyntMa canopus
entspricht. Eine Abweichung von dieser Stammform aber liegt darin, dass- sich nicht je zwei Ten¡
H l
,1,
takeln der nächst kleineren Ordnung zwischen zwei dieser 8 grössten Tentakeln finden, sondern in
der Regel nur je einer. Zwischen diesen grösseren (grössten und mittelgrossen) Tentakeln stehen
dann noch zahlreiche winzige Tentakeln, scheinbar ohne Regelmässigkeit, durchschnittlich etwa drei
zwischen je zwei grösseren. Zum Theil sind diese winzigen Tentakeln deutlich fadenförmig, zum
Th eil sind sie aber so klein, dass sie kaum den Namen Tentakeln verdienen, von der Gestalt mikroskopischer
Papillen, deren Höhe geringer ist als der Durchmesser. Da diese papillenförmigen Tentakeln
durch alle Zwischenstufen mit den deutlich fadenförmigen verbunden sind, so ist ihre
Tentakel-Natur nicht zweifelhaft. Manchmal sind die Tentakeln zweiter Ordnung kaum kleiner als
die erster Ordnung. Die Zahl sämmtlicher Tentakeln, die winzigen, papillenförmigen eingerechnet,
betrug in allen genauer untersuchten Fällen 60 oder einige wenige mehr.
Der D ö r s a 11 u b e r k e 1 bildet einen nach vorn mehr oder weniger weit offenen einfachen
Bogen.
Der Ki eme n s a c k trägt jederseits vier wohl ausgebildete Falten. Die Längsgefässe
stehen auf den Falten sehr dicht; ich zählte auf einer derselben 20; doch schwankt die Zahl nicht
nur bei verschiedenen Falten, sondern auch an verschiedenen Stellen einer Falte. In den Falten-
Zwisehenräumen stehen je vier bis sechs weitläufigere Längsgefässe. Die Ha u p t -Qu e r g e f ä s s e
sin.d im Allgemeinen abwechselnd schmal und breit; doch ist der Unterschied in der Breite meist
nicht bedeutend. Einzelne Quergefässe, an manchen Stellen jedes vierte, an anderen Stellen jedoch
weniger regelmässig das sechste oder achte, sind weit stärker. Die Maschen sind meist noch durch
ein secundäres Quergefäss getheilt. Die breitesten Mas chen sind gleichseitig viereckig, mehr
oder weniger schiefwinklig, da die Quergefässe meist nicht senkrecht, sondern etwas schräg gegen
die Längsgefässe gestellt sind. Es liegen ca. vier Kiemenspalten in den breitesten Maschen.
Die Kiemenspalten sind länglich, schlank, parallelrandig oder mehr spindelförmig oder an den
Enden schwach gebogen, fast S-förmig. Ihre Enden sind zugespitzt; ihre Breite ist etwas bedeutender
als die Breite der zwischen ihnen liegenden feinsten Längsgefässe. An manchen Stellen
erscheinen die Kiemenspalten etwas verkürzt. Auch andere Unregelmässigkeiten Hessen sich feststellen.
Der Endostyl beschreibt, wie es auch der Abbildung Savigny’s von St. canopus entspricht,
in seinem Anfangstheil stets einige unregelmässige Schlängelungen.
Die Do r s a l f a l t e ist breit, ungerippt; ihr Rand ist ziemlich glatt, schwach gewellt, oder
stellenweise schwach und unregelmässig gekerbt, nie regelmässig gezähnt.
Der Verlauf des Darme s , der an der linken Seite des Kiemensackes liegt, stimmt ziemlich
genau mit dem bei St. canopus überein. Der gebogene, enge, schwach kantige Oesophagus
geht an seinem im hinteren Körperende liegenden Ende in einen langen, cylindrischen, schräg nach
vorn und unten gerichteten Magen über. Bei der meist gedrungeneren Gestalt der Thiere ist der
Magen mehr quer gestellt als bei der St. canopus der SAviGNY'schen Abbildung. Der Magen trägt neben
einer breiten, etwas erhabenen, rinnenförmigen Typhlosolis 24 schlanke, weit in das Lumen hineinragende
Längsfalten, die auch äusserlich als regelmässige Längsstreifen erkennbar sind. Der Mitteldarm
trifft nach Beschreibung eines flachen Bogens, dessen Convexität nach vorn gerichtet ist, wieder
auf den Magen, und zwar , etwas vor dessen Mitte, um sich dann in der dorsalen Körperpartie nach
vorn hin zu ziehen. Der Mitteldarm besitzt eine rinnenförmige, glatte Typhlosolis mit etwas verdickten
Rändern. Der kurze, im Allgemeinen dünne E n d darm ist meist doppelt geknickt. Der
Rand seiner stark erweiterten Ausmündung ist . durch 8 oder mehr (bis 16?) ziemlich tiefe Kerben